
Sommerzeit ist Zuhörzeit

Gedanken über Zuhören und Erzählen
1
Das Bild und die Geschichte darin spielt bei den „Peanuts“, einer kleinen Familie und ihrer Freunde. Peanuts, zu Deutsch „Erdnüsse“ oder „Kleinigkeiten“, ist eine US-amerikanische Comicserie von Charles M. Schulz (1922-2000). Es sind oft Alltagsgeschichten, die heiter daherkommen, aber auch ernste Hintergründe haben. Nicht wenige Kritiker meinen, die Peanuts seien schon Weltliteratur.
Auf diesem Bild treffen zwei aufeinander, die sich gut kennen und unterschiedlicher nicht sein könnten. Lucy meint, alles zu können und zu wissen, weswegen sie auch „Psychiatrische Beratung“ anbietet. Charly ist ein an sich Zweifelnder, oft schwermütig, der sich unter Menschen meist nicht so gut zurechtfindet. Darum geht er gelegentlich in die „Psychiatrische Beratung“, die ja mit fünf oder zehn Cent ziemlich preiswert ist.
2
Heute hat er aber gleich dreimal Pech. Das ist typisch für Charly. Kaum jemand nimmt ihn so richtig ernst, woran er sehr leidet. Zuerst hat Lucy, die selbst ernannte Psychiaterin, ihren „freien Tag“. Dann erkennt Charly, wer der Vertreter ist, nämlich sein eigener Haushund Snoopy. Snoopy ist eher faul, liegt gerne auf seiner Hütte, wartet auf Essen und hält sich für einen Philosophen. Der soll also jetzt psychiatrisch beraten …
Charlys Zweifel stellen sich als berechtigt heraus. Snoopy hat offensichtlich keinerlei Lust und schläft ein. Lucy gibt sich darüber erschrocken und ist bereit, die Sitzung nun doch selbst zu übernehmen. Charly beginnt von vorne und hat nun zum dritten Mal Pech: Auch Lucy, die Beraterin, schläft ein. Charly kann sich bestätigt fühlen: Wem man nicht zuhört, der oder die wird bald unsicher. Wer Rat sucht und nur auf taube Ohren stößt, wird sich bald aus der Welt und von den Menschen zurückziehen.
3
Charly erlebt etwas, was im übertragenden Sinn etwas vom Zeitgeist heute widerspiegelt: Viele reden gerne und viel – aber sie hören schlecht oder gar nicht zu. Viele stellen anderen kurze und knappe Fragen wie „Wie geht’s?“ – sind dann aber nicht bereit für eine womöglich etwas ausführlichere Antwort. Manche würden wohl gerne mal von sich erzählen, finden aber so recht niemanden, dem sie das Zuhören zutrauen. Und manche, die wir gut kennen, machen oft den Eindruck, dass sie für ein längeres Zuhören keine Zeit haben – oder keine Zeit haben wollen.
Manche Menschen leiden daran, dass man ihnen zu wenig zuhört. Auch darum müssen sie sich nach einer gewissen Zeit professionelle Hilfe suchen. Was nicht so einfach ist. Für eine professionelle psychiatrische Beratung gibt es ja auf absehbare Zeit oft keine Termine.
4
Sommerzeit ist Zuhörzeit, möchte ich jetzt mal behaupten. Auch dafür gibt es die ruhigen Wochen und die Fahrt in die Ferien: damit Menschen wieder ein wenig mehr aufeinander hören können. Das ist nicht so schwer, wie es zunächst vielleicht klingt. Es bedarf nur einer kleinen Voraussetzung – nämlich des einen, festen Willens: Ich will erst einmal nicht von mir reden; erst einmal will ich dem oder der anderen zuhören. Wirklich zuhören; hier und da auch nachfragen.
Am Anfang ist das womöglich etwas mühsam und man muss sich etwas zügeln, nicht gleich von sich zu reden und was man selber alles erlebt und erlitten hat. Aber später geht es. Und wir erleben einen oder eine glückliche andere, die sich mal „von der Seele reden konnte“, was sie bedrückt – also etwas leichter gewordene Menschen.
5
Was Jesus wirklich konnte: Er konnte sich einfühlen. Das ist kein Kraftakt, sondern das sind erst einmal nur offene und fühlende Ohren. Wer sprechen kann und fühlt, wie jemand zuhört, wird leichter. Die Dinge der Seele ordnen sich ein wenig. Und, übrigens, wer einmal anderen erzählen konnte, hört dann selber auch besser zu. Sommerzeit ist Zuhörzeit. Dafür gibt es die eher unbeschwerten, sommerlichen Stunden. Jemand hört uns zu; wir hören jemandem zu. Wir fühlen uns ein in andere.
Zuhören schenkt Leben. Das wussten die Menschen an Jesus zu schätzen. Da ist einer, der nimmt uns wirklich wahr; er nimmt uns ernst. Das löst noch keine Probleme. Es macht aber gewiss: Wir sind mit uns nicht alleine. Wir können erzählen und uns entlasten.
Zuhören ist Ernstnehmen.
Ernstnehmen ist Mitfühlen.
Mitgefühl ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes.
Und alle werden satt

Gedanken über das Teilen
1
So stelle ich mir vor, was heute manchmal „Wutbürger“ genannt wird. Die müssen ja nicht laut sein. Sie sitzen bequem und erregen sich. Auch auf dem Balkon. Sie erregen sich deswegen, weil sie erstens etwas nicht wollen und dafür dann zweitens Dinge zusammendenken, die miteinander nichts zu tun haben.
Auf dem Bild geht es ums Spenden. Offenbar hat die Frau links den Mann gefragt, ob sie nicht etwas von ihrem Besitz spenden sollten. Das ist der Moment der Erregung des Mannes, womöglich der Wut. Es fährt aus ihm heraus: SPENDEN!? JA HAT UNS DENN SCHON MAL WER WAS GESPENDET, OBWOHL HIER BALD DIE POLARKAPPEN DURCH DIE WOHNUNG SCHWAPPEN? Das Wort UNS ist noch unterstrichen, damit wir erkennen, um was es dem Mann geht: Uns spendet auch niemand was.
Die Polarkappen haben mit der Frage der Frau nichts zu tun. Der Hinweis des Mannes dient nur dazu, nichts tun zu müssen. Man riecht und fühlt förmlich des Angst des Mannes, etwas von seinem Besitz zu verlieren. Damit das nicht so auffällt, werden die abschmelzenden Polarkappen bemüht. Wer nicht teilen will, findet immer einen Grund.
2
Was würde der Mann wohl zum Sonntag des „Teilens“ sagen, den wir gestern gefeiert haben? Und zum Sonntag des großen Beschenkens durch Gott, den Herrn? Da hören wir vom Murren des Volkes Israel auf dem Weg ins Gelobte Land. Sie fühlen sich von Gott vernachlässigt. Und was macht Gott? Er beschenkt sie mit Wachteln und mit Manna, einen brotartigen Himmelstau, auch Brot der Engel genannt. Und siehe, alle werden satt, mitten in der Wüste.
Auch bei Jesus werden Tausende satt, wie durch ein Wunder, mit ein paar Broten und zwei Fischen. Wir müssen das nicht verstehen. Erklärungen für Wunder sind immer etwas peinlich, weil sie uns das Staunen wegnehmen. Hören wir einfach nur auf die Wunder: Menschen werden überraschend satt; Gott sättigt sie. Und wir staunen.
3
Der Mann auf dem Bild staunt nicht, leider. Er hält sich an seinen seltsamen Erklärungen fest. Ein Mensch, der ihn auf der Straße um ein oder zwei Euro bitten würde, bekäme bestimmt einen Schwall von Worten zu hören, warum das nicht geht und man ja selber nicht genug habe und überhaupt einfach nicht angebettelt werden will. Wir kennen vermutlich solche Worte der Abwehr.
In Wahrheit bringt Angst solche Worte hervor. Man denkt dann nicht mehr an die gefüllte Geldbörse – die Frage nach einer kleinen Spende löst Angst aus; Angst vor dem Verlieren. Wer Menschen zum Teilen ermutigen möchte, sollte ihnen vorher die Angst nehmen. Und wie geht das?
4
Es gibt nur einen Weg. Wir sollten darüber staunen, wie beschenkt wir sind, wie es in einem alten Lied im Gesangbuch heißt (EG324,3): „Was sind wir doch? Was haben wir auf dieser ganzen Erd, das uns, o Vater, nicht von dir allein gegeben werd?“ Das ist die Frage von Paul Gerhardt, dem Liederdichter, an uns. Nur eine Frage. Er bittet uns zu überlegen, ob wir das, was wir haben, uns selber verdanken. Haben wir unsere Kräfte gemacht? Unseren Verstand? Hätte nicht alles auch ganz anders kommen können – und wir lebten in Not? Das sind nur Fragen, wichtige Fragen. Aber es sind Fragen, die unsere Antwort verdienen: Verdanke ich mich mir selber? Oder staune ich, weil da so viel Gnade im Spiel ist?
5
Wer sich beschenkt weiß, schenkt gerne weiter. Wer eine Ahnung davon hat, dass man sein Glück nicht sich selber verdankt, gibt auch gerne; teilt seinen Besitz. Wir sollen uns nicht arm machen, aber gerne geben. Es gibt ja ernst zu nehmende Menschen, die sagen: Wir haben manches weggegeben – und haben gar nichts verloren. Wir hatten Angst – aber es gab im Nachhinein gar keinen Grund dafür. Das gefällt mir. Ich möchte diesen Menschen gerne glauben. Mein Besitz ist mir auch gegeben, geschenkt worden, damit ich darüber staunen kann und angemessen teilen möchte. Und dabei überhaupt nichts verliere. Im Gegenteil: Manchmal empfange ich einen Dank, der mich überwältigt.
Ob das dem Herrn auf dem Bild hilft? Ich weiß es nicht. Er hat sich vermutlich die Frage noch nicht gestellt, ob er wirklich alles sich selber verdankt. Er sollte es tun. Vielleicht kommt er dann auf die Antwort, die sich Paul Gerhardt gibt (EG 324,7+8): Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir … du nährst und stehst uns, wenn wir in Gefahr geraten, treulich bei.
Es kommt auf einen Versuch an: Wir teilen – und verlieren nicht.
Das lohnt sich zu üben. - Und alle werden satt.
Christus in mir: Der Mensch werden, der ich bin

Gedanken über die „Identität“
1
Ein Fingerabdruck ist das unverwechselbare Kennzeichen einer Person, ein Ausweis ihrer Identität. Aber er beantwortet nicht die Frage, wer ich bin. Was macht meine Identität aus? Worüber definiere ich mich? Was macht mich aus?
Der Begriff „Identität“ bedeutet: „Mit jemanden oder etwas völlig übereinstimmen.“ Heute scheint das eine der größten Herausforderungen zu sein: „Man selbst“ zu sein. Groß ist die Sehnsucht nach einem Leben, das sich „echt“ anfühlt. Die Botschaft ist: Wer zu seinem „wahren Ich“ vordringt, der hat ein glückliches Leben.
2
Das spiegelt sich in der Kultur der sozialen Medien: „Du selbst zu sein in einer Welt, die dich ständig anders haben will, ist die größte Errungenschaft“, lese ich im WhatsApp-Status einer Bekannten. Eine andere nutzt diesen Spruch als Profilbild: „Sei du selbst, alle anderen gibt es schon.“ Und die nächste postet bei Facebook: „Sei mutig. Sei abenteuerlustig. Hab große Träume. Verlieb dich. Bleib verrückt. Sei frei. Sei du selbst.“
3
Bis vor wenigen Generationen waren die Menschen damit zufrieden, die Rollen auszufüllen, die ihnen vom sozialen Umfeld zugeteilt wurden. Erst als sich neue Räume für Freizeit und Privatleben öffneten, fingen die ersten an, sich zu fragen, wie sie eigentlich sie selbst sein können. Für viele war es ein befreiender Schritt, sich nicht mehr über andere zu definieren, sondern sich auf die Suche nach sich selbst zu begeben.
Kurioserweise fühlen sich aber viele inzwischen gedrängt, sich an das neue Ideal, individuell und originell zu sein, anzupassen. Besonders, seit man das eigene Ich rund um die Uhr digital in Szene setzen und von anderen bewerten lassen kann. Und je freier und individueller sich die Menschen geben, desto austauschbarer werden die immer gleichen Profile auf Facebook und Co.
Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber (1878-1965) schrieb: „Der Mensch wird erst am Du zum Ich“. Nur in Beziehung erkennen wir, wer wir sind. Was macht also die Identität eines Christen, einer Christin aus?
4
Das Bild bringt mich auf die Spur: Es ist Jesus! Auf die Frage: Wer bin ich? lautet meine Antwort: „Christus in mir“. Er ist die Basis meiner Identität. All die Faktoren, die die Identität eines Menschen bestimmen, werden bei Christinnen und Christen bestimmt durch Jesus, durch das neue Leben, das er schenkt. Natürlich erleben auch Christinnen und Christen Lebenskrisen, wenn Dinge wegbrechen, die normalerweise die Identität von Menschen bestimmen. Aber sie können uns nie unsere wahre Identität nehmen. Der Grund unserer Identität liegt nicht mehr in uns selbst, sondern in Jesus. Dieses neue Leben kann niemand nehmen.
5
Jesus hat die Voraussetzung geschaffen, unser Sein zu erneuern. Gott sieht in uns Jesus, seinen Sohn. Die Bibel spricht oft von Gottes Töchtern und Söhnen, um unsere Identität zu beschreiben. Was Jesus getan hat, bestimmt, wer wir sind. Dafür steht das Kreuz, das in den abgebildeten Fingerabdruck eingezeichnet ist.
Der Weg zu meinem neuen Selbst ist dann, meine Sicht mit Gottes Sicht und Wahrheit in Übereinstimmung zu bringen und mich selbst so zu sehen, wie Gott mich sieht. Weil ich mich als von Gott angenommen, geliebt, sicher und bedeutungsvoll erkenne, kann ich mich selbst annehmen und eine erfüllende Beziehung mit Gott leben. Das führt zu Freiheit von den Umständen, tiefer Freude, großer Gelassenheit und persönlichem Wachstum.
Taufe ist Liebe. Bedingungslos!

Eine Geschichte nicht nur für Kinder
1 Das Bild
Auf dem Bild sehen wir ganz viel Landschaft: Wiesen, kleine Wälder, hinten ein Dörfchen und oben den Himmel mit Wolken. Es scheint ein bisschen zu regnen. Unten auf dem Bild ist ein Fluss. Im Fluss steht ein Mann auf einem Stein. In der linken Hand hat er einen Holzstab, oben ist ein kleines Kreuz. Der Mann trägt eine braune Kutte, beinahe wie ein Mönch. Seine rechte Hand hält er so, dass etwas vom Regenwasser in seine Hand kommt. Dieses Wasser fließt auch auf den anderen Mann, der im Fluss steht. Er hat nur einen Umhang um, seine Hände sind vor der Brust gefaltet.
2 Die Deutung
Auf dem Bild wird eine kleine Geschichte dargestellt, die auch in der Bibel steht. Der Mann mit dem Kreuzstab im Arm heißt Johannes. Er ist genau ein halbes Jahr vor Jesus geboren worden, hat also am 24. Juni Geburtstag. Johannes wird oft „Johannes der Täufer“ genannt. Das liegt daran, dass er viele Menschen getauft hat. Am liebsten machte er das in einem Fluss, der im Land Israel fließt. Der Fluss heißt Jordan. Menschen kamen zu Johannes und wollten getauft werden. Gerne machte Johannes das. Er sagte aber vorher immer: Bitte, ändert auch euer Leben. Ich taufe euch gerne, damit ihr für andere Menschen da sein könnte. Taufe ist Liebe. Und Liebe gibt man gerne weiter.
3 Die biblische Geschichte (Mt 3,13-17)
Eines Tages, so erzählt es der Evangelist Matthäus, steht ein Mann vor Johannes und will getauft werden. Johannes sagt: Nein, dich taufe ich nicht. Du bist Jesus. Ich bin viel zu gering, um dich zu taufen. Jesus sagt: Doch, bitte, taufe mich jetzt. Dann tut es Johannes. Er hat Wasser in seiner Hand, wie wir auf dem Bild sehen, und tauft Jesus. Jesus ist wohl sehr dankbar dafür und faltet seine Hände. In diesem Augenblick geschieht etwas Merkwürdiges. Menschen sehen eine Taube am Himmel – und hören dann noch eine Stimme, die sagt: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Es ist, als wolle Gott sagen: Jesus ist mein Sohn; ich liebe ihn. Wenn Gott so etwas sagt, dann wünscht er sich bestimmt, dass wir Jesus auch lieben können.
4 Die Taufe
Johannes ist der erste Mensch, von dem wir wissen, dass er andere Menschen getauft hat. Das hat er sehr gerne gemacht. Von da an haben noch viele Menschen andere Menschen getauft: Babys, kleine Kinder, Konfirmandinnen und Konfirmanden, Erwachsene und manchmal auch alte Menschen. Es ist nicht so wichtig, wann man getauft wird. Viel wichtiger ist, dass man getauft wird. Taufe ist nämlich Liebe. Gott sagt mit dem Zeichen des Wassers: Ich liebe dich, Mensch. Bedingungslos. Du musst nichts dazu tun. Was immer auch geschieht in deinem Leben: Ich, Gott, liebe dich. Und freue mich, wenn du meine Liebe weitergibst an andere Menschen.
Taufe ist etwas Wunderbares. Weil Gott dann ganz nahe ist, ganz nahe an unserem Herzen. Und wo Gott ist, ist Liebe. Liebe ist das größte Wunder der Welt. Wo Liebe ist, ist Gott.

Ein Blick, der sagt: Komm doch
Gedanken zum Gleichnis Lukas 15,1-3.11b-32
1
Die Gesten sind eindeutig: ausgestreckte Arme, geöffnete Hände beim einen. Der ganze Körper sagt: Komm her. Ich will dich trösten, dich umarmen. Der andere: die Hände vors Gesicht geschlagen, der Oberkörper gebeugt. Die ganze Haltung eher ein Zurückweichen als ein Entgegengehen. Der ganze Körper sagt: Ich schäme mich; ich bin einer Umarmung nicht wert.
Eine große Erzählung kommt in dieser Szene zu ihrem Höhepunkt. Die Erzählung von Vater und Sohn, deren Wege sich getrennt hatten. Die fern voneinander gelebt haben. In den Höhen und Tiefen des Alltags der eine: Vater, Großbauer, Familienoberhaupt. In den Höhen und Tiefen eines ausschweifenden Lebens der andere: jüngerer von zwei Söhnen, Bruder, Erbe, gescheiterte Existenz.
Der Sohn kehrt zurück. Er weiß keinen anderen Ort für sich als den, von dem er einst fortgezogen ist. Er kehrt zurück – mittellos, beschämt, in der Gosse gelandet. Er kehrt zurück als einer, der für tot gehalten wurde, in der Fremde verschollen.
2
Die Szene des Wiedersehens von Vater und Sohn ist vielfach gemalt und gestaltet worden. Das Schöne an dieser ist, dass man als Betrachter oder Betrachterin die unterschiedlichsten Perspektiven einnehmen kann. Ich kann mich direkt neben den Vater stellen; ich kann mich hineinversetzen in die Freude, den Totgeglaubten vor mir zu haben; ich versuche das Glück zu empfinden, ihn im nächsten Moment in die Arme zu schließen. Und ich bin zugleich verunsichert vom gesenkten Blick, dem angehaltenen Gang. Ich ahne ein Zurückweichen. Für mich spielt keine Rolle, was in der Zeit seit seinem Weggang geschehen ist. Aber ist es auch ihm egal? Überwältige ich ihn mit meiner vorbehaltlosen Freude?
So wechsle ich die Perspektive, stelle mich neben den jungen Mann. Senke den Blick, schlage die Hände vors Gesicht. Kann gar nichts sehen; nicht die geöffneten Hände des Vaters, nicht den erwartungsvollen, etwas fragenden Blick, nicht den Schritt auf mich zu. Ganz klein möchte ich mich machen. Die Vorwürfe über mich ergehen lassen.
Nein, mir ist nicht danach zumute, aufrecht zu stehen. Eigentlich wäre ich lieber woanders. Aber ich weiß nicht, wo ich hin kann, wo ich sonst überleben könnte. Soweit, so plakativ. Vielleicht auch zu eindeutig: der zerknirschte Sohn hier, der barmherzige Vater dort.
3
Wie schön, denke ich, dass es noch weitere Perspektiven gibt. Ich stelle mich so, dass ich beide im Blick habe. Bin nun der dritte im Bunde, wie der ältere Sohn, der ältere Bruder, der, der Zuhause geblieben ist. Ich habe mich beteiligt an den Mühen des Alltags, habe Tag um Tag, Jahr um Jahr auf dem Hof geschuftet. Mein Bruder dagegen hat was von der Welt gesehen. Der ist ausgebrochen aus dem, was bisher war, dem bäuerlichen Lebens. Hat sich nicht geschert um das, was mal werden würde, wenn die Alten nicht mehr können. Er hätte ja auch bleiben und mir zur Hand gehen können. Ich wurde nicht gefragt, ob ich den Hof erben will. Es war selbstverständlich so. Nun schaue ich mir das an: Soll der sich ruhig schämen. Und ein paar deutliche Worte an ihn könnten auch nicht schaden.
Aber Ich wundere mich über unseren Vater. Ich hätte nicht gedacht, dass es ihm so nahe gegangen ist, dass der „Kleine“ sich mit seinem Erbteil aus dem Staub gemacht hat. In mir streiten gemischte Gefühle: Der Vater rührt mich. Dieser Blick, dieses leicht Fragende, ob nun wohl alles gut werden wird. Das lässt mich zweifeln und ich frage mich: Muss ich dem Bruder alles aufrechnen? Muss ich dem Vater vorhalten, dass ich es als ungerecht empfinde, wenn er meinen Bruder so mir nichts dir nichts wieder in seine Arme schließt?
4
Je länger ich mir die Szene anschaue, je mehr ich mich verwickeln lasse, je mehr ich das Ganze aus unterschiedlichen Perspektiven anschaue, desto mehr schwindet die Eindeutigkeit. Was aber bleibt, sind die geöffneten Arme und Hände dieser Schritt zur Vergebung, und der Blick, der sagt: Komm doch. Nur noch ein Schritt.

Einen Stein ablegen
Gedanken über Jesu Einladung aus Matthäus 11,28: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken“.
1
Seit Jahrhunderten pilgern Menschen auf dem Olavsweg. Ein Pilgerweg in Norwegen, der von Oslo zum Nidaros-Dom nach Trondheim führt.
Dabei gibt es eine wichtige Station. Sie ist auf dem Foto abgebildet. Der Pfad führt durch die karge, einsame Landschaft auf eine Hochebene. Schon von Weitem wird der Steinhügel sichtbar: Allmannrøysa. Ein norwegischer Name, der sich kaum übersetzen lässt. Ein Ort, an dem im Mittelalter wohl Gericht gehalten wurde. Hier oben ist es ungemütlich. Der pfeifende Wind treibt die bauchigen, grauen Wolken umher. Außer dem Pfeifen ist es still. Der Blick schweift in die Ferne: eine Welle aus Bergen, manche mit weißen Spitzen, manche durch den Schatten der Wolken verdunkelt. Davor erstreckt sich die weite, menschenleere Ebene.
2
Direkt vor uns liegen unzählige verschiedene Steine, aufgeschichtet zu einer mehrere Meter hohen Pyramide. Viele Pilgerinnen und Pilger der letzten Jahrhunderte haben hier einen Stein abgelegt. Manche bringen den Stein von zu Hause mit. Andere suchen ihn auf dem Weg oder an diesem Ort. Für manche ist es Symbol für ein schlechtes Erlebnis. Für andere ist es Symbol für eine Last, die sie im Leben tragen müssen. Für wieder andere ist es auch Symbol für eine Sünde. Die Steine sind sehr unterschiedlich.
Auch Menschen müssen unterschiedlich viel und schwer in ihrem Leben tragen. Was auch immer der Stein für jeden einzelnen Pilger und jede einzelne Pilgerin bedeutet. Wie groß, kantig, geschliffen oder rissig der Stein auch sein mag – die Steine werden alle an derselben Stelle abgelegt.
Das Ablegen verbindet die Pilger seit Jahrhunderten miteinander. So wie der äußere Pilgerweg ein Zeichen für den inneren Weg werden kann, so kann auch das Ablegen des Steines an dieser Stelle den Weg verändern. Der Weg bis zu der Steinpyramide kann schwer sein: Es geht bergauf, jedes Gramm des mitgebrachten Steines wiegt. Nach dem Ablegen kann es nicht nur äußerlich leichter weitergehen. Auch innerlich kann sich ein Gefühl der Entlastung und Erleichterung einstellen.
3
Eine Last ablegen. Wie gut das tut. Davon handelt auch der Wochenspruch. Jesus spricht da: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“
Hat diese Steinpyramide auf dem Weg vielleicht etwas mit Jesus zu tun? Jesus ruft Menschen zu sich, die Schweres zu tragen haben in ihrem Leben: physische und psychische Krankheiten, Scheidungen, Trauer und Verluste, hohe Arbeitsbelastung oder Arbeitslosigkeit, Armut, Einsamkeit. Die Steine können ganz unterschiedlich sein. Aber alle die sie tragen, können zu ihm kommen.
Manchmal ist der Weg zu Jesus hin nicht leicht. Und auch nicht alle Lasten können einfach abgelegt werden. Aber Jesus sagt im Wochenspruch zu, dass er dir helfen wird, deine Lasten zu tragen. Bei ihm kannst du ausruhen. Und wenn du dann weitergehst auf deinem Pilgerweg des Lebens – bleibt vielleicht ja auch ein Stein von dir auf diesem Hügel zurück.
Auf Wiedersehen!

Gedanken über Himmelfahrt und Wiederkehr
1
Die alte Dame ist 85 und lebt in einem Seniorenheim in Erfurt. Eines Tages eröffnet sie ihren Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen einen kühnen Plan. Sie möchte noch einmal in ihrem Leben groß verreisen. Wohin soll’s denn gehen, wird sie gefragt. Nach Australien! Da bricht etwas über sie herein, was Jüngere einen „Shitstorm“ nennen würden. Ob sie denn wahnsinnig sei? Komplett übergeschnappt? Nach Australien? Das werde sie doch nicht überleben! Denk doch mal, die Hitze! Das Ozonloch! Die giftigen Schlangen! Die alte Dame lächelt in sich hinein – und sitzt ein paar Tage später im Airbus A 380 nach Sidney. Nach vier Wochen kehrt sie zurück in ihr Seniorenheim. Außer einer heftigen Erkältung bringt sie eine schier unendliche Fülle von Eindrücken mit nach Hause. Kann man in den Gesichtern ihrer Mitbewohner leichte Anflüge von Neid erkennen?
Nun, es muss ja nicht Australien sein. Auch der Odenwald ist ein lohnendes Ziel, das Sauerland, der Hunsrück. Oder zu Fuß um die Ecke dorthin, wo man noch nie war.
2
Warum reisen Menschen? Warum brechen sie auf, erheben sich von ihrem Sofa? Das Wort Reise kommt ja vom germanischen „Reisa/sich erheben“, siehe auch das angelsächsische „to rise“. In den meisten Religionen gilt die Bewegung durch die Welt als rechte Lebensführung, als Instrument der Katharsis, der Reinigung. Als Mittel zur Erleuchtung. In dem hinduistischen Lehrbuch Aitareya Brahmana etwa steht geschrieben: „Es gibt kein Glück für den Menschen, der nicht reist. Des Wanderers Füße sind wie eine Blume: seine Seele wächst, erntet Früchte; seine Mühen verbrennen die Sünden. Also brich auf! Wenn du rastest, rasten auch deine Segnungen; sie stehen auf, wenn du aufstehst, sie schlafen, wenn du schläfst, sie regen sich, wenn du dich regst. Gott ist der Freund der Reisenden. Also brich auf.“
3
Vielleicht braucht es nicht unbedingt solch eine religiöse Überhöhung. Vielleicht genügt ja das Wörtchen Sehnsucht, in dem Verlangen und Suche vereint sind. Neues, Unbekanntes entdecken! Wie gesagt, das kann auch eine Wiese oder ein kleiner See ganz in der Nähe sein, wo man einfach mal sitzt und schaut und nachsinnt über das Leben. Gleich wo und wie: Menschen suchen nach Augenblicken des Glücks, wo sie spüren: Ja, hier und jetzt bin ich ganz da und selbstverständlich ist das alles nicht mit diesem Dasein.
Die Zeit verrinnt langsamer, wenn wir Neues erfahren, wenn wir dem Alltag entfliehen, dessen Konturen allzu gern zu einem gesichtslosen Klumpen des Gewohnten zerfließen. Und letztlich geht es wohl auch darum, etwas zu schaffen, was wir Erinnerung nennen. An das wir zurückdenken können, wenn es einmal dunkler wird und wir nicht mehr ohne weiteres ein Flugzeug oder ein Fahrrad besteigen können. Der Dichter Jean Paul (ein Zeitgenosse Goethes) hat diesen wunderbaren Satz geprägt: „Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.“ Vielleicht sind es ja solche Augenblicke des Staunens, der Ergriffenheit und der Dankbarkeit, aus denen sich das bildet, was wir „ewiges Leben“ nennen? Vielleicht machen wir ja nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Schöpfer reicher, wenn wir mit wachen, bewegten Augen auf seine Schöpfung blicken, bevor wir uns auf den Weg begeben, den wir „die letzte Reise“ nennen.
4
Eine Reise, die auch Jesus angetreten hat, als er diese Erde verließ. Auch er nahm eine Fülle unterschiedlicher Eindrücke und Bilder mit. Es mag ihm wie uns schwergefallen sein, sich zu verabschieden.
Was seine Reise von unserem Reisen unterscheidet: Er ist damals fortgegangen, um nicht nur wiederzukommen, sondern für immer hier und bei uns zu bleiben. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten wird der Schmerz des Abschiedes spürbar, aber auch die Hoffnung auf die Wiederkehr Jesu in Gestalt des Windes, der Luft zum Atmen, der guten Gedanken und der Kraft, das Richtige zu tun. Wenn wir reisen, suchen wir ein Stückchen vom Himmel. Wenn Jesus aufbricht, wird er den Himmel stückchenweise zur Erde bringen, überall da, wo sein Geist weht und Hoffnung weckt.

Der Ladenhüterhirte
Gedanken zum Wochenspruch Johannes 10,11a.27-28a
1
Schon seit vielen Wochen steht es in der hinteren Ecke einer Flohmarkthalle und wartet auf einen Käufer. Eine großformatige Darstellung von Jesus als dem guten Hirten, wie sie früher in manchem Wohnzimmer zu finden war. Das Bild wirkt wie aus der Zeit gefallen mit seinem weichgezeichneten und etwas kitschigen Stil. Sowohl die Art der Darstellung als auch die Bildersprache vom Schaf und den Hirten haben kaum noch eine Verbindung zu unserem modernen Alltag. Und so habe ich meine Zweifel, ob sich überhaupt noch eine Käuferin oder ein Käufer für diesen Ladenhüter findet.
2
Und doch gibt es offenbar etwas an diesem alten Motiv vom guten Hirten, das auch in unserer Zeit immer noch Menschen anspricht und berührt. Wenn in Gottesdiensten oder Trauerfeiern Psalm 23 gebetet wird, bin ich immer erstaunt, welche Kraft in diesem Bild vom guten Hirten steckt. Wenn wir gemeinsam beten: „ Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln …“ lässt sich manchmal spüren, wie sehr diese alten Worte Trost, Geborgenheit und Vertrauen vermitteln.
Auch Jesus beschreibt mit diesem Bild seine Beziehung zu den Menschen, die mit ihm verbunden sind: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.
Ihm geht es vor allem um das Hören: Kaum ein Tier hat solche Probleme mit der Orientierung wie ein Schaf. Anders als z.B. eine Ziege ist ein Schaf auf Hilfe angewiesen, um seinen Weg nach Hause zu finden. Es ist angewiesen auf die Stimme des Hirten, von dem es Orientierung und Richtung erhält.
3
Vielleicht ist diese Suche nach Orientierung und das Hören auf die richtigen Stimmen heute aktueller denn je.
In der Menschheitsgeschichte hat es noch keine Generation geben, die so vielen Stimmen und Meinungen ausgesetzt war wie die heutige. Den Menschen in unserer Gesellschaft erreichen nach wissenschaftlichen Erhebungen jeden Tag durchschnittlich 90–120 Werbebotschaften mit hirnphysiologisch nachweisbarer Wirkung. Derzeit wird jeder Deutsche pro Tag mit rund 6.000 Informationen konfrontiert. Dazu kommt das Phänomen der Fake-News, die es uns immer schwerer machen, in dem lauten Durcheinander der Stimmen und Meinungen die Orientierung zu behalten.
So stellt sich die Frage: Welcher Stimme folge ich? In den sozialen Medien wie Facebook, Twitter oder Instagram kommt es entscheidend darauf an, wem ich folge, auf wessen Nachrichten und Bilder ich mich einlasse. Diese Quellen beeinflussen die Art, wie ich denke, und den Weg, den ich gehe.
4
Von daher kommt es für die Menschen, die sich an Jesus orientieren wollen, darauf an, seine Stimme aus den unzähligen Stimmen und dem Lärm der Zeit herauszuhören. „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir“, sagt Jesus. Diese Art von „Schaf-Sein“ hat nichts mit einem gedankenlosen Mitlaufen im Schutz der Herde zu tun, das auf eigenes Denken und Fühlen verzichtet. Es beschreibt vielmehr das Leben aus einem inneren Zentrum heraus, in dem ich mich mitten in allen Unsicherheiten und Kämpfen des Alltags geborgen und gehalten weiß. Es beschreibt das Wissen um eine Stimme, die es gut mit mir meint und die mir hilft, meinen Weg zu finden.
Ich vermute, dass der Maler des Hirtenbildes, das immer noch in der Flohmarkthalle steht, genau das vor Augen hatte. Sein Bild mag in der heutigen Zeit ein Ladenhüter sein. Das Motiv vom guten Hirten ist es mit Sicherheit nicht.
Liebe und sonst nichts
Liebe kennt keine Bedingungen
Gedanken zum Gottesbild des liebenden Vaters
1
Dieses lässig-luftige Bild zeigt uns den schlimmsten Moment eines Lebens überhaupt: Liebe, die an Bedingungen geknüpft wird. In allen Gesichtern sehen wir einen gewissen Schrecken. Aber doch sehr unterschiedliche Schrecken. Die Erwachsenen, wohl die Eltern, schauen mit leicht gebeugten Köpfen und einer deutlichen Enttäuschung im Gesicht. Das Kind hingegen schaut, den Kopf nach oben gereckt, wie ertappt. Offensichtlich hat es sich gerade verspielt oder etwas nicht gut genug gespielt. Und dann fällt der Satz, der so schrecklich niederschmetternd ist und Leben mehr auslöscht als aufbaut: „Wenn Du uns wirklich liebtest, kämen die Triolen aber deutlich flüssiger!“ Triolen sind Notenfolgen aus drei Noten, die man etwas abgehackt spielen kann – oder eben flüssig-elegant. Der Junge hat sie offenbar nicht flüssig genug gespielt, finden die Eltern. Und verbinden ihre Kritik am Klavierspiel mit der zu geringen Liebe des Kindes.
Hier ist Liebe keine Liebe mehr, sondern ein Geschäft. Liebe, die mit „Wenn Du …“ beginnt, ist keine. Sie ist nur ein Handel.
2
Mit dem Sonntag Invokavit, dem Sonntag nach Aschermittwoch, beginnt in den Kirchen das Gedenken an die Leidenszeit Jesu. Die kommenden sechs Wochen bis Ostern sind heute besser bekannt als die „Fastenzeit“. Das ist sie auch für die, die es möchten. Es soll eine Zeit des Verzichts sein, worauf auch immer. Als die Kirche noch das alltägliche Leben der Menschen bestimmte, gab es in der Fastenzeit wenig oder gar kein Fleisch, keine Sexualität, keinen Alkohol und anderes mehr. Sehr streng war das Fasten oft in den Klöstern. Ausgenommen vom Fasten waren lediglich die Sonntage als die Tage des Herrn.
Heute wird weniger wegen des Leidens Jesu gefastet, sondern eher wegen des eigenen Wohlbefindens. Es soll nicht zu jeder Zeit alles möglich sein - oder man möchte sich einfach bescheiden, einschränken; vielleicht will man auch abnehmen. Menschen wollen lernen, auf dieses oder jenes zu verzichten.
Aber doch nicht auf die ehrliche Liebe.
3
Liebe kennt keine Bedingungen. Sonst wäre sie ja ein Geschäft im Sinne von: Wenn Du dieses tust oder lässt, liebe ich Dich. Oder: Wenn Du dieses oder jenes tust, liebe ich Dich nicht oder nicht mehr.
Wenn man das liest, klingt es grausam, geradezu unmenschlich. Aber im alltäglichen Leben geschieht vieles genauso. Das Bild zeigt nur eine Überzeichnung, eine Übertreibung: Wenn Du uns wirklich liebtest, würdest Du besser Klavier spielen. Diese Bedingung ist unmenschlich und der Liebe unwürdig. Tatsächlich aber gibt es überall in Familien und Partnerschaften kleine, manchmal versteckte Bedingungen. Weil er oder sie nicht aufräumt, zu spät kommt, zu lange oder zu wenig schläft usw. - das sind die kleinen, alltäglichen Anlässe für Streit, oft sogar für Trennungen. Dazu gehört nicht zuletzt auch das berüchtigte: „Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst …“. Bedingungen sollen etwas erzwingen, was nicht erzwingbar ist.
Man liebt, oder man liebt nicht.
Und wenn man liebt, löst man Konflikte, ohne die Liebe an Bedingungen zu knüpfen.
4
So erzählt es Jesus von Gott. Was könnte Gott alles für Bedingungen an uns stellen. In Wahrheit ist er aber der, erzählt Jesus, der es kaum erwarten kann, dass seine Kinder immer wieder zu ihm finden (Lukas 15,11-32). Die Betonung liegt wirklich auf „immer wieder“. Und selbst das Kind, das mit einem Paukenschlag und dem gesamten Erbe vor der Zeit das Haus der Eltern verlässt - offenbar unbelehrbar - erwartet der Vater sehnsüchtig an der Tür, als es voller Reue heimkehrt. Der Vater verlangt nichts. Er freut sich bedingungslos.
Immer stand dem Kind diese Tür offen. Niemals sagte der Vater oder die Mutter: „Solange Du Deine Füße unter meinen Tisch stellst“. Oder: „Wenn du jetzt gehst, dann …“.
5
Gott ist der in einer offenen Tür wartende Vater. Es gibt kein schöneres Bild von Gott. Und kein wichtigeres Erkennen für uns: Wir können heimkehren. Es gibt keine Bedingungen. Wir müssen nicht fasten, um geliebt zu werden von Gott. Wir müssen ihm nichts beweisen. Es genügt, dass wir wie Jesus denken, sagen und handeln (Matth. 4,10): Allein Gott anbeten. Gott zuerst. Zuerst die Frage: Was will er? Sollte ich umkehren?
Gott hat Menschen erschaffen, damit er sie lieben kann. Und wir einander. Bedingungslos.
Gutes Leben

Gedanken zu Amos 5,24 „Es ströme das Recht wie Wasser …“
1
„Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.“ So heißt es im Buch des Propheten Amos im 5. Kapitel. So sagt er es seinen Zeitgenossinnen, seinen Zeitgenossen und Landsleuten. Die Sehnsucht danach ist groß und die Hoffnung auf Recht und Gerechtigkeit auch. Dahinter steht die Erkenntnis, dass es, so wie es ist, nicht gut ist für alle; dass genau das fehlt: Recht und Gerechtigkeit als Grundlage eines guten Lebens für alle Menschen. Amos ergreift Partei und er traut sich zu sehen, was möglich ist, wenn man Gott an der richtigen Stelle sucht.
2
Stellen Sie sich das bitte mal einen Augenblick vor: ein nie versiegender Bach. Ein Strom, der nicht abreißt, lebendiges Wasser, das sprudelt und in der Sonne blitzt und blinkt, das rauscht und frische Kühle verbreitet. Ein Fluss, in dem ich meine Hände waschen kann, ein Bach, an dem ich meinen Durst stillen kann, in dem Fische schwimmen und Libellen darüber schwirren. Vielleicht tauche ich auch meine Füße ein. Sicher ist es ziemlich kalt und erfrischend. Macht mich wieder munter und wach, lebendig, lässt mich aufleben.
Der Prophet Amos schaut in unsere Welt und er spricht aus Glauben an Gott. Bei aller Kritik an den Zuständen dieser Welt behält er Hoffnung. Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach - so kann es sein in unserem Leben. So soll es sein in unserem Leben. Und das nicht nur im eigenen Leben, nicht nur für mich.
3
Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Wie stellen Sie sich das vor? Was halten Sie davon? Zu schön, zu lieb, zu naiv? Oder ja, ganz genauso. Endlich. Ich hoffe darauf.
Recht und Gerechtigkeit. Die beiden gehören zusammen. Das eine ist nicht ohne das andere. Beide sind Beziehungsbegriffe, beiden geht es um Leben, Gelingen. Beide eröffnen einen Möglichkeitsraum, in dem gutes Leben Platz hat und aufblühen kann. Beides braucht es für ein gutes Leben.
Das ist nie nur für mich allein zu haben. Das gibt es für alle. Stellen Sie sich bitte einen Augenblick vor, wie das aussieht: ein Leben in Recht und Gerechtigkeit für alle? Wie sieht ein gutes Leben aus? Wann sage ich, mein Leben ist es gut? Was braucht es dafür? Was braucht es dafür in der Gemeinschaft unserer Gemeinde, unserem Quartier? Wie sieht sie aus, Gottes Option für die Armen in unserer Kirche? Gottes- und Nächstenliebe, wie wird das lebendig? Es wird uns doch offenbar zugetraut, dass wir so miteinander leben können. Ja – das ist ein Anspruch an uns. Und ein großes Zutrauen.
Recht und Gerechtigkeit, die erfrischen und aufleben lassen. Was für eine großartige Hoffnung. Daran halte ich fest.
In dieser Andacht, viele Fragen und kaum Antworten. Vielleicht haben Sie ja Möglichkeit sich auszutauschen und gemeinsam Antworten zu finden.
Wunde Punkte – schmerzende Worte

Gedanken zu Hebräer 4,12-13
1
Es tut weh. Diese Frage hat sich in ihr Innerstes gebohrt. War es nicht wunderbar gewesen, wie sie sich sonst, vertraut miteinander, stundenlang erzählt hatten? Je mehr sie versucht, sich andere Erinnerungen ins Gedächtnis zu rufen, um diese eine fragende Bemerkung zu vergessen, umso mehr schmerzt es. Auch das Glas Wein hat sie nicht in, eher um den Schlaf gebracht. So wälzt sie sich hin- und her und hört die Stimme immer aufs Neue, die diese verletzenden Worte sagten.
Warum musste gerade sie ihr ihre Meinung so direkt ins Gesicht sagen? War sie eifersüchtig? Andere hatten sie zu ihrer Entscheidung beglückwünscht und ihr ermunternd auf die Schulter geklopft.
In den Morgenstunden dämmert es ihr: Was, wenn ihre Freundin von Kindesbeinen an es ehrlich mit ihr meint, weil sie sie besser kennt als all die anderen? Vielleicht war es sogar besonders mutig von ihr, auszusprechen, was sich sonst keiner traute! Aus Sorge? Aus Fürsorge? Schließlich sind sie sich nicht egal! Sie nimmt sich vor, ihre Entscheidung zu überdenken.
2
Worte verletzen. Gerade dann, wenn Menschen, die uns gut kennen und es gut mit uns meinen, sie aussprechen. Sie sind ein Stich ins Herz. Sie dringen durch Mark und Bein. Es tut weh – das kann man nicht schönreden! Sie rauschen nicht in das eine Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus. Worten, die verletzen, ist nicht mit Durchzug zu begegnen, weil sie einfach bleiben. Sie schmerzen besonders dann, wenn sie einen wunden Punkt in uns getroffen haben. Wenn sie auf alte Verletzungen stoßen, die nicht auskuriert sind, tut es besonders weh. Oft ist es nicht die Zeit, die Wunden heilt.
Möglicherweise ist ein sauberer Schnitt der einzige Weg, um überhaupt gesund zu werden? So wie es manchmal ein Skalpell braucht, um eine Wunde aufzuschneiden, damit sie gesäubert und versorgt werden kann.
3
So verstehe ich die folgenden Zeilen aus dem Hebräerbrief, auch wenn der Verfasser statt eines medizinischen ein militärisches Bild gebraucht:
Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. (Hebräer 4,12-13)
4
Der Verfasser des Hebräerbriefs hat Sorge; Sorge um die Beziehung seiner Adressaten zu Gott. Sie scheinen Gott in ihrem Alltag und bei Entscheidungen aus den Augen zu verlieren. Deshalb formuliert der Autor eine Ermahnung, wie er es selber nennt. In vielen wohlformulierten Worten entfaltet er das christliche Glaubensbekenntnis, damit sie daran festhalten. Durch ihre Überzeugungskraft sollen sie Orientierung bekommen, damit sie das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dabei wird Jesus als verständnisvoller Fürsprecher den Verzweifelten vor Augen gemalt.
Wenn eine Verletzung wirklich behoben und ein Mensch auf dem Weg der Heilung ist, kann er innerlich richtig zur Ruhe kommen.
Die Medikamente und das Verbandsmaterial können entsorgt werden und werden nicht mehr gebraucht, was für eine Befreiung.
5
In wenigen Tagen beginnt die Passionszeit, vielleicht begegnet mir in dieser Zeit auch ein Wort, das mich trifft, vielleicht sogar verletzt. Ich nehme mir vor: Wenn das so ist, dann will ich genau hinspüren: Warum ist gerade dieser Satz so verletzend? Trifft er mich an einem wunden Punkt?
Ich will hinspüren, denn ich weiß, wer das „Skalpell führt“, nämlich der, der mir in der Taufe seine Fürsorge und Begleitung zugesagt hat – oder wie Martin Luther es einmal beschreibt: „Nun wird hier in der Taufe jedermann ein solcher Schatz umsonst vor die Tür gebracht und eine Arznei, die den Tod verschlingt und alle Menschen beim Leben erhält!“
Der große Raum der Liebe
1
Vor uns auf dem Bild sehen wir das Traumpaar des Lebens, sozusagen. Links Charlie Brown, der Grüblerische, manchmal Schwermütige, viel Fragende und Suchende. Rechts Lucy, die Energische, Zupackende, nie um eine Antwort Verlegene. In vier kleinen Bildern hat hier der Zeichner Charles M. Schultz (1922-2000) dargelegt, was die beiden Figuren auszeichnet und worin der Grund ihres Lebens liegt: Charlie grübelt und fragt; Lucy weiß Bescheid. Sie weiß mit Humor Bescheid. Charlie wird damit nicht geholfen sein – aber Lucy konnte sich kurz und bündig erklären.
Das Schöne ist, bei den Peanuts werden oft unsere Fragen in ganz kleine kurze Zeichnung gepackt. Den Peanuts ist nichts Menschliches fremd; weder der Zank noch die Versöhnung – und Gott schon gar nicht.
Und das ist eben eine Frage von Menschen, die mit Gott leben wollen: Ist Gott wohl zufrieden mit mir?
2
Die erste von zwei Antworten ist: Ich muss mich darum nicht sorgen. Gott will die Welt „be – frieden“. An Weihnachten betritt Gott die Erde – auf sehr menschliche Weise – und zeigt damit sein Gefallen an Menschen. „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen seines Wohlgefallens“, singen die Engel. Maria und Josef, den Hirten, den Königen, Gott kommt uns Menschen ganz nah und will sie in seinen Frieden nehmen. In diesem Sinne ist er schon „Zu- frieden“ mit uns
So weit die erste Antwort. Es gibt aber auch noch eine zweite, die bei Lucy noch nicht einmal im Hinterkopf zu sein scheint. Dass Gott zufrieden ist mit mir, heißt nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Als Gott die Welt betritt, lässt er uns ja auch wissen: Lebt nun bitte nach meinen Regeln. Die Regeln der Welt sollen nicht mehr gelten; jetzt gelten die Regeln der Liebe.
3
Keiner hat das so schön in einen Satz gefasst wie der Apostel Paulus in der Jahreslosung für 2024. Am Ende seines ersten Briefes an die kleine, christliche Gemeinde in der Weltstadt Korinth schreibt Paulus: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“ (1. Korinther 16,14). Ein Satz wie ein Programm – für mehr als ein Jahr.
Manchmal war Paulus müde der Streitigkeiten in seinen Gemeinde. Sie hatten alle ihre Gründe und auch ihren Sinn. Aber dennoch machten sie müde. Da liegt es nahe, einmal klar zu sagen: Setzt euch ruhig über alles auseinander, ernsthaft, leidenschaftlich – aber alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
4
Daran kann man heute zweifeln, wenn Menschen streiten. Da geht es oft nicht mehr um Richtig oder Falsch, sondern oft nur noch um recht haben und recht behalten. Dieses Rechthabenwollen ist aber Gift für jede Auseinandersetzung. Wenn ich in ein Gespräch oder in einen Streit gehe mit dem Gedanken, recht zu haben, ist das Gespräch sinnlos. Das gilt für Familien, für Vereine und für die Politik. Wer nur recht haben oder bekommen will, braucht kein Gespräch mehr – und so sind ja die Gespräche dann oft. Sie werden laut und führen zu wenig oder nichts.
Mag sein, dass Paulus das so erlebt hat. In den Gemeinde gab es viele Auseinandersetzungen. Und weil Paulus das so beschäftigt und er wahrscheinlich auch darunter leidet, setzt er ein Zeichen und sagt: Wenn ihr schon streitet, dann bitte in Liebe.
5
Ob Lucy das versteht? Oder geht es ihr nur darum, das letzte Wort zu behalten? Das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass ihre Antwort auf dem Bild etwas zu wenig ist auf die Frage, ob Gott zufrieden ist mit mir: WAS BLEIBT IHM ANDERES ÜBRIG?! Ich vermute, dass Gott nicht ganz so geduldig ist, wie Lucy sich das wünscht. Und er auch im neuen Jahr immer wieder mal kleine Zeichen setzen wird, dass es nicht um Rechthaben, sondern um Liebe gehen soll. Ein Zeichen könnte die Trauer nach einem missratenen Gespräch sein. Und dann die Erinnerung: Lass es uns noch einmal versuchen – mit Liebe und Achtung voreinander.
Liebe ist kein Allheilmittel. Das wissen wir. Aber ebenso sollten wir wissen, dass unser Leben nur „zu-frieden-stellend“ empfunden wird, wenn es in Achtung und Liebe gelebt wird - vor allem in den Streitigkeiten, die kommen werden. Wenn wir spüren, nicht weiterzukommen, wird es am besten sein, tief Luft zu holen; ruhig auch ein paar Tage lang. Und sich dabei selber zu fragen: Denke und handle ich noch im großen Raum der Liebe und der Achtung?
Dann wird wieder, denke ich, ein Zeichen Gottes kommen, das mir zeigt, welchen Weg ich gehen könnte. Wer ernsthaft nach Liebe fragt, bekommt von Gott Antwort.
Das Weltgericht

Gedanken zu Gnade und frommen Werken
1
Zur Geschichte des Christentums gehört die Vorstellung, dass Christus am Ende der Zeiten kommen wird, die Lebenden und die Toten zu richten. So bekennen wir es jeden Sonntag, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen: „Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.“
Viele Jahrhunderte hindurch hat man sich das so vorgestellt, wie es auf dem Bild zu sehen ist:
Christus sitzt, umgeben von den himmlischen Heerscharen, auf einem Thron. Er hält die Hände mit den Kreuzigungsmalen erhoben. Engel stehen neben ihm und stellen seine Marterwerkzeuge zur Schau. So wird signalisiert: Hier haben wir es mit dem Auferstandenen und dem in den Himmel aufgefahrenen Christus zu tun. Tod und Leid liegen hinter ihm. Jetzt ist er der Herrscher der Welt. Die Füße hat Jesus auf der Silhouette einer Stadt abgelegt, vielleicht das irdische Jerusalem. Zeichen dafür, dass die Welt und die Erde ihm zu Füßen liegen. Der himmlische Bereich ist vom irdischen Bereich durch eine Art Firmament getrennt.
Im unteren Bereich des Bildes ist zu sehen, wie die Gräber sich öffnen und die Toten aus allen gesellschaftlichen Schichten herauskommen.
Grabplatten werden von den Auferstehenden zur Seitegerückt. Alles das passiert zum Klang der Posaunen, die die Engel links und rechts spielen.
2
Zwischen dem thronenden Christus und den aus den Gräbern sich erhebenden Menschen ist die wichtigste Szene zu sehen: In der Mitte steht ein Engel, der eine Waage hält. Auf der Waage werden die aus den Gräbern steigenden Menschen gewogen. Wer zu leicht befunden wird, fällt in die Klauen des Teufels und wird gefesselt abgeführt in die Hölle, wo Heulen und Zähneklappern warten werden. Wer dagegen schwer wiegt, der darf den Blick in den Himmel richten und auf ein neues Leben im Kreis der Engel und zur Rechten Jesu hoffen.
„Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken.“ So beschreibt der Evangelist Matthäus (25,31) die Szene.
3
Aber was wird da eigentlich gewogen? Wenn man genau hinsieht, kann man in der schwerer wiegenden Waagschale eine Person erkennen, die ihre Hände gefaltet hat.
Schwerer wiegt also das fromme, das gottgefällige Leben. Wer dagegen leichtfüßig daherkommt, kann nur mit Höllenqualen rechnen.
Der zum Weltgericht erscheinende Christus hat den Gläubigen viele Jahrhunderte Angst gemacht. Die Vorstellung, dass da womöglich eine Hölle sein könnte, in der die gescheiterten Seelen für ewig Qualen leiden müssen, setzte die Menschen unter Druck. Sie spürten, dass sie nicht immer so leben konnten, wie es eigentlich geboten war und waren bereit, für ihr Seelenheil zu zahlen. Die Idee der Ablassbriefe spülte viel Geld in die Kirchenkassen. Und damit die Gläubigen stets an das Weltgericht erinnert wurden, brachte man Szenen wie diese über den Hauptportalen der großen Kirchen an.
4
Mit der Reformation veränderte sich dann der Glaube: Martin Luther war davon überzeugt, dass Christus den Menschen nicht als Richter, sondern am Ende aller Zeiten mit Gnade begegnen wird. Denn Luther war sich sicher: Wer getauft ist, kann sich der Gnade Gottes gewiss sein und braucht sich nicht darum zu mühen, fromme Werke zu tun. Sie werden von selbst geschehen. Und das, was dann eben doch in jedem Menschenleben misslingt, wird durch die Gnade gerechtfertigt.
Ein Schimmer des Reiches Gottes

1
Ganz und gar nicht adventlich ist das Bild, das sie auf dem Covere sehen. Zu sehen ist die Hausfassade eines Hochhauses. Die Fenster sind zerstört. Rollläden hängen schief herab. Auf dem Boden, vor dem Haus, Berge von Schutt und Asche. Ein trostloses Bild der Zerstörung. Ich habe dieses Bild mitgebracht, weil es mich an einen kleinen Fernsehfilm erinnert, der zunächst auch von Zerstörung erzählt. Dieser Film, muss ich sagen, hat mich beeindruckt und berührt. Davon will ich heute erzählen. Dabei muss ich allerdings etwas ausholen.
2
Seit einigen Jahren produzieren die großen Nahrungsmittelkonzerne und Supermarktketten in der Vorweihnachtszeit kleine Fernsehfilme. Es ist – natürlich - eine Idee, die aus Amerika zu uns nach Europa gekommen ist. Ich muss sagen, dass ich erst jetzt auf diese Kurzfilme aufmerksam geworden bin. Normalerweise tragen diese Filme eine Werbebotschaft. Sie malen ein Bild von Weihnachten, wie es uns inzwischen sehr vertraut ist: das Fest der Familie in Harmonie und mit Genuss. Und mit Kommerz. Dieser Film jedoch ist ganz anders. Gezeichnet in düsteren Bildern, fast nur in Schwarz-Weiß, erzählt der kleine Film zunächst vom Gegenteil
3
Eine Frau kommt nach Hause, in einen großen Häuserblock. Sie fährt mit ihrem Auto in die Tiefgarage. Im Radio hört man leise Klänge von Stille Nacht. Da fährt ihr plötzlich ein Junge auf einem Rad vor das Auto und sofort entsteht Streit. Ihre Brille bekommt einen Riss. Dieser Riss geht wie durch sie selbst hindurch. Der Junge und die Frau gehen auf unterschiedlichen Wegen durch das Haus nach oben.
Die Risse, die unsere Gesellschaft durchziehen, die allgegenwärtigen Krisen und Probleme kommen in kleinen Momentaufnahmen zum Ausdruck: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Krieg in Israel und Gaza, Klimawandel. Und mit jedem Stockwerk höher werden die Risse im ganzen Haus sichtbarer und spürbarer. Wände reißen auf, Türen brechen durch, Fenster splittern.
4
Schließlich erreicht die Frau ihre eigene Wohnung. Eine Tür gibt es schon nicht mehr, die ganze Wohnung steht Kopf. Müde und verzweifelt lässt sie sich in ihren Sessel fallen. Sie weint. Auch der Junge kommt oben an. Hört vor seiner eigenen Wohnungstür, wie sich die Eltern streiten. Blickt den Flur entlang, sieht die Frau in ihrem Sessel sitzen. Zögernd wendet er sich ihrer Wohnung zu, tritt langsam ein, schaut sie an. Und fragt dann: „Können wir reden?“ Sie schaut ihn ebenfalls an, ihr Blick wird weich – und der Riss in der Brille wird wieder heil. Sie lächelt, er nimmt sich einen Stuhl, setzt sich zu ihr.
Mit einer Botschaft endet dieser Film: Wir alle, heißt es am Schluss, können etwas gegen die Risse in unserer Gesellschaft tun. Wir können aufeinander zugehen.
5
Mich hat er berührt, der kleine Film. Ich erkenne in ihm einen Schimmer des Reiches Gottes: Menschen, die es bei allem Trennenden schaffen, aufeinander zuzugehen, zu reden, zu verzeihen:
Saget den verzagten Herzen: „Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott“. So heißt es beim Propheten Jesaja (35,4a). Und ich wünsche uns allen, dass wir solche Lichtblicke und Schimmer des Reiches Gottes, ja dass wir Gott selbst, immer wieder entdecken – hinter den Fassaden.
Vom Haltezeichen zum Wegweiser

Gedanken über die Nächstenliebe
1
Wie bringt man Menschen dazu, in der Not zusammenzustehen? Diese Frage hatten die Verantwortlichen in der Stadt Akureyri im Norden Islands, als im Jahr 2008 der Zusammenbruch der drei wichtigsten Banken des Landes eine große Finanzkrise auslöste. Das war eine Folge der Lehman-Brothers-Pleite in den USA. Die Zahlungsfähigkeit Islands war bedroht. Es gab viele Entlassungen, die Arbeitslosigkeit verdreifachte sich, Löhne wurden gekürzt und etliche Isländer verarmten. Die Sorgen waren groß in dem kleinen Land. Wie sollte es weitergehen?
2
Viele wirtschaftliche und politische Maßnahmen waren nötig, um die Finanzen des Landes wieder auf ein stabiles Fundament zu bringen. Und dazu mussten die Menschen gestärkt und ihnen die Sorgen genommen werden. Das, was als Idee auftauchte, um die Stimmung zu verbessern, überrascht bis heute. Wer nach Akureyri kommt, dem werden die roten Lichter an den Ampeln auffallen, die allesamt als Herzen gestaltet sind. Hier im Ruhrgebiet kennen wir ja die „Kumpelampelmänn-chen“ mit der Grubenlampe in der Hand. Die Intention geht in eine ähnliche Richtung.
Fußgänger wie Autofahrer sind überrascht und fragen sich, was wohl dahinterstecken mag. Die Antwort lautet: Auf diese Weise sollte dazu aufgerufen werden, dass die Menschen einander beistehen, dass sie ein Herz für den und die andere zeigen. Bis heute ist Akureyri als „die Stadt mit Herz“ bekannt und wirbt damit um Besucher.
Ich finde, das ist ein ganz wunderbares Bild: Da, wo Rot sonst eine Warnfarbe ist und „Stop“ gebietet, wird Rot jetzt zur Farbe der Nächstenliebe und weist auf diejenigen hin, die nicht genug zum Leben haben. Jeder Ampelstop erinnert an den Nächsten und dass man in der Not zusammenrücken muss. Wunderbar, oder?
3
Ich wünsche mir diese Herzampel auch woanders. In Deutschland. Eigentlich in allen Straßen und Ländern der Welt. Weil sie für mich so eine starke Botschaft bringt: Da, wo man anhalten muss, wo es nicht weitergeht, wird daran erinnert, dass man füreinander da sein soll. Aus dem Haltzeichen wird ein Wegweiser – hin zum Nächsten. Das begeistert mich. Was ist das für ein Zeichen der Hoffnung, wenn ich auf diese Weise an andere denke und andere an mich! Natürlich muss diese Liebe dann auch eine aktive Umsetzung finden als Zeichen des Füreinander und Miteinander.
4
Und dazu gehören auch Überlegungen wie: Was braucht unsere Gesellschaft heute? Was kann ich dazu beitragen? In einer Zeit, in der die Inflation besonders die Ärmeren im Land in eine schwierige Situation bringt, ist es nötig, sich für die gegenseitige Unterstützung einzusetzen. Der Zusammenhalt wird ja nicht durch gute Worte, sondern durch tatkräftige Hilfe gefördert. Als Christ oder Christin hat dieses Zeichen der Liebe und der Hoffnung immer mit Gott zu tun: „Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm“, so heißt es im 1. Johannesbrief (4,16b). Die Verbindung Gottes zur Liebe kann man nicht auflösen. Sie trägt uns auch in den unsicheren, schlechten Zeiten.
Ich wünsche mir diese Zeichen der Liebe auch hier bei uns, um mitten im Alltag daran erinnert zu werden: Ich bin mit dem, was mich bewegt, nicht allein, sondern Gott ist mit seiner Liebe immer bei mir. Er weist mich auf meinen Nächsten hin. Jede rote Ampel könnte eine Erinnerung daran sein – vielleicht auch ohne das wunderschön leuchtende Herz. Für diesen Gedanken halte ich dann doch gerne an einer roten Ampel.
Durchblick

Gedanken zu Psalm 24,1+2
1
Es schien, als hätte die Straße ein Ende. Eine Sackgasse. Ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich den Weg bergauf gelaufen bin. Eine Mauer, von der Putz abbröckelt. Ein Handlauf aus Metall, der schon bessere Tage gesehen hat. Ausgetretene Stufen auf dem Weg nach oben. Wo wollte ich eigentlich hin? So ganz genau weiß ich es auch nicht. Ich bin einfach dem Weg gefolgt.
Und dann: ein Durchblick. Es wird hell und weit hinter dem geöffneten Tor. Der Himmel wölbt sich über dem Berg. Auf dem Tor das Kreuz mit der Erdkugel. „Die Erde ist des HERRN, der Erdkreis und die darauf wohnen“ (Psalm 24,1.2). Die ganze Welt gehört Gott, das Meer und die Wolken und die Berge.
Hinter dem Tor blühende Blumen. Rot – die Farbe der Liebe. Wie die Kerzen auf dem Adventskranz. Grün – die Hoffnung, wie das Tannengrün. Weiß – die Freude, die Ewigkeit, die Farbe der Christusfeste. Noch versteckt, dort, hinter dem geöffneten Gittertor, aber alles ist da, hinter der „Pforte zur Unsterblichkeit“.
2
Wer geht hier hindurch? Für einen ganzen Tross mit großem Gefolge, gar eine Kutsche, ist der Durchgang zu schmal. Ein Esel würde wohl gehen – das Reittier der einfachen Leute. Vollkommen geöffnet ist das Tor allerdings nicht. Gibt es einen Vorbehalt? Eine Einlasskontrolle? Oder wird niemand erwartet?
Überhaupt: Menschen sind auf dem Bild nicht zu sehen. Keine Menschen, die den Weg säumen, weil ein wichtiger Gast durch das Tor schreitet. Keine Menschen, die mich willkommen heißen und sich freuen, dass ich mich auf den Weg gemacht und den Aufstieg bewältigt habe. Keine Menschen, die selbst den Aufstieg gewagt haben und nun den Durchblick genießen. Niemand, der einen Blick auf das Bergpanorama und die Weite erhaschen will, der überwältigt ist davon, dass die Welt zu Gott gehört.
Geht es hier um mich? Werde ich erwartet – und wenn ja, von wem? Soll ich hindurchgehen durch das Tor, und was erwartet mich dort?
3
Bei genauerem Hinsehen bemerke ich, dass es Grabsteine sind. Ein Friedhof, ein Gottesacker hinter der Pforte zur Unsterblichkeit. Sie sind angekommen, die dort liegen. Für sie ist die Reise zu Ende, zumindest ihre irdische Reise. Auch für sie gilt: „die Erde ist des HERRN“. Die Erde, in der sie liegen, gehört Gott. Ihr Leben gehört Gott und auch ihr Sterben. Sie ruhen in Gottes Hand.
4
Was wäre, wenn auch Gott dort wäre – hinter dem geöffneten Tor, an dem Ort mit Weite und Durchblick? Wenn Gott schon längst dort warten würde, nachdem ich angekommen bin, um mich mit geöffneten Armen in Empfang zu nehmen? Ich werde diesen Ort wieder verlassen. Ich bin nur zu Besuch. Aber irgendwann werde ich bleiben. Vielleicht nicht hier, aber an einem ähnlichen Ort wie diesem. Dann wird er auf mich warten, mit geöffneten Armen. Er wird schon da sein. Kein Tor ist ihm zu schmal, er wird hindurchpassen, denn er kommt nicht mit großem Tross. Er wird da sein, an jedem Ort, zu dem ich aufbreche. Da erschließt sich mir Weite und Frieden. „Die Erde ist des HERRN …“
Neue gegen alte Welt

1
Hier prallen zwei Welten aufeinander. Vorne sehen wir rostige Trübsal, eigentlich schon Elend. Drum herum aber leuchtet es hell. Da ist ein bilderbuchschönes Haus und Namen, die von viel Geld zeugen: Chanel und Cartier; ein französischer Modekonzern und ein Schweizer Schmuckunternehmen. Diesen großen Namen hat man ein ausgeschlachtetes, rostiges Auto vor die Tür gestellt. Kaum auszudenken, wie das geschehen konnte. Vermutlich eine Nacht- und Nebelaktion von ein paar Verwegenen; vielleicht als Protest.
Rost gegen Reichtum. In einer teuren Einkaufsstraße.
2
In der Bibel gubt es immer wieder dieses Bild von der alten und der neuen Welt, die sich konträr gegenüberstehen. Der Prophet Daniel, der wohl zu den letzten der vielen Propheten des Alten Testaments gehört ist einer der ersten: Er hält eine neue Welt gegen die alte, gegen unsere Welt. Daniel könnte, wie viele meinen, in den Jahren 170 bis 160 vor Jesus gelebt und gewirkt haben. Sein wichtigster Auftrag war es, eine Endzeit anzukündigen und gerechten Juden eine Auferstehung zu verheißen.
3
Daniel beschriebt die alte Welt, in der wir leben als Welt der Trübsal, die sich noch verschlimmern wird. Aber er setzt ein großes „Aber“ dagegen. Denn in der anderen Zeit werden Entschlafene erweckt werden, und die Verständigen, also die, die fest auf Gott vertrauen, werden leuchten wie Sterne. Ein wunderbares Bild. Wie des Himmels Glanz werden die sein, die Gottes Gerechtigkeit nicht nur im Munde führten, sondern auch lebten.
Mit seiner Erwartung einer Auferstehung der Entschlafenen gehört der Prophet Daniel zu den ersten in der Heiligen Schrift, die klar benennen, was für Jesus und Paulus dann ganz selbstverständlich ist. Die Auferweckung Jesu ist der Anfang der Auferweckung aller.
4
Bei Daniel, Jesus und Paulus geht es nicht um Termine und Tatsachen, sondern um Hoffnung und Gottes Größe. Keiner weiß, wann diese Endzeit kommt und die neue Welt beginnt. Keiner weiß, wie sich das alles ereignen wird. Man darf also sagen: Daniel, Jesus und Paulus schmücken ihre Hoffnung aus. Das ist auch berechtigt. Man darf Hoffnung mit Gedanken und Fantasien ausstatten. Vorausgesetzt, man glaubt nicht an den Schmuck und die Fantasien. Wir wissen nicht, ob die alte Welt zusammenbricht oder leise zu Ende geht. Wir wissen auch nicht, ob sich die neue Welt Gottes mit Posaunen ankündigt oder vielleicht ganz unscheinbar zu uns kommt. Nichts davon wissen wir. Wir können allerlei fantasieren, dürfen daran aber nicht glauben.
Woran wir glauben dürfen, ist die Größe Gottes. Er ist nicht an die alte Welt gebunden, ist größer als sie. Und wir dürfen darauf hoffen, dass er uns hineinnimmt in seine neue Welt, wie es Johannes in seiner Offenbarung schreibt (21,3-4): Gott wird bei ihnen wohnen; und er selbst wird ihr Gott sein … und der Tod wird nicht mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Johannes ist vorsichtiger mit dem Ausschmücken seiner Hoffnung. Er sagt nur: Das Erste, also unsere Welt, vergeht. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben.
5
Darauf dürfen wir hoffen, daran dürfen wir festhalten. Gott ist größer als seine Schöpfung. Gott ist größer als die Geschichte der Menschheit. Und Gott ist größer als der Tod. Der Tod ist nur Gottes Knecht. Das wissen wir seit jenem Ostermorgen, als die aller Hoffnung beraubten Jünger, Frauen und Männer, mit einer vollkommen neuen Hoffnung wieder die Welt betraten, aus der sie sich ängstlich zurückgezogen hatten. Er lebt, haben sie einander zugerufen und sich mit ihrer Hoffnung angesteckt. Und wir werden mit ihm leben, auch wenn wir sterben.
6
Der Totensonntag ist ein Tag der Trauer, einerseits. Es ist schlimm, Menschen zu verlieren, die unser Leben begleitet haben. Der Totensonntag ist aber zugleich auch ein Tag der Hoffnung. Die Toten sind tot, aber sie sind nicht weg.
Sie sind bei Gott aufgehoben. Dort, im weiten Raum Gottes, bleiben sie uns erhalten. Dort werden wir alle einmal sein. Wie Gott unser Leben dann bewerten wird, wissen wir nicht. Aber eins wissen wir genau: Die Liebe bleibt. Für immer. Sowohl die Liebe der Verstorbenen zu uns als auch unsere Liebe zu ihnen. Sie wird die Gräber überstehen und ist bei Gott aufgehoben.
In den Gräbern liegt das Leben, nicht die Liebe.
Gottes großes Verzeihen

1
Hier gibt es nichts schönzureden. Der Christus ist rot vor Blut. Und auch sonst ist unser Blick eingefangen von Rotem, als solle allen Betrachterinnen und Betrachtern klar sein, dass es bei der Kreuzigung nicht um etwas Sanftes geht. Auch die eine Waffe sieht man deutlich, mit der geprüft wird, ob Christus schon tot ist. Der Stich in die Seite als letzte Brutalität. Die Kreuzigung war damals etwas Alltägliches – aus heutiger Sicht war sie grausam. Hier stirbt ein Mensch.
Und von dem Menschen heißt es später, er habe alle unsere Sünden getragen.
2
Der Maler Lovis Corinth war schon zu Lebzeiten berühmt. Viele Ausstellungen zeugen davon. Ebenso der Verkauf seiner Bilder, der ihm ein großzügiges Leben ermöglichte. Begonnen hat er als Maler des Impressionismus. Er malte Natur, Landschaften und alles, was als Impression galt, also als eine Art Augenblicksaufnahme von Schönem, das der Seele guttut.
Aber dann kam der Erste Weltkrieg (1914–1918); und es floss viel Blut. Nicht direkt in unserem Land wie im Zweiten Weltkrieg, aber doch für alle sichtbar und hörbar in Belgien und Frankreich. Corinth war von Anfang an Befürworter des Krieges und erschüttert, als Deutschland kapitulierte und das Kaiserreich unterging.
Diese Schmach veränderte seine Malerei; bei vielen anderen auch. Schöne Landschaftsbilder, Impressionen aus der Natur – diese Lieblichkeiten waren vorbei. Es kam zum Expressionismus, zu Übertreibungen und Farbexplosionen.
Wie hier, auf dem Kreuzigungsbild. Da kann man sich nichts mehr schönreden. Wenn Christus alle unsere Sünden trägt, dann geht das nicht ohne Blut.
3
Wie dürfen wir das verstehen, dass Christus alle unsere Sünden getragen hat bis ans Kreuz (Philipper 2,8)? Wir dürfen das als Gottes großes Verzeihen verstehen. Wir dürfen das so verstehen, dass Gott nicht auf unsere Schuld Strafen folgen lässt. Gott ist kein Strafautomat, der jeden Fehler und jede Schuld gleichsam automatisch rächt. Das wäre Gottes nicht würdig und presste ihn in eine Form, die ihn klein macht. Gott ist kein Strafautomat, sondern ein Gott der Freiheit.
Unsere Schuld ist abgetragen. Der Tod Jesu wird zu unserer Freiheit. Wir werden auch schuldig mit unserer Freiheit, aber wir müssen die Strafe nicht fürchten. Wir können uns, um Christi willen, Gott zuwenden und ihn um Vergebung bitten. Gott wird sich unseren Bitten nicht verschließen. Er wird sich unser erbarmen.
4
Dass wir das wissen dürfen, jeden Tag wieder wissen dürfen, macht uns das Leben leichter. Wir müssen nicht perfekt sein, nicht fehlerlos sein. Wir dürfen unsere Macken haben, auch seltsame. Und wir dürfen uns vor allem eingestehen, dass wir schuldig werden an anderen – nicht selten sogar mit schwerer Schuld.
Über alles das dürfen wir in Ruhe nachdenken. Niemand von uns ist verpflichtet, dauernd auf andere zu zeigen, um sich selber eine weiße Weste herbeizureden. Glaube an Gott und Leben mit Gott heißt: wir erfahren Vergebung. Wir leben nicht in einer Welt, in der Gott Fehler und Schuld rächt. Er vergibt. Unter einer Bedingung, die gar keine ist. Sie ist geradezu selbstverständlich.
5
Wir sollen nämlich über uns nachdenken. Wir sollen nicht gedankenlos leben oder irgendwie drauflos leben. Wir sollen und dürfen uns selber genau ansehen, ohne uns schönzureden. Da ist ein großes Glück. Wir dürfen uns in unser Herz schauen und erkennen, wie wir leben. Denn wir werden nicht bestraft. Unser Gott ist ein befreiender Gott. Der Tod Jesu wird zu unserer Freiheit.
Wir brauchen dieses Innehalten. Um wieder unsere Freiheit zu erkennen. Wir dürfen uns ansehen; wir dürfen uns erkennen als fehlerhafte und schuldige Menschen – denn wir erfahren dann, dass und wie Gott uns befreit. Um seines Sohnes willen verzeiht er uns und bittet uns: Ändert euren Sinn.
Das nennt man Buße - Umkehr zu Gott. Man sieht sich, man erkennt sich und bittet dann:
Mach mich dir recht, Gott.
Hilf mir, dass ich lebe im Licht deiner Gebote.
Und hilf mir lieben.
Um deines Sohnes willen.
Meister des Gottvertrauens

1
Ein Mensch fühlt einen Auftrag, erzählt das Bild. Und kommt diesem Auftrag nach. Er schreibt ein Schild, auf dem steht in Großbuchstaben: HUPEN SIE, WENN SIE JESUS LIEBEN. Offenbar gehört der Mann zu denen, die Jesus lieben – und erhofft sich das auch von anderen. Darum stellt er sich mit seinem Schild auf eine viel befahrene Kreuzung und erwartet das Hupen. Er bekommt es. Fast alle Autos in seiner Nähe hupen, einige Fahrer schauen auch aus den Fenstern ihrer Autos.
Allerdings, so müssen wir befürchten, hupen die Fahrerinnen und Fahrer nicht, weil sie Jesus lieben. Sie hupen, weil der Mann mit dem Schild den Verkehr aufhält.
Aber, immerhin: der Mann hat bekommen, was er wollte. Sein Auftrag ist erfüllt. Ist das nun alles ein Witz? Oder eine Tragödie? Oder beides zugleich?
2
Was mögen die Menschen damals über Jesus gedacht haben? Es gab einige, die ihn liebten, womöglich auch Frauen. Vielen anderen war er gleichgültig. Noch ein Wanderprediger mehr. Und dann gab es die, die ihn aus dem Weg haben wollten, aus religiösen Gründen. Einen eher ärmlichen Menschen als „Sohn Gottes“ empfanden sie als anmaßend, eine Gotteslästerung. Sie hielten ihre Gründe für ehrbar, Jesus hinrichten zu lassen mit tatkräftiger Hilfe der römischen Staatsmacht, die sich anschließend die Hände in Unschuld gewaschen hat. Als ihnen beim Sterben Jesu dämmerte, was sie da womöglich angerichtet hatten, wollte es niemand mehr gewesen sein.
Und wo waren die, die Jesus liebten? Verschwunden. Aber dann, Gott sei Dank, bald wieder da. Schon kurze Zeit später setzten sich einige hin und schrieben auf, was Jesus gesagt und getan hatte.
3
Da war zum Beispiel diese Rede am Berg. Die hatten sie nicht vergessen. Vermutlich wegen der ersten Sätze (Matth 5,1-10). Hat man die einmal gehört, vergisst man sie nie mehr. Wohl wegen der jeweils ersten zwei Worte der acht Sätze, die mit „Selig sind“ beginnen. Seligkeit ist vollkommenes, durch nichts getrübtes Glück – beginnend auf Erden, vollendet im Himmel. Das hört man gerne, wenn man Leid trägt oder Frieden stiftet.
Auch Sanftmütige und Gerechtigkeit Suchende spitzten die Ohren und ahnten: ich bin gemeint.
Und so vieles andere noch, was in der Bergpredigt steht: die Hoffnung auf das Reich Gottes mitten im Leben; der Blick zum Himmel, wo Vögel sorglos ihre Kreise ziehen, oder der Blick auf Lilien, die, vom Schöpfer gestreichelt, in Schönheit vor sich hin wachsen. Das muss man aufschreiben, dachten einige, das muss die Nachwelt wissen.
4
Bis heute müssen wir das wissen. Die Bergpredigt und vor allem die Seligpreisungen sind nicht nur Teil der Weltgeschichte, sie sind ein Meisterstück des Gottvertrauens – erfühlt, gedacht und gesprochen vom Meister des Gottvertrauens. Das ist das eigentliche Kennzeichen des Sohnes Gottes: sein sehendes Gottvertrauen. Jesus vertraut nicht blind, sondern sehend. Gott, sein und unser Vater, meint es gut mit uns – auch wenn wir das nicht immer erkennen. Dass Gott es gut mit uns meint, davon ist Jesus vollkommen überzeugt. Niemals würde Gott, denkt Jesus, uns etwas anbieten oder zukommen lassen, was uns schadet (vgl. Lukas 11,11-13).
Als Jesus seine Worte am Berg spricht, haben vielleicht hundert Menschen zugehört. Seitdem aber haben sie viele Millionen gehört und gelesen. Der Meister des Gottvertrauens – vor allem wegen dieser Worte wird er geliebt. Auch wenn man nicht unbedingt hupen muss, wenn man Jesus liebt.
5
Wir können Jesus auch leise lieben. Indem wir uns seine Worte zu Herzen nehmen. Das tun wir, wenn wir Menschen achten. Die Traurigen; die Armen und Verfolgten; die von der Welt Vergessenen; die Kranken und die, die sie pflegen; vielleicht sogar die Verbitterten. Ihnen lassen wir ein wenig Leichtigkeit zukommen, auch mal Heiterkeit. Wir streuen das wie Samen in ihr Herz und bitten Gott, er möge aus dem Samen Blumen wachsen lassen, die alle ihre Sinne ermuntern.
Jesus lieben heißt Gott vertrauen. Er will Gutes. Manchmal erkennt man das erst spät. Auch Jesus erkannte es längere Zeit nicht. Aber dann doch. Und sagt voller Gottvertrauen: Alle Liebe wird euch im Himmel reichlich belohnt werden.
Was gut ist

1
Wir brauchen Regeln, Ordnungen, Normen, ja auch Vorschriften für ein geordnetes Leben und Miteinander. So haben zum Beispiel die Mönchsregeln das Zusammenleben der Mönche in den Klöstern geordnet. Die Ordensregeln verhalfen zu einem vermeintlich christlichen Leben. So müsste die Welt doch zumindest in den Klöstern funktionieren. Ein Leben in Hingabe und mit Lobpreis, ein Leben in Gemeinschaft, Demut und für andere. Doch auch die besten Regeln brechen sich mal an der Realität des Lebens. Nicht, weil unbedingt die Regeln schlecht sind, sondern weil das Herz des Menschen anders tickt. Mal schlägt es über die Stränge und übertritt die guten Regeln. Mal ist es barmherziger als die Regelauslegung und gibt nach.
„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.“ So fasst der Prophet Micha (6,8) im Wochenspruch zusammen, was zum Leben dient: Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor seinem Gott oder, wie es in der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache heißt, „besonnen mitgehen mit deinem Gott“.
2
Gekleidet mit seiner Mönchskutte zeigt der Mönch seine Ordenszugehörigkeit. Er untersteht dem Orden und seinen Regeln, denen er sich fügen will und muss. Der Mönch auf dem Bild trägt das Christuskind auf seinem Arm. Sanft streicht ihm Christus mit seiner Hand übers Ohr, ins Ohr – als ob er ihm mit seiner Hand und seinen Blicken etwas hineinflüstern möchte. Es braucht keine Worte, sondern nur Berührung. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist …
In einem Brief an seine Ordensbrüder rät Franz von Assisi (1181–1226) in der Kontemplation: „Neigt das Ohr eures Herzens und gehorcht der Stimme des Sohnes Gottes.“ Hier ist das anschaulich geworden. Schauen Sie sich das Gesicht des Mönchs genau an. Sein Kopf neigt sich zu der kleinen Hand Christi. Seine Augen blicken, als ob sie sich an einem fixen Ort festhalten, ohne wirklich zu sehen. So schaut man, wenn man gedanklich weit weg ist oder wenn man nach innen schaut. Konzentriert auf das, was ihn berührt. Es ist, als ob er „ganz Ohr“ würde. Der eine Mundwinkel ist leicht hochgezogen. Und mit seiner rechten Gesichtshälfte beginnt er zu lächeln. Berührt - berührend!
In seinem seiner Mönchskutte hält der Mönch Gottes menschgewordenes Wort in seinen Armen. Er lässt sich von dessen Liebe berühren. Das richtet ihn neu aus, lenkt seinen inneren Blick auf sein berührtes Hören und zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht. Es lässt ihn mutig werden, sanft- und demütig.
3
Wir brauchen Regeln, Gesetze, Ordnungen, Gebote und Verbote, doch vor allem brauchen wir dieses Kind, das sich in unsere Arme begibt und unser Ohr berührt, damit wir in dem Lärm der Zeit und in dem Raum der vielen Gebote uns neu von ihm berühren lassen. Und berühren heißt auch: auf sein Wort hören und Liebe üben und vor Gott demütig bleiben. Denn das ist gut und das ist es, was Gott von uns fordert und uns so ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
In den Himmel gedreht

1
Ich bin ein Sorgenmensch. Ich mache mir Sorgen, ob ich an alles gedacht habe. Ich mache mir Sorgen um meine Familie, meine Freunde und als ich noch Tiere hatte auch um die. Ja, eigentlich abwechselnd oder manchmal gleichzeitig um alle, die mir am Herzen liegen. Ich mache mir Sorgen um die Weltlage und das Klima.
Sich Sorgen zu machen gehört wohl zum täglichen Los der Menschen. Gerade die letzten Jahre zeigten, dass wir trotz Vorsorge auf manches nicht vorbereitet sind und auch nicht sein können. Corona machte uns Sorgen – um unsere Existenz, um unsere Gesundheit und um die Gesundheit der Menschen, die wir lieben. Der Ukrainekrieg schürt alte Ängste. Mit Sorgen werden Energieknappheit und Inflation wahrgenommen und viele fragen sich: „Wie sollen wir das stemmen?“
2
Der Künstler Werner Juza hat in der Lecker Kirche einen Teil der Emporenbilder gestaltet. Das Bild zu Matthäus 6,25 und 26 mag ich besonders. Allerdings in all den Sorgen wirkt der Satz aus dem Matthäusevangelium wie eine Provokation: „Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung?“
Ja, das mag gelten für alle, die nicht jeden Cent umdrehen müssen. Ja, das mag gelten für alle, die sich nicht an der Tafel anstellen müssen, damit am Monatsende etwas zu essen auf dem Tisch steht. Mach dir keine Sorgen? Wie soll das gehen? Aber Jesus Christus sagte es ja gerade Menschen, die fast nichts hatten. Ist das vielleicht der Schlüssel zu Gottvertrauen – nichts zu haben, worauf man sonst bauen kann? Ist das der Schlüssel zur Entsorgung unserer Ängste?
3
So richtig glücklich und sorglos sieht der Mann auf dem Emporenbild in dieser Kirche auch nicht aus. Er wirkt ungelenk auf mich.
Seine großen Füße stehen fest auf dem Boden. Seine Hände sind etwas zu groß. Seine Finger schmal und lang. Zwischen Lilien und einem Obstkorb geerdet; Vögel und Schmetterlinge fliegen um ihn herum. Im Grunde ein schlichtes Bild, wäre da nicht der auffällige Kopf – irgendwie verdreht, so als gehöre er gar nicht zum restlichen Körper – irgendwie entrückt? Und ich frage mich: Geht das anatomisch eigentlich?
4
Nein, so richtig sorglos und entspannt sieht der Mann nicht aus. Aber ich erlebe in diesem ungelenken und verdrehten Körper einen Versuch zu lassen, loszulassen. Alles Kümmern, alles Sorgen, so wie es in Vers 6,26 steht: „Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie?“
Ja, sich wie ein Vogel und Schmetterling in Gottes Hand zu geben, erfordert Mut und Beweglichkeit. Doch wie schön muss das sein: Fest geerdet zwischen den Feldern, die Lilien blühen, die Ernte ist eingebracht. Die Hände sind geöffnet, fast entspannt. Und der Blick geht in den Himmel. Vielleicht noch etwas ungelenk. Vielleicht noch nicht so ganz trauend. Vielleicht gegen alles, was einem im Sorgen hält. Aber die Richtung stimmt.
Große Ruhe. In Vollendung.

1
Engel überlegen nie, ob sie Engel sein wollen.
Sie sind es.
2
Ein solcher Engel wie auf dem Bild entspricht wohl unserer angenehmsten Fantasie. Sie hat gelocktes, langes Haar; ein weites Gewand mit goldenem Kreuz; weit geöffnete Schwingen. Zudem, das unterstreicht noch die Heiligkeit des Engels, liest sie in einem Buch. Ihre Finger, etwas gekrümmt, halten das Buch. Große Ruhe. In Vollendung.
Ein Engel liest in der Heiligen Schrift. Oder macht das Lesen der Heiligen Schrift zum Engel?
3
In den ersten Jahren der Kirche ging es weniger ruhig zu unter den Engeln. Sie hatten eine Menge zu tun, wie uns der Evangelist Lukas in seinem zweiten Buch, der Apostelgeschichte erzählt. Die christliche Lehre hatte zu Beginn wenig Freunde, aber viele Feinde. Jede neue Weltanschauung hat mit alten Anschauungen zu kämpfen. Niemand räumt gerne bequeme Plätze für neu Hinzugekommene. Die Apostel, also die ehemaligen Jünger Jesu, stoßen auf viel Widerstand – sowohl bei den politisch verantwortlichen Römern als auch bei Vertretern der jüdischen Religion.
Stein des Anstoßes ist, wie schon zu Lebzeiten Jesu, dessen Gottessohnschaft. Wie kann Gott einen Sohn haben, der Gott gleich ist? Das will nicht in Köpfe und Herzen vieler Juden. Und die Römer stören sich daran, dass es über dem Gott-Kaiser noch einen Gott geben soll. Was man nicht versteht, das kann nicht wahr sein – so denken ja viele. Bis heute.
4
Das bringt die Apostel sogar ins Gefängnis, wenn sie öffentlich lehren. Sollten sie darüber hinaus wirklich noch „Zeichen und Wunder“ getan haben, waren sie besonders gefährlich für die, die anderes glaubten und ihre Stellung im Volk behaupten wollten.
Aber die Verfolger machen ihre Rechnung ohne Gott, ohne den „Engel des Herrn“. Der tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und befreite die Apostel, die Diener Gottes. Eine weitere Verhaftung der Prediger wollte dann niemand mehr riskieren. Also brachte man die Apostel friedlich vor den Hohen Rat und fragte sie, wie sie es wagen könnten, trotz Verbot öffentlich von Gott zu erzählen.
Die Antwort darauf ist dann die wohl größte Stunde des Apostels Petrus. Er steht vor dem Hohepriester und dem Hohen Rat und sagt: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ Welch ein Satz. Große Ruhe. In Vollendung.
5
Vielleicht sind das ja die eigentlichen, wahren Engel. Die, die Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Satz des Petrus ist von einer Schlichtheit und zugleich von einem Mut, dass einem kurz die Luft wegbleiben kann. Wir erinnern uns vielleicht an Widerstandskämpfer im sogenannten Dritten Reich, die vor einem angeblichen Gericht standen – in Wahrheit waren es ja Schauprozesse, bei denen das Urteil vorher schon feststand – und vor den angeblichen Richtern eben dies sagten: Gott ist mir wichtiger als menschliche Befehle. Wie sie das im Angesicht des sicheren Todes sagten. In großer Ruhe. In Vollendung.
6
Und nun schauen wir ein wenig in uns hinein und überlegen, wen in unserem Leben wir einen Engel nennen würden, wer uns wie ein Engel gegenübertrat mit einer kleinen oder großen Hilfe …
Und vielleicht ist es damals ja auch so gewesen, dass ein Mensch uns darum zum Engel wurde, weil der oder die Gott mehr gehorchte als den Menschen – oder Gott mehr gehorchte als sich selber. Engel überlegen nie, ob sie Engel sein wollen. Sie sind es. Auch wir sind es oder können es sein – meist ohne zu überlegen. Nicht immer in großer Ruhe. Aber in Vollendung.
7
Engel sind wir nicht aus uns selbst. Engel sind wir oder sind andere, weil es Gott gibt. Engel sind so etwas wie ein Gottesbeweis. Das ist ein schwieriges Wort – aber hier könnte es ja womöglich einmal stimmen. Wer einem Engel begegnet oder ein Engel ist, dankt Gott.
Engel zeigen, dass Gott uns nicht uns selber überlässt.
Das große Staunen

1
Es gibt Anblicke, die rauben den Atem. Wir stehen stumm und staunend, mit offenem Mund, dem sich dann vielleicht ein „Aah!“ der Sprachlosigkeit entringt. Oder es haut uns so um, dass wir – siehe den Mann mit Hut – auf den Hosenboden fallen und wie benommen dasitzen und es nicht fassen können.
Wer einen solchen Nachthimmel einmal gesehen hat, tief unten auf der Südhalbkugel dieser Erde, wird den Anblick wohl niemals vergessen. Selbst in unseren Breitengraden, wo die Lichtverschmutzung der Erhabenheit dieses Schöpfungsmysteriums Abbruch tut, reicht es hin, dass wir ergriffen werden, im Innersten berührt, wie von einer großen Hand angefasst, die uns vor das Bild hält: Schau doch! Schau doch nur!
2
Nun haben wir heutzutage, im Unterschied zu den Menschen biblischer Zeiten, wenigstens eine gewisse Ahnung vom Weltall – was nicht heißt, dass wir das Wunder auch nur entfernt verstehen würden.
Das Universum ist fast 14 Milliarden Jahre alt. Unser Sonnensystem ein Kind dagegen: „nur“ 4,6 Milliarden Jahre. Im All gibt es mehr Sterne als Sandkörner auf der Erde. Wie gesagt: Zahlen, die wir mit unserem Verstand benennen, aber nicht erfassen können.
Und Entfernungen, die sich ebenso dem Begreifen verweigern: wenn das Licht in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurücklegt (die so genannte Lichtgeschwindigkeit), bräuchte das Licht zur Durchquerung des sichtbaren Universums 13,8 Milliarden Lichtjahre.
Noch nicht genug des Unfassbaren? Es spricht nicht wenig dafür, dass selbst dieses Universum nur ein Sandkörnchen ist an einem breiten Strand von anderen Universen.
3
Vielleicht sind das Zahlen, die nicht nur Staunen und Ehrfurcht in uns bewirken, sondern dazu auch ungeheures Entsetzen. Über die furchtbare Leere dort oben. Über unsere geradezu absurde Nichtigkeit in diesem Ganzen. Es kann einem ja auch theologisch bange werden. Ob wir da den Mund nicht zu voll nehmen?
Sollte, wer oder was immer das Universum geschaffen hat, sich wirklich irgendwann in die Belange dieses – wie soll ich sagen – winzigen, aberwitzig winzigen Kügelchens namens Erde eingemischt haben, um den Bewohnern, die sich Menschen nennen, beizustehen? Da scheint es mir schon angemessen, von solchem Glauben als einem „Wagnis“ oder „Sprung“ zu sprechen. Mutig, sagen die einen. Lächerlich, sagen die anderen. Eine Entscheidung ist es wohl immer. Abraham glaubte der Stimme, die er hörte – und das brachte ihn auf den Weg.
4
Ich erinnere mich an das Gespräch mit einem väterlichen Freund, der sich in der Materie Weltall gut auskennt als Astronom. Der brachte die Frage denn auch gleich auf den Punkt. Er glaube ja, dass das alles nur eine Schöpfung genannt werden könne. Von Nichts käme ja nun mal nichts. Aber ein persönlicher Gott? Der hier auf der Bildfläche erscheint und mit uns redet? Wie Abraham ihn erlebt hat? Die Propheten? Jesus? Der dann sogar Mensch wird? Ich sah die Augenbraue des Freundes nicht abschätzig, aber doch ein wenig skeptisch und belustigt hochgezogen.
Worauf wir uns einigen konnten, war der Ausgangspunkt. Die große Verwunderung, das Staunen, die Ehrfurcht.
Wunder ist das, was man nicht fassen und erklären kann. Für mich ist die Frage, was das größere Wunder ist, die Größe des Weltalls mit seiner schier endlosen Weite, oder dass Gott sich ganz klein gemacht und sich dieser Welt und damit mir ganz nah gezeigt hat.
Dass Gott sich klein gemacht hat, bringt mich auf jeden Fall ihm näher.
„Ich mag dich“

1
Für viele von euch sieht dieses Bild aus wie aus einer anderen Welt. Es war auch tatsächlich eine andere Welt damals. Für die, die es nicht erkennen: Das rote Ding ist ein Telefonhörer. Er gehörte zu einer öffentlichen Telefonzelle. Die waren wichtig in der Zeit, als es noch keine Handys gab. Man konnte damit in den Straßen telefonieren. Damals hatte man sein Telefon ja nur zuhause, als „Festnetz“ – unterwegs war nichts mit Telefonieren. Außer man fand eine Telefonzelle. Von denen gab es viele. Die meisten waren gelb und wirklich an allen Seiten geschlossen. Die Zelle auf dem Bild ist auf einer Seite offen. Man warf Geld ein und konnte telefonieren. Oder man hatte eine Geldkarte. Auch mit der konnte man telefonieren.
2
Ein Zeitgenosse hat sich hier einen Scherz erlaubt, vermute ich. Oder ist das echt und jemand Bestimmtes ist gemeint? Auf jeden Fall hat jemand deutlich sichtbar auf den Hörer geschrieben: „sag ihr dass du sie magst du idiot“. Es ist also wohl ein Mann oder ein Junge gemeint, der ihr sagen soll, dass er sie mag.
Egal, ob jemand in echt gemeint ist oder ob das einfach ein witziger Spruch sein soll – die Aufforderung ist wichtig. Telefonzellen waren früher auch dafür nötig, dass man sich die Liebe gestehen konnte. Man ging dann vielleicht im Halbdunkel noch einmal aus dem Haus und rief ihn oder sie an. Und wenn man mutig genug war, sagte man: Ich mag dich.
3
Wir können gar nicht leben, ohne dass uns jemand mag. Schon im Kindergarten wollen wir gerne Freund oder Freundin sein – oder Freunde und Freundinnen haben. Als Jugendliche und Erwachsene ist das genauso. Wir brauchen Freunde und sind für andere auch gerne Freund oder Freundin. In einem Ernstfall helfen wir einander – in der Schule oder am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Wenn jemand unsere Freunde beschimpft oder gar bedroht, helfen wir ihnen. Freunde verlassen sich aufeinander.
Wer keine Freundin oder keinen Freund hat, leidet darunter und fühlt sich oft alleine. Manchmal merkt man das diesen Menschen an; sie stehen oft am Rand auf dem Schulhof oder in der Klassengemeinschaft.
Das erste, was Jesus machte, als er durch die Dörfer und Städte zog und von Gott erzählte, war: Er suchte sich einige Freunde, die mit ihm gingen. Es ist nicht gut, wenn ein Mensch nur alleine ist.
4
Freundschaft ist eine besondere Art von Zuneigung. Man muss das nicht Liebe nennen, aber gerne mögen tun sich Freundinnen und Freunde schon. Sie kennen sich oft recht gut; oder sie fragen einander um Rat. Was würdest du an meiner Stelle tun?, ist so eine Frage, die Freunde einander stellen. Und der oder die andere versucht dann, die eigenen Gedanken zu äußern und einen Rat zu geben: Ich an deiner Stelle würde …
Es gibt kaum ein größeres Kompliment, als wenn jemand zu einem anderen Menschen sagt: Du bist mein Freund; du bist meine Freundin. Denn das heißt: ich werde dir helfen, raten. Und ich werde, wenn es nötig ist, für dich eintreten. Auf mich kannst du dich verlassen.
5
Manchmal muss man das sagen. Vieles kann man fühlen, aber doch nicht alles. Und manches geht im allgemeinen Geplauder eines Tages auch unter. Darum finde ich es nicht nur witzig, sondern auch wichtig, was hier jemand auf den Hörer geschrieben hat: „sag ihr dass du sie magst du idiot“. Das heißt: Sprich es aus, was du fühlst; verstecke deine Gefühle nicht. Der oder die andere braucht das und möchte es gerne hören.
So war es mal bei Jesus, ganz am Ende. Irgendwas hat ihn zweifeln lassen, ob seine Freunde, vor allem Petrus, ihn wohl noch mögen. Solche Zweifel sind nicht schön, besonders dann nicht, wenn man in Not ist. Jesus ist aber dann so mutig und fragt den Petrus: Hast du mich lieb? Und Petrus, der sonst immer ein ziemlich großes Mundwerk hatte, wird sehr leise, fast kleinlaut. Aber er antwortet deutlich: Ja, Herr, ich habe dich lieb.
Ein schöner Moment ist das, wenn einen jemand lieb hat. Da wird uns warm ums Herz. Wir sind nicht alleine in der Welt. Wir haben Menschen, die uns beistehen.
Freundschaft gibt es, damit uns das Leben leichter wird.
Was ihr getan habt einem oder einer...

Gedanken zum Wochenspruch aus Matthäus 25, 40b
1
Ich denke mich ins Bild. Unsichtbar stehe ich am Rand des Bildes. Keiner kann mich sehen. Der Bettler sieht mich sowieso nicht, die Mutter hat ganz andere Sorgen, das eine Kind auf ihrem Arm ist sie sich selbst im Moment genug und ich rieche das schwere Holz der Eingangstür. Kühlere Luft strömt mir aus dem Haus entgegen. Draußen ist es recht warm und ihr anderes Kind hält dem Bettler ein Brötchen hin. Einfach so. Weil er die Hand aufhält.
Die Mutter der Kinder ist eine zuverlässige Barriere im Eingang des Hauses. An ihr kommt man nicht vorbei. Ihr Gesichtsausdruck verrät mir, dass sie die Übergabe des Brotes aufmerksam, wenn nicht sogar etwas kritisch verfolgt. Freude über die Gutmütigkeit ihres Kindes, das im Begriff ist, dem Bettler das Brötchen zu überreichen, sehe ich nicht. Mit Sicherheit hätte sie aus dem Brot noch etwas anderes machen können. Aber nun verlässt es den Haushalt eben für einen anderen Zweck.
2
Der Körper des Bettlers scheint insgesamt gebeugt zu sein. Hat er einen Buckel? Sein Kopf ist ungeschützt. Die wenigen verbliebenen Haare werden von der Sonne erfasst, ebenso das dürftige Bündel, das er auf den Rücken gebunden trägt.
Was mag da drin sein? Was ist das Nötigste, das so ein Bettler mit sich trägt?
Sein Mantel ist mehrfach geflickt und insgesamt sehr abgewetzt. In der linken Hand trägt er neben seinem Stab auch einen Krug. Er braucht offenbar auch etwas zu trinken. Ob er es bekommt, werde ich nie erfahren.
Während der Alte im Schatten vermutlich eines Baumes steht und bettelt, steht die Mutter mit dem Kind auf dem Arm im Licht. Vielleicht steht sie auch nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens – aber soweit ich es erkennen kann, ist das Nötigste doch vorhanden. Brennt da im Haus nicht auch ein kleines Feuerchen?
3
Das Kind mit dem Brötchen in der Hand wird vom Schatten, in dem der Bettler steht, nicht erfasst. Sein Blick ist auf das Nahrungsmittel gerichtet, das ihm entgegengehalten wird. Das Gesicht des Kindes ist von der Sonne angestrahlt und leuchtet gleichzeitig von sich aus. Seine Augen sind mit aller Aufmerksamkeit auf den Bettler gerichtet. Es scheint so zu sein, dass für diesen Moment nichts zwischen die Augen des gebenden Kindes und den Bettler treten kann. Etwa so, als wäre hier überhaupt keine Ablenkung oder Störung möglich. Nichts kann die Zuwendung des Kindes zum Bettler verhindern.
Der Bettler stützt sich auf seinen Stock. Das Kind steht frei. Es hält sich nirgends fest. Seine einzige Sicherheit ist die Mutter im Rücken. Das gutmütige Kind scheint die Situation des Bettlers voll in sich aufzunehmen. Nichts deutet darauf hin, dass es angehalten worden ist, Brot abzugeben. Wenn ich das Gesicht des Kindes anschaue, kann ich nichts weiter erkennen, als dass es ganz offensichtlich der ersten Regung seines Herzens folgt und deswegen dem Bettler das Brot hinhält. Die kleine Hand gibt etwas, das sie gerade so festhalten kann.
Aus dem Gesicht des Kindes sprechen Mitgefühl, Erbarmen und eine unaussprechliche, menschliche Nähe, die merkwürdigerweise auch mich trifft, obwohl ich bloß unsichtbar danebenstehe.
4
Wann habe ich mich zuletzt so ungestört und aufmerksam einem anderen Menschen gewidmet, von dem ich wusste, dass er etwas benötigt, was ich ihm geben kann?
Kinder sind manchmal herrlich, so direkt du unmittelbar, sie sehen und reagieren und sind uns Erwachsenen damit oft meilenweit voraus. Jesus sagt zu den Erwachsenen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder….
Hier hat eines den Spruch für die kommenden Woche gelebt: Jesus Christus spricht: Was ihr getan habt einem oder einer von diesen meiner geringsten Schwestern oder Brüder, das habt ihr mir getan. (Matthäus 25,40b)
Willkommen in der Linie 1

Gedanken über Gott in der Straßenbahn
1
Manchmal fährt Gott mit den Öffentlichen: Bus, Straßenbahn, Regionalzüge. Gott ist nicht wählerisch und Zeit hat er auch. Meistens jedenfalls. Es ist ja nicht so, dass er irgendwo hin müsste. Nein, eigentlich will er einfach bei den Menschen sein. Will hören und sehen, wie es ihnen gerade so geht. Letztes Jahr war er viel unterwegs, als es das Neun-Euro-Ticket gab. Super Sache, fand Gott.
Meistens läuft es so: Am Abend sitzt Gott an seinem Küchentisch und schlägt seinen „Neuen Straßenatlas“ von 1974 auf. Irgendwo. Er schließt seine Augen und berührt mit seinem Zeigefinger irgendeinen Punkt. Gespannt öffnet er seine Augen und freut sich wie Bolle über sein Reiseziel – als wäre er Columbus und würde Amerika entdecken. So war er im Frühling in der Nähe des Chiemsees (leider im Winter), er hat den Ortsteil „Elend“ gesehen, der in Sachsen liegt, und war sogar schon in „Kalifornien“, allerdings das in Schleswig-Holstein. Morgens packt er dann seine Tasche für den Tag, Käsebrote (früher hatte er mal Hackbällchen dabei, aber die rochen zu stark und die Leute beschwerten sich), eine große Thermoskanne mit Kaffee, Taschentücher und ein Buch. Und dann geht’s los.
2
Heute freut er sich besonders auf sein Reiseziel. Er ist unterwegs zur „Frohen Zukunft“. Dahin sollten wir doch alle unterwegs sein, dachte Gott bei sich und lächelte. „Wusste noch gar nicht, dass die ´Frohe Zukunft` in Halle an der Saale liegt“, schmunzelte er vor sich hin. Eine kleine Melodie pfeifend, steigt er gut gelaunt in die Tram, Linie 1, und steuert zielgerichtet einen Platz zwischen einer Gruppe Jugendlicher an. Sie haben Transparente dabei und reden aufgeregt durcheinander. Gott spricht sie an. Er will wissen, was sie vorhaben.
Eine freundliche Jugendliche mit Zahnspange erklärt ihm, dass sie bei Fridays for Future demonstrieren wollten für Klimagerechtigkeit und eine bessere Zukunft. Dann wird es laut, die Jugendlichen rufen im Chor: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“ Gott stimmt ein aus Solidarität und weil er schon lange dafür ist, die Schöpfung zu bewahren.
Dann steigen sie aus, Gott bleibt sitzen und murmelt noch eine Weile: „Wir sind hier, wir sind laut …“ Einfach, weil es ihm gut gefällt. Diese Jugendlichen, dachte er, haben keine frohe Zukunft, wenn alle anderen weiterhin so verantwortungslos mit der Erde umgehen. Aber sie haben Kraft und werden kämpfen, um die Dinge zum Guten zu verändern.
3
An der Haltestelle Kornblumenweg müht sich eine ältere Dame damit ab, einen Rollstuhl mit einem erwachsenen Mann in den Bus zu schieben. Gott packt gleich tatkräftig mit an. „Das ist aber Schwerstarbeit“, sagte er etwas außer Atem zu der Frau und bietet ihr seinen Platz neben dem Rollstuhl an. „Wenn Sie wüssten“, sagt sie zu ihm, „wie mühsam das alles ist. Überall sind Treppen und schmale Durchgänge; und viele Menschen schauen einfach weg. Aber Ludwig ist doch so gerne unterwegs.“ Ludwig lacht laut und klatscht in die Hände. Ludwig ist mit schweren geistigen und körperlichen Behinderungen auf die Welt gekommen, erzählt die Frau. Ihr Mann sei früh gestorben, sodass sie sich allein kümmert. Ludwig ist ein so toller Mensch. Ich wünsche ihm so sehr, dass andere das erkennen, wenn ich mal nicht mehr bin. Dann wischt sie sich eine Träne aus den Augen. „Oh, hier müssen wir schon raus.“
Gott hilft wieder mit, den Rollstuhl aus dem Bus zu schieben und verabschiedet sich von Ludwig und seiner Mutter. Ludwig winkt ihm noch lange nach und Gott winkt zurück.
4
Viele Menschen trifft Gott noch in der Linie 1 auf dem Weg zur „Frohen Zukunft“. Gott seufzt, denn er ahnt, dass sie nicht für alle wirklich froh ist. Jedenfalls nicht der irdische Teil der Zukunft. Manchmal wünscht er sich, er könnte mehr tun als nur da sein und zuhören. Er schreibt einen Satz auf ein Stück Papier, das er auf seinem Sitz liegen lässt, als er die Tram verlässt: Ich will euch Zukunft geben und Hoffnung! Willkommen in der Linie 1!
Sehnsucht nach Verzeihen

Gedanken zu Lukas 7,36-50
1
So wie auf dem Bild stelle ich mir Sehnsucht vor. Den Kopf leicht aufgestützt, den Blick irgendwohin verloren; wenn möglich am Meer. Es geht aber auch beim Blick in ein Tal, auf eine Wiese, im Gras liegend. Sehnsucht mag die Natur, liebt aber auch den Blick aus einem Fenster, vielleicht in ein Meer aus Schneeflocken.
Wer sich sehnt, kann das überall. Und wer sich sehnt, kommt manchmal auf ausgefallene Ideen. Wie zum Beispiel die Frau, in Lukas 7, die offenbar eine Männergesellschaft sprengt und Jesus die Füße salbt, ein Zeichen der Ehrerbietung, ein Anerkennen der Göttlichkeit. Dann weint sie und trocknet Jesu Füße mit ihren Haaren. Das wäre heute noch aufsehenerregend. Ein Ereignis, von dem das Dorf oder die Stadt spricht. Weil hier jemand mit seiner Sehnsucht nicht alleine bleibt oder nur innere Bilder anschaut, sondern die Wohnung verlässt, etwas tut.
Die Frau in dieser Geschichte will Verzeihen. Und sie bekommt es.
2
Der Maler Heinrich Vogeler, geboren in Bremen, wusste, was Sehnsucht ist. Und er war mit vielen Talenten gesegnet. Er malte, zeichnete, entwarf Häuser, übte sich in Pädagogik und im Verfassen von Dramen. Seine bürgerliche Welt, unter anderem auch im Künstlerdorf Worpswede nordöstlich von Bremen, wurde ihm bald zu eng. Und da er dem Kommunismus zuneigte, wanderte er in die Sowjetunion aus. Dort, so hoffte er, sollte sich sein Sehnen erfüllen, wenn er soziale Ideen und Pädagogik verwirklichen konnte.
Als aber Deutschland 1941 Russland überfiel, wurde Vogeler als Deutscher in Russland nach Kasachstan zwangsdeportiert, wo er 1942 starb. In den 1990er-Jahren stellte die Gemeinde Karaganda in Kasachstan ein Denkmal für ihn auf.
3
Sehnsucht kennt unzählige Bilder und Wünsche. In der Geschichte, die Lukas erzählt, wird von Sehnsucht gar nicht gesprochen – sie wird aber gezeigt: die Sehnsucht nach Verzeihen. Jesus spürte sofort, was die Frau antreibt. In einem kleinen Gleichnis versucht er, dem Pharisäer Simon die Hintergründe zu erläutern. Simon, der die Frau nicht versteht, versteht aber das Gleichnis. Wer viel geschenkt bekommt, wird besonders dankbar. Das ist eine Sprache, die auch ein rechtschaffener Pharisäer versteht. Die Frau mit dem eher schlechten Ruf versteht Simon nicht. Ihm muss man nichts verzeihen, mag er denken; er ist ja „rechtschaffen“.
4
Und damit sind wir beim Pharisäerhaften von heute. Das Wort bedeutet ursprünglich „Abgesonderte“ und bezeichnete eine Strömung im Judentum, die auch „Schriftgelehrte“ genannt wird und sich durch besondere Rechtschaffenheit auszeichnete. Also ehrbare, fromme Menschen, die ihre Zeit mit dem Studium der Heiligen Schriften zubrachte und mit einem Leben, das den Heiligen Schriften gerecht wird. So weit, so gut. Jesus, lesen wir hier, ließ sich gerne mal in solch ein Haus einladen. Pharisäer waren ehrbare Menschen.
Und zwar so lange, bis sie über andere ihre Nasen rümpften. Und sich als die besseren Menschen fühlten. Ein paar davon lernen wir im Neuen Testament kennen. Wohlgemerkt: ein paar. Viele waren und blieben ehrbar; ein paar aber verdanken wir den manchmal seltsamen Klang des Wortes Pharisäer. Sie geben sich rein, sind es aber gar nicht. Sie bedürfen des Verzeihens, würden das aber weit von sich weisen. Weil sie sich stets und überall für ehrbar halten.
5
Auch diese Menschen kennen wir heute. Menschen, die immer unschuldig sind, nie für etwas können, jeder Not aus dem Weg gehen und die, wenn sie beten, wie der eine Pharisäer (Lukas 18,9-14) zu Gott beten würden: Danke, dass ich besser bin als andere. Diese Menschen kennen wir; manchmal, Gott sei’s geklagt, gehören wir vielleicht dazu. Es gehört wohl mit zur größten Schuld, sich ständig an allem unschuldig zu fühlen. Wer nicht gelegentlich ein schlechtes Gewissen hat, hat gar kein Gewissen.
Und dann sehen wir hier die Frau mit ihrer Sehnsucht nach Verzeihen. Was für einen Aufwand betreibt sie, damit ihre Sehnsucht erfüllt wird. Jesus kommt ihr entgegen. Mit einem großartigen Satz: Wer liebt, kann schuldig werden. Nur Lieblose, heißt das umgekehrt, fühlen sich an allem unschuldig.
Das müssen wir jetzt nicht immer und überall für richtig halten. Aber wir dürfen den Geist Jesu verstehen: Wer liebt, kann schuldig werden. Und wer zu mir kommt, dem werde ich verzeihen.
Die Sehnsucht nach Verzeihen – Jesus will sie erfüllen.
Kommt zu ihm, alle, die ihre diese Sehnsucht habt.
Gott ist nahe denen, die sich ihm nähern

Gedanken über die Suche nach Zufriedenheit
1
Da laufen sie, mit Taschenlampe. Eine Gruppe von Menschen ist auf der Suche, womöglich auf der Suche nach gutem Leben, dicht aneinandergedrängt. Mit Eifer suchend, könnte man sagen. Und mit Hoffnung im Gesicht, dass es nicht mehr weit ist zum Ziel. Die Gesichter zeigen eine gewisse Fröhlichkeit. Das Ziel scheint nicht mehr weit.
Das Ziel ist schon verfehlt, könnte man auch denken. Seitwärts im Rücken der Suchenden stehen große Gebilde mit Text. Die Gebilde erinnern an die Tafeln, die Mose vom Berg Sinai mitgebracht hat – jedenfalls kennen wir das so von vielen Darstellungen auf Bildern oder in Filmen. Steintafeln sind das, die Gott sozusagen selbst beschrieben hat. Auf ihnen stehen die Zehn Gebote (2. Buch Mose 20). Mose hört und empfängt die Gebote am Berg Sinai und bringt diese steinerne Urkunde mit zum wandernden Volk. Sie sind Grundlage des Bundes Gottes mit Israel, also der Vertrag, auf den sich beide Seiten einigen. Schutz und Fürsorge gegen das Achten der Gebote.
Sie stehen da, mitten auf dem Weg, eigentlich unübersehbar. Man kann daran gar nicht vorbeigehen.
2
Offenbar doch. Gerade was eigentlich unübersehbar ist, kann man leicht übersehen. Weil es so deutlich ist, so selbstverständlich, so einfach – ja banal. Das soll es sein?, fragt man sich dann und geht erst mal weiter. Das soll helfen, dieses Uralte, Gewöhnliche, schon immer Dagewesene?
Das kann doch nicht sein, sagt man beim Sehen und geht einfach weiter. Dreitausend Jahre alte Weisungen sollen heute den Weg bestimmen, in diesen unübersichtlichen Zeiten? Da muss doch mehr sein, Anderes, Frischeres. Wir leben doch nicht mehr in Zelten in der Wüste. Wir sind doch modern. Wir haben das Alte doch hinter uns gelassen.
3
Ja, haben wir das? Und ist Altes immer gleichbedeutend mit verbraucht? Da sollten wir vorsichtig sein und lieber etwas länger nachdenken. Tatsächlich sind die Zehn Gebote sehr alt; sie gehören in den Anfang der Menschheitsgeschichte mit Gott. Wenn wir die Gebote für überholt halten, dann ist auch Gott überholt. Er hat sich, sein Erscheinen und Wirken unter und mit uns in gewisser Weise an seine Gebote gebunden. Wo sie lebendig gehalten werden, erfahren wir Gott als lebendig. Wer mit sich und den Geboten ringt, wer nach ihrer Bedeutung fürs Leben fragt, ist gleichsam mit Gott im Gespräch. Das lernen wir während der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Das Befolgen der Gebote hat Folgen, das Nichtbefolgen auch. Es geht jetzt nicht um Lohn und Strafe und auch nicht um richtig oder falsch, sondern allein um hilfreich oder nicht. Wer meint, die Gebote außer Kraft setzen zu können, wirkt mächtig und ist in Wahrheit doch kraftlos, wie man nach einer Weile erkennt. Wer meint, Gott für überholt und überflüssig erklären zu können, muss etwas an seine Stelle setzen. Meistens setzt er sich selbst an diese Stelle.
Aber wehe uns, wenn sich der Mensch, wenn sich Menschen für Gott halten. Keine dieser Bemühungen ging gut aus. Meistens floss viel unschuldiges Blut – im Namen von irgendetwas, was Menschen buchstäblich „überhöht“ haben: ihre Gerechtigkeit, ihre eigenen Pläne, ihre eingeschränkte Weltsicht. Menschen können vieles, Gott sein aber können sie nicht.
4
Also sollten sich die Menschen auf dem Bild ruhig bald wieder umdrehen und das seltsame Gebilde, die Steintafeln, in Ruhe betrachten. Vielleicht liegt ihr Lebensziel ja darin beschlossen. Vielleicht genügen ihnen die uralten Sätze doch. Versuchen sollten sie es:
die Anerkennung Gottes; die Heiligung des Feiertages; das Ehren der Alten; die bleibende Verantwortung für den Lebensmenschen; die Abkehr von der Gier und den Lügen und vom Begehren um jeden Preis. Vielleicht ist das ja ein guter Anfang für die, die nach einem Sinn ihres Lebens fragen und nach dem richtigen Weg in der Unübersichtlichkeit. Um bei diesem Bemühen dann zu merken, wie lebendig ihnen Gott begegnet, der Schöpfer dieser Sätze.
5
Alt ist nicht gleich überholt. Altes kann seinen tiefen Sinn behalten, über Jahrhunderte hinweg. Die Gebote haben ihren Sinn. Bis heute. Es sind Angebote, das Leben im Licht Gottes zu verstehen, zu leben und zu erleben. Was macht es mit mir, mich an den Geboten festzuhalten – so gut wie möglich? Das ist die Frage, die nicht in Monaten, eher in Jahren zu beantworten ist. Was macht es mit mir, Gott mehr zu ehren als mich, den Feiertag zu heiligen und jede Form von Gier, von Habenmüssen abzustellen? Mein Leben ist es wert, dass ich mir darauf antworte. Und, vielleicht, eine größere Zufriedenheit finde. Und darin die Nähe Gottes.
Gott ist nahe denen, die sich ihm nähern.
Auffahren mit Flügel wie Adler

Gedanken zu Jesaja 40,30-31
1
Majestätisch gleitet er auf seinen Schwingen dahin – der Adler. Sobald man ihn erblickt, tritt die Landschaft, die man eben noch bewunderte, zurück. Wenn er erscheint, zieht einen seine Präsenz in seinen Bann. Nicht zu Unrecht wird er der König der Lüfte genannt. Die Landschaft wird zu seinem Reich, durch das er seine Kreise zieht.
Wem der Anblick eines Adlers geschenkt wird, vergisst diesen nahezu magischen Augenblick nie. Wenn ich oben auf den Bergen bin, dann fühle ich mich manchmal wie ein Adler, hoch oben über Gebirgsketten fliegend. Das, was unten in den Tälern geschieht, hat man herrlich im Blick. Dann wird alles manchmal ganz leicht, man vergisst die Sorgen und das, was einen belastet und nicht selten fühle ich mich beschwingt und kraftvoll.
2
Ich versuche dieses Urlaubsbild immer wieder mit in den Alltag zu nehmen. Wenn ich den Überblick verliere oder durch verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten verwirrt werde, versuche ich mich daran zu erinnern und wie ein Adler auf die Dinge zu schauen, von oben - aus der Distanz das Ganze zu betrachten.
Dann genieße ich es Zunächstz den Zwängen enthoben zu sein, und fühle mich frei. Manchmal kehrt schon dadurch die Lebenskraft zurück. Das tut gut. Ich kann wieder durchatmen. Und manchmal ergibt sich nach einer Zeit eine Perspektive, die ich, als ich unten mittendrin war, nicht gesehen habe. Oder ich gewinne einen Überblick und kann mich neu orientieren. Das macht mich dann sehr dankbar.
3
Auch der Prophet Jesaja ist von der Kraft des Adlers fasziniert, wie in einer seiner Verheißungen (40,30f) zu lesen ist: „Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen; aber die auf den HERRN harren, kriegen neu Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“
Diese Verheißung spricht auf besondere Weise zu mir. Wenn ich sie lese, versuche ich mir das vorzustellen: kraftvoll und majestätisch fliege ich hoch oben dahin und fühle mich frei. Gottes Wort verleiht mir dann Flügel und schenkt mir neue Kraft. Der katholische Theologe und Mystiker Henri Nouwen (1932-1996) beschreibt in seinem Tagebuch „Ich hörte die Stille“ eine ähnliche Erfahrung: „Gottes Wort ist wirklich mächtig (…). Wenn ich die Worte, die mich im Gottesdienst ansprechen, mit in den Tag hineinnehme und sie langsam beim Lesen oder Arbeiten wiederhole, (…) schaffen sie neues Leben in mir. Manchmal, wenn ich nachts aufwache, sage ich sie immer noch vor mich hin, und sie werden wie Flügel, die mich über die Stimmungen und Stürme der Tage und Wochen hinwegtragen.“
4
Henri Nouwen beschreibt einen Weg, wie wir unser Vertrauen einüben und Gottes Wort in unserem Leben Raum geben können. Ich kann ein Wort aus der Bibel, das mir besonders lieb ist, auswendig lernen und in Situationen, in denen ich mich kraftlos und orientierungslos fühle, sprechen. Manchmal verändert sich nichts oder nur wenig; ich bleibe gefangen in meinen Grübeleien und Sorgen. Wenn das so ist, dann kann ich das Bibelwort weiter vor mich hin sprechen. Dadurch fühle ich mich zumindest nicht allein; denn das Bibelwort vergewissert mich, dass Gott bei mir ist, und es richtet mich darauf aus, dass ich Gott erwarte.
Manchmal kann es auch ganz anders kommen: auf einmal fühle ich, wie meine Kräfte zurückkehren oder sich eine neue Perspektive einstellt und zuweilen sogar, wie mir Adlerflügel wachsen.
Viele Herzen - eine Seele
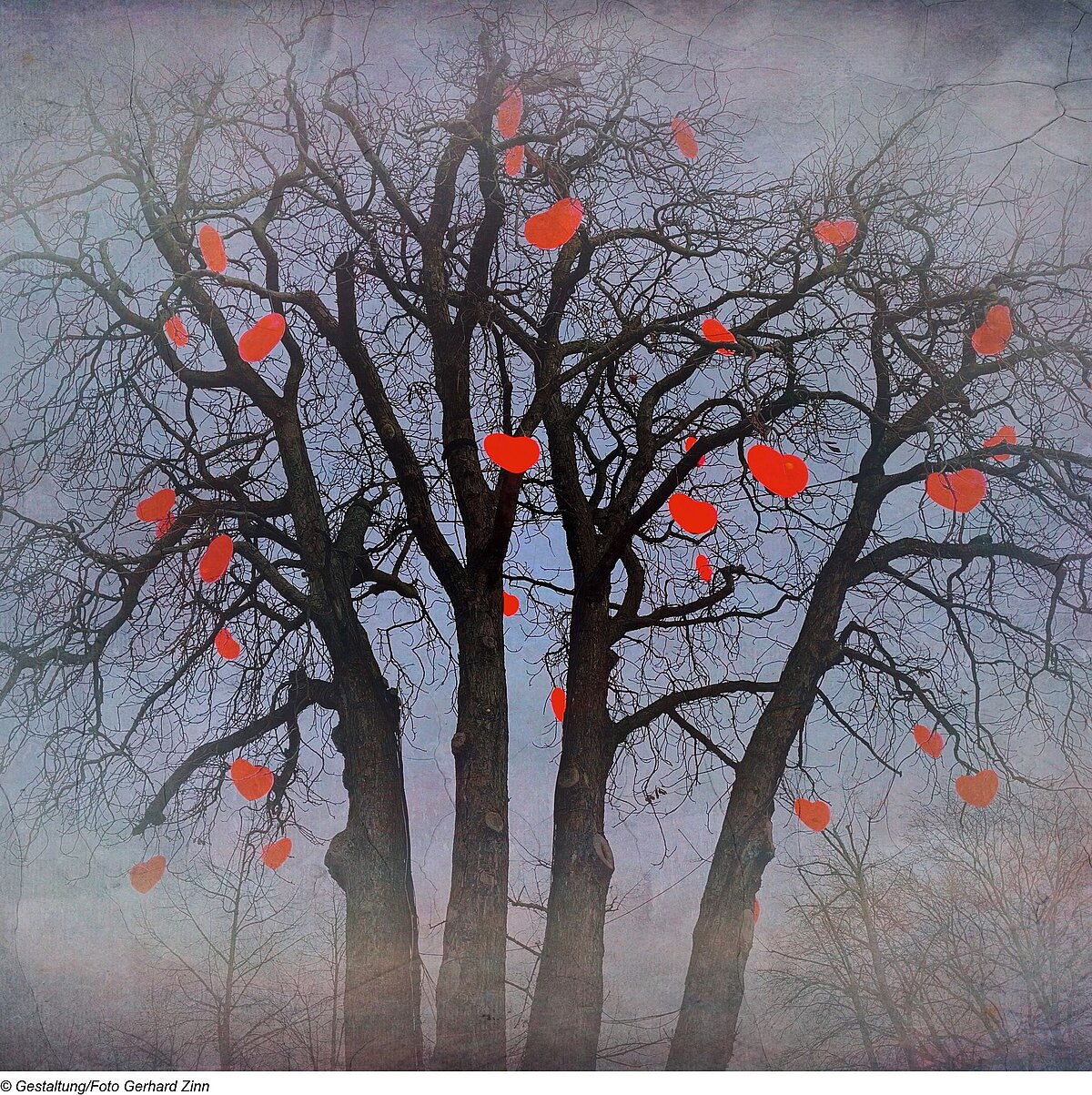
Viele Herzen – eine Seele
1
Viele Herzen – eine Seele; so wünscht es sich der Evangelist Lukas, wenn er über die erste christliche Gemeinde schreibt, die sich damals, am ersten Pfingstfest, gründete. Die Jünger saßen ängstlich in ihren Zimmern, draußen begann ein jüdisches Fest. Plötzlich wehte ein starker Wind und machte den Jüngern Beine, allen voran Petrus. Der hielt eine feurige Predigt – und viele ließen sich taufen; die erste Gemeinde entstand. Und diese Gemeinde war, so schreibt es Lukas in seinem zweiten Buch, der Apostelgeschichte, eine große Seele aus vielen Herzen:
2
Wir schön das damals alles war, sollen wir jetzt seufzen. Einmütig beieinander, geteilter Besitz, harmonisches Brotbrechen. Und über alles die „lauteren Herzen“, die allen alles gönnen und selbst auf alles verzichten, wenn’s sein muss. Ja, so wünscht es sich Lukas – und weiß es doch vermutlich genauer.
Früher war nicht alles besser. Die ersten Christen gaben sich zwar viel Mühe, aber vieles gelang ihnen auch nicht. Da waren allen voran die Apostel Petrus und Paulus, zwei völlig unterschiedliche Typen. Sie hatten heftige Auseinander-setzungen über den richtigen Weg der Mission. Dann gibt es im Neuen Testament, ja in vielen Briefen, ernste Ermahnungen, wie das Leben am besten zu leben sei. Und wo Ermahnungen sind, da gibt es auch Grund dazu. Schließlich hat auch die Frage der rechten Lehre die Menschen, vor allem die Gemeindeleiter, sehr bewegt. Wann kommt Christus wieder? Wann ist die Auferstehung aller und wie sieht sie aus? Warum müssen wir leiden und werden sogar verfolgt, wo wir uns doch haben taufen lassen für ein besseres Leben? Es war auch damals ein Ringen um Wege und Meinungen. Nicht so oft saß man zusammen „einmütig und mit lauterem Herzen“.
3
Aber trotzdem lügt Lukas natürlich nicht. Er will einfach, dass die Christen sich vertragen, Besitz teilen, das Abendmahl in Frieden miteinander feiern und Gott loben. Christinnen und Christen sollen zeigen, dass die Welt sie braucht. Ja, dass die Welt anders wird, weil es die christlichen Gemeinden gibt. Christen haben die gleichen Sorgen und die gleichen Konflikte im Leben wie alle anderen Menschen auch, aber sie sollen anders damit umgehen. Das sind so Herzenswünsche.
Aber die liegen im Staub, wenn aus den Kirchen berichtet wird, dass Kinder missbraucht wurden. Oder wenn wir die Geschichte der Kirche nachlesen. Wie kann das sein, dass der Glaube mit dem Schwert durchgesetzt wurde? Wie ist es möglich, dass kirchliche Stellen dem Wahn verfallen und überall Hexen gesehen haben? Wie kann es sein, dass aus einer christlichen Kirche aus der Zeit der Apostelgeschichte drei oder vier Kirchen wurden – je nachdem, wie man zählt? Wer soll uns trauen, wenn es in der Kirche oft viel mehr um Macht und Karriere geht als um alltägliche Fürsorge?
4
Jeder Christ und jede Christin stehen auch immer ein klein wenig für das Ganze, selbst wenn sie für vieles nicht verantwortlich sind. Auch das Kleinste zeigt immer aufs Große. Wir können uns bemühen, anders zu sein. Wir können versuchen, auszustrahlen mit dem, was wir glauben. Wir können Hoffnung sein für die Welt um uns herum. Wir können in unseren kleinen Welten versuchen, diese Wünsche zu erfüllen. Ich betone jetzt die Worte versuchen und bemühen. Mehr wünscht sich Gott nicht. Tu das Deine, besten Wissens und Gewissens. Rette nicht die Welt, das geht nicht. Aber zeige in deiner kleinen Welt, dass manchmal Rettung möglich ist.
5
Nur das will Jesus Ihnen und mir sagen und zeigen. Lass dich von nichts und von niemandem von deiner Hoffnung abbringen, auch wenn es ernst wird. Oder, wie Paulus es sehr schön in wenige Worte fasst: „Ist’s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.“ (Römer 12,18). Keinen faulen Frieden, sondern einen möglichst aufrichtigen, so viel eben an euch liegt. Lebt nicht einfach drauflos, sondern bedenkt, dass ihr im Licht Gottes lebt und andere das auch spüren möchten.
Das sind die Herzenswünsche Gottes, könnte man sagen. Macht eure kleine Welt ein wenig besser: Teilt eure Habe mit anderen; verzeiht, wo es Frieden bringt; legt euer gutes Recht weg, wenn es der Liebe dient. Und ihr werdet freundlicher zu anderen und zu euch.
Ein freundlicher Mensch fühlt die Gnade zu leben.
Wunder vor blauem Himmel

Gedanken über Sorge und Vertrauen (Matth. 6,26 und 34)
1
Wir sehen ein Wunder. Lägen wir mit dem Rücken im Gras und schauten nach oben, könnten wir das etwa so sehen oder uns – mit einer Hochleistungskamera – so nahe vor unsere Augen holen. Ein lebendiges Kunstwerk, dieser Vogel. Und wie er hier fotografiert worden ist, ist er von perfekter Eleganz im Gleiten oder im Flug. Federn ineinander, übereinander; sie schützen, sie machen den Flug, sie wärmen oder kühlen den kleinen Körper – jeweils, wie es gebraucht wird.
Der Vogel weiß nicht, dass er ein Wunder ist. Das erkennen nur wir: das Wunder vor blauem Himmel.
2
Erkennen wir noch Wunder? Oder verlieren Wunder ihren Zauber, je mehr wir mit ihnen zu tun haben? Das Leben ist ein Wunder. Und je genauer wir hinsehen und hinhören können, desto größer wird der Zauber. Natürlich ist Leben nicht immer schön; es ist auch grausam. Die Natur ist kein friedvolles Spiel im Sandkasten. Da geht es um Leben und Überleben, um Macht und Ohnmacht. Manches in der Natur bringt seine Tage damit zu, sich vor Feinden zu schützen. Elegantes Ausruhen kennen viele nicht. Wir vergessen das nicht, wenn wir von „Natur“ sprechen.
Aber jetzt erkennen wir mal das Wunder des Lebens. Soweit wir das heute wissen, gibt es im Weltall nichts Vergleichbares. Wo immer die Forscher hinschauen, sehen sie Geröll auf Planeten und ihren Monden. Da glänzen vielleicht mal Farben, aber wohl kein Leben. Das Leben glänzt auf Erden. Leben ist ein Wunder.
3
Der Vogel, der Mensch, Sie und ich, sind Wunder. Vermutlich hätten wir es nicht erfinden können, das Leben. Wir können es nur bestaunen. Wie Jesus es bestaunte und fragte (Matth. 6,26): Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr kostbarer als sie?
Für Jesus war klar, wem wir das Wunder des Lebens verdanken: dem himmlischen Vater. Er sorgt, er trägt Verantwortung; er will Leben. Er, der himmlische Vater, will uns. Und kümmert sich um uns – sogar mehr, als für andere Geschöpfe. Wir sind ihm noch kostbarer. Kurz darauf sagt Jesus ja noch: Selbst prachtvolle Lilien, die verblühen und im Ofen landen, sind Gottes Werk. Er sorgt für sie; aber noch viel mehr sorgt er für uns Menschen.
Wo sich einer um uns sorgt, müssen wir uns weniger um uns sorgen.
4
Auch wir Menschen sind Wunder vor blauem Himmel. Natürlich müssen wir uns zunächst eingestehen: Manchmal ist es schrecklich, wie Menschen ihr Leben zubringen – oder zubringen müssen. Manche Lebensgeschichten sind voller Leid; oder ausgeübter oder erlittener Gewalt. Das ist wahr.
Aber andere Leben sind eher gemütvoll und liebenswürdig lebendig. Zugleich aber auch voller Sorge. Als müssten wir alles tun und uns um alles selber kümmern. Das müssen wir nicht; wir können es gar nicht. Das merken wir manchmal. Wir fühlen uns dann ein wenig wie am Ende und wissen nicht mehr vor und zurück vor Sorge. Was soll das alles werden? fragen wir uns dann. Jesus weiß das. Er sagt ausdrücklich: Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und wünscht sich dann, was er selber wohl recht gut kann: Vertraut, dass Gott weiß, was ihr braucht.
Sorge und Vertrauen gehören eng zusammen. Wo viel Sorge ist, ist weniger Vertrauen. Manche Sorge muss sein; wir können nicht sorglos „ins Blaue“ hinein leben. Aber um alles sorgen können wir uns auch nicht, das überfordert Herz, Seele und Körper.
5
Vielleicht sollten wir einfach öfter mit dem Rücken im Gras liegen und in den Himmel schauen; entweder tatsächlich oder wir sollten gedanklich so tun: uns mit allen unseren Sorgen einfach ins Gras legen und nach oben schauen. Nach oben, wo der ist, der sich um uns sorgt und der für uns sorgt. Das hat Jesus bestimmt so gemacht. Er war ja nicht sorglos; er war auch kein Träumer oder Schwärmer. Er war einer, der vertrauen konnte; der abgeben konnte, was er nicht schaffte. Bitte, Gott, könnte er dann geflüstert haben, bitte kümmere dich auch. Lass mich nicht allein mit meinen Sorgen.
Das hilft, dieses Abgeben. Schon wenn man es ausspricht und Gott bittet, wird man etwas leichter. Schon dieses Nichtstun und in den Himmel schauen macht etwas leichter. Wir sind nicht allein. Niemand ist allein. Der himmlische Vater ist da, bei uns alle Tage bis an der Welt Ende.
Wer sich ihm anvertraut, trägt an seinen Sorgen etwas weniger schwer.
Neues wagen - Ängste überwinden

Gedanken zur Nachfolge Jesu
1
Es war auf einer Wanderung auf dem Querweg von Freiburg bis an den Bodensee, als wir dieser Brücke begegnet sind. Hinter dieser Brücke begann der Teil des Weges, der 30 km durch eine enge Schlucht führte. Ab hier ging es nur vorwärts, mit Übernachtung mitten in der Schlucht. Vorwärts und nicht zurück. Den Wegweisern folgen, darauf vertrauen, dass es gut geht, dass die eigene Kraft ausreicht, dass die Schuhe halten und die Kondition.
Die Ausrüstung war gut, trainiert wurde auch ordentlich, wir trauten uns zu, dem Weg zu folgen. Dennoch habe ich ein leichtes Zögern bei mir verspürt. Soll ich diesen Weg gehen? Soll ich diesen Wegweisern folgen? Soll ich mich trauen, etwas zu tun, was ich noch nie vorher getan hatte? Soll ich über diese Brücke gehen?
Ein Zögern, ein Zaudern, eine leichte Angst davor, was kommen könnte, das habe ich deutlich gespürt. So ist das immer, wenn ich mich herauswage aus der Komfortzone, wenn ich mich auf etwas einlasse, beim dem ich noch nicht weiß, wo es mich hinführen wird.
2
Dennoch suche ich solche Gelegenheiten, um neue Erkenntnisse zu finden, über mich, über andere Menschen, über Gott. Es gelingt mir besser, weiterzudenken, wenn ich nicht immer in gewohnten Bahnen laufe, wenn ich die selbstgesteckten Grenzen auch einmal bewusst überschreite.
Ich glaube, das ging auch den Jüngern so, die als Erste mit Jesus mitgegangen sind. Auch sie hatten wahrscheinlich Zögern, Zaudern und ein wenig Angst in sich. Gleichzeitig waren sie wahrscheinlich neugierig und bereit, Gewohntes zu verlassen und sich neuen Herausforderungen zu stellen, in einer neuen Gemeinschaft unterwegs zu sein.
3
Die Jünger wussten ja noch viel weniger über den Weg mit Jesus, als ich über diese gut beschriebene Wanderung mitten in Deutschland. Außerdem konnten sie, im Gegensatz zu mir, nicht sicher sein, zurückkehren zu dürfen in ihren gewohnten Alltag. Warum also sind sie mitgegangen?
Es muss die Begegnung mit Jesus gewesen sein, die sie überzeugt hat, seine Art, sie anzusehen und ihnen das Gefühl zu geben, beim ihm zu erfahren, was sie noch nicht wussten. Dennoch war Jesus sicher keiner, der manipuliert hat oder überredet. Ich denke, es ist ihre freie Entscheidung geblieben, sich auf diesen Weg mit Jesus einzulassen. Und es war ihre freie Entscheidung zu bleiben. Jesus ging es um jeden Einzelnen von ihnen, das haben sie sicher gespürt. Ihm ging es nicht darum, für sich selbst Anhänger zu sammeln, sondern seinen Jüngern das Reich Gottes vorzustellen und Gottes Angebot für ihr Leben.
4
Manchmal haben sie es sicher auch bereut, dass sie mit Jesus mitgegangen sind. Aber aufgegeben hat keiner. Sie sind drangeblieben und wollten immer weiter mit ihm unterwegs sein. Sie konnten sicher nicht ahnen, auf welche Wege sie Jesus führen würde und mit was sie sich alles auseinandersetzen mussten. Das kam erst später.
Ihre Nachfolge begann mit dem ersten Kontakt mit Jesus und ihrem Entschluss: Da will ich mit, da will ich dazugehören. Ich will Teil dieser Geschichte werden.
5
Noch einmal zurück zur Brücke in die Schlucht. Es war eine tolle Erfahrung, etwas Neues zu wagen, sich selbst etwas zuzutrauen und an die Grenzen zu kommen. Das war gut. Und der Einbruch kam erst, nachdem die Schlucht längst überwunden war. Das Knie gab nach, die Tour musste abgebrochen werden.
Dann kam der schwierigste Teil. Das Scheitern zu akzeptieren, sich neu orientieren und dennoch das Erlebte als kostbaren Schatz meiner Geschichte aufzubewahren.
Die Bitte der Unsichtbaren

1
Es ist eine ganz bekannte Geschichte im Ersten Testament und Vorlage für große Romane, Theaterstücke und Musicals: Josef und seine Brüder. Ich erzähle die Geschichte gerne im Kindergarten. Heute hier ein Gemälde was an das Ende der Geschichte gehört.
Wir sehen ein Bild aus der zweiten Lebenshälfte des Josefs aus der Zeit in der er Karriere gemacht hat. Vielleicht wurde das Bild deswegen von einem jungen Florentiner Bankier in Auftrag gegeben, weil dieser hoffte, ähnlich wie der biblische Josef ein erfolgreiches Leben vor sich zu haben. Denn nachdem Josef von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft worden war, war er dort aufgestiegen, beruflich und familiär. Der Maler Jacopo da Pontormo hat diesen Aufstieg eindrucksvoll in Szene gesetzt – genauer gesagt in vier Szenen auf einem Bild. Josef ist jedes Mal an seiner roten Kopfbedeckung zu erkennen.
2
Links vorn hält er sein Barett bescheiden in der Hand. Er stellt dem Pharao seinen Vater vor, nachdem er seine Familie während der Hungersnot nach Ägypten geholt hat. Inzwischen ist er zum zweitmächtigsten Mann im Land geworden. Unten rechts wird ihm ein Bittbrief vorgelesen, während eine Gruppe von Menschen demütig auf seine Gaben hofft. Er ist es, der darüber entscheidet, ob andere hungern müssen.
Weil Josef seine Familie vor dem Hungertod gerettet hat, kann sein Vater Jakob in Frieden alt werden. Vor dessen Tod sucht Josef ihn auf. Rechts steigt er mit seinen zwei Söhnen die Treppen hinauf. Oben angekommen, verabschiedet sich die kleine Familie vom alten Patriarchen. Er wird seine beiden Enkel segnen und danach auch seine zwölf Söhne. Die aber sind – bis auf Josef am Lager des Vaters – nirgends zu sehen.
3
Vielleicht verstecken sie sich in der Menge der Hungernden. Vielleicht stehen einige von ihnen bei Jakob im Hintergrund. Erkennen kann man sie nicht. Sie bleiben unsichtbar in der Darstellung von Josefs Leben in Ägypten. Für sie ist kein Platz in seiner Erfolgsgeschichte, nicht mal für ihre Unterwerfung. Nach Jakobs Tod wissen sie, dass Josef nun auf niemanden mehr Rücksicht nehmen muss und sie in der Hand hat. So erfinden sie einen Appell des Vaters an Josef, seinen Brüdern zu verzeihen. Zusätzlich bieten sie sich ihm als Sklaven an.
„Hab Erbarmen mit uns!“ Das ist jetzt die unausgesproch-ene Bitte der Unsichtbaren, die längst keine Rolle mehr spielen im Leben des Mannes, der endlich oben angekommen ist.
4
„Hab Erbarmen mit uns!“ Es gibt sie bis heute, die Bitte der Unsichtbaren.
Die Unsichtbaren spritzen in Südamerika Unkrautver-nichtungsmittel auf die Rosen der Europäer. Ihre Kinder schleppen Säcke mit Kakaobohnen. Und auch hier im Land gibt es Menschen, die Arbeiten verrichten, die keiner sonst machen will. Die Unsichtbaren müssen sich uns nicht unterwerfen, denn sie sind uns nichts schuldig. Aber sie bieten sich nur deswegen nicht als Sklaven an, weil sie längst welche sind.
Sie bleiben unsichtbar, denn keiner will so genau wissen, wie er selbst zu ihrer Not beiträgt. Fragt man die Firmen, für die die Unsichtbaren schuften, ist immer alles in Ordnung. Fragt man die Kunden der Firmen, ist niemand mit moderner Sklaverei einverstanden. Aber selbst die, die es sich leisten könnten, achten zu oft auf die günstigsten Preise und billigen Produkte, weil es so schwer ist, seine Gewohnheiten zu ändern, und weil man schließlich gelernt hat, dass Sparsamkeit eine Tugend ist.
5
Aber wenn Josef in Ägypten eines gelernt hat, dann dies: Sparsamkeit ist nur dann eine Tugend, wenn sie nicht zu Lasten von anderen geht, sondern allen dient. Josef hat Kornspeicher gebaut, nicht für seine eigenen Reserven, sondern um den Hunger zu bekämpfen. Es ging nicht um Abgeben, sondern um Teilen. Josef hat sich mit dem Pharao dagegen entschieden, dass andere hungern müssen. Und am Ende hat die Bitte der Unsichtbaren auf ihn auch deswegen eine Wirkung, weil er verstanden hat, was er und sie in Wirklichkeit sind, nämlich Kinder desselben Vaters. So wie wir – und unsere eigenen unsichtbaren Geschwister. Wir sind alle Gottes Kinder auf der ganzen weiten Welt, die so unterschiedliche Bedingungen hat.
Aus Wahrheit wird Friede

Gedanken zu Jesus und Johannes dem Täufer
1
„Ganz großes Kino“ könnte man seufzen, wenn man dieses Bild sieht: „Die Heilige Familie mit dem kleinen Johannes“. Das Bild ist, im besten Sinne des Wortes, „barock“, also in allem überquellend und farbenprächtig. Es gibt wenig Scharfes, kaum Ecken und Kanten – alles ist rund und schön und prächtig.
Die Heilige Familie müsste sich in Ägypten befinden, könnte man aus dem Alter des Jesuskindes schließen. Und zu unserer Verblüffung trifft die Familie hier auf den kleinen Johannes, der später „der Täufer“ sein wird. Darüber gibt es keine biblischen Berichte, aber die freie Fantasie des Malers. Maria mit dem blauen Mantel, von einem Engel beschützt, hat das Jesuskind auf dem Schoss; Josef steht ihr gegenüber und betrachtet die Szene. Marias linker Arm hält ein wenig den kleinen Johannes fest, der seine Lippen denen von Jesus nahebringt. Ein Lämmchen unten am Bildrand, Kennzeichen des Täufers, trägt ein Kreuz mit Band und Inschrift. Da steht „Ecce“, zu Deutsch „Siehe“, womit Jesus gemeint ist. Johannes wirkt farblich etwas rauer, rotbräunlicher, was auf sein späteres Gewand aus Kamelhaaren hindeuten könnte.
Ein Großzahl von Engeln bevölkert das Bild. Es ist ein Moment der Unbeschwertheit während der vermutlich schweren Zeit in Ägypten.
2
Der Barockmaler Adam Elsheimer wurde 1578 in Frankfurt am Main geboren. Er hatte eine Ausbildung als Maler und war vertraut mit der Kunst von Albrecht Dürer und Matthias Grünewald. Mit zwanzig Jahren verließ er Frankfurt und ging nach München, später nach Venedig und Rom. Elsheimer lebte in finanziell beengten Verhältnissen. Einer seiner „Schüler“ war nicht nur sein Förderer – vermutlich brachte er Elsheimer auch in den Schuldturm. An den Folgen der Haft starb Elsheimer mit nur 32 Jahren.
Bilder wie dieses gehören in die Tradition der „Andachtsbilder“. Sie verkündigen biblische Geschichte. Man betrachtete sie in einer Art privatem Gottesdienst – vielleicht erzählte man sich auch die Geschichte, die auf dem Bild dargestellt ist.
3
Johannes und Jesus haben sich nicht oft gesehen. Johannes hat Jesus getauft und immer auf ihn als den Messias, den von Gott Gesalbten, hingewiesen. Johannes gilt darum mit Recht als „Vorläufer“ Jesu. Später, als Johannes von König Herodes ins Gefängnis geworfen worden war, beginnt Johannes zu zweifeln und lässt Jesus fragen (Mt 11,1-6): Bist du wirklich der Gesalbte Gottes, auf den wir schon viele Jahrhunderte warten? Vermutlich ist Jesus dem Johannes nicht entschlossen genug und zu wenig radikal. Jesus lässt Johannes antworten: „Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert.“ Ob diese Worte dem Johannes in seinen Zweifeln geholfen haben, erfahren wir nicht.
Wir dürfen aber auch – bei allen unseren Zweifeln – die Worte Jesu hören: Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. So wenig bedarf es zur Seligkeit.
4
Manchmal ärgert man sich über Jesus, nicht wahr? Über dessen seltsame, eigensinnige Sanftheit. Doch Jesus konnte auch streng werden – aber meistens war er ruhig bis sanft. „Lammfromm“ nannte man das früher. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Jesus genau wusste, was er tat. Kraft, Stärke oder gar Gewalt helfen vielleicht kurzfristig und können manchmal auch nötig sein – aber dauerhafter Friede wird nur durch Versöhnung und Achtsamkeit. Wo Menschen einander ständig belauern, ist jeder Friede bedroht. Wo Menschen einander aber vertrauen, lebt es sich unbeschwerter. Jesus wusste das, dürfen wir annehmen.
Vertrauen ist oft der schwerere Weg; langfristig aber ist er am tragfähigsten.
5
Johannes wird hingerichtet; Jesus auch. Die Herrscher dieser Welt misstrauen dem Vertrauen. Manchmal erfinden sie sich Feinde, damit sie noch größere Gebiete beherrschen können, wie sie meinen. Aber ihre Herrschaft ist teuer erkauft. Und wie viele sind schon schmählich untergegangen. Johannes und Jesus dagegen strahlen wie eh und je. Es ist die Wahrheit, die aus ihnen strahlt. Und die heißt: Wo Menschen einander vertrauen, im Namen Gottes einander vertrauen, leben sie entspannt miteinander.
Aus dieser Wahrheit wird dauerhafter Friede.
Vom Trost der Nähe
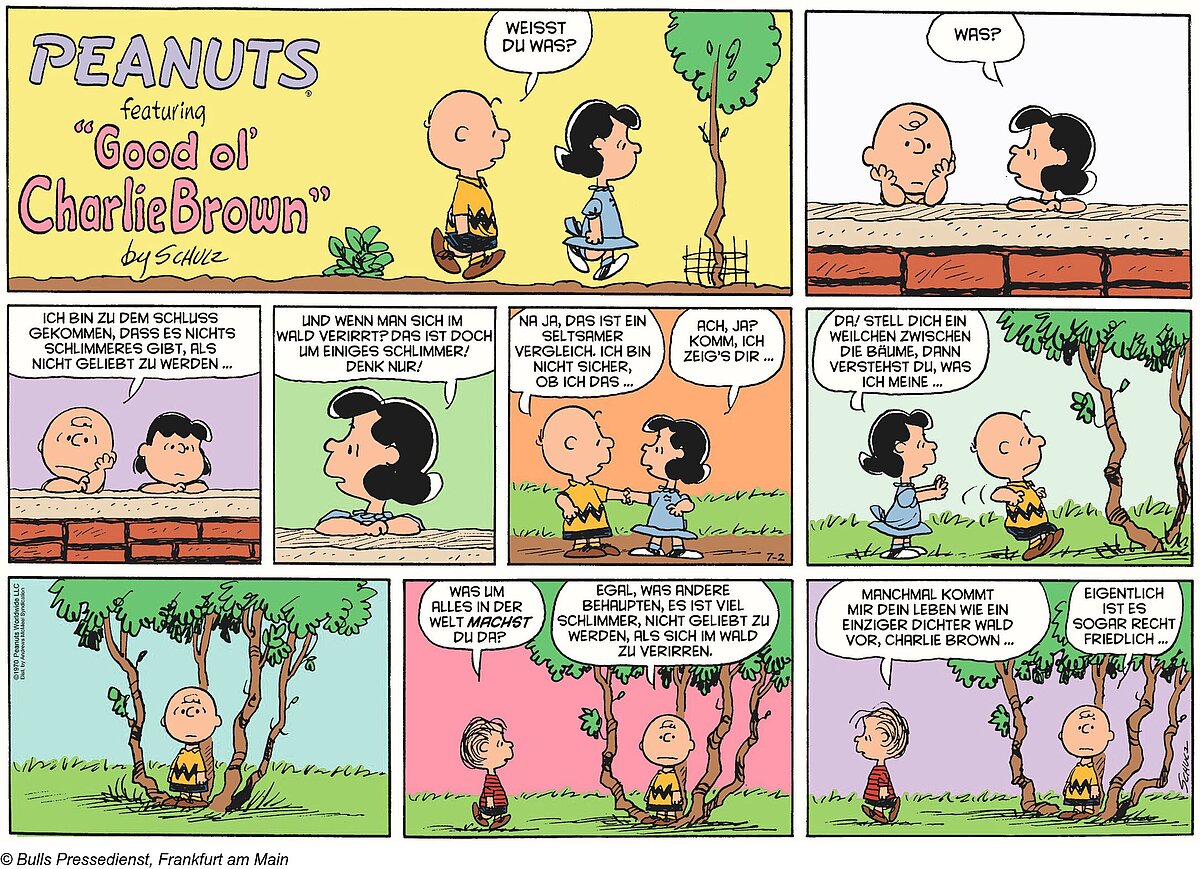
Gedanken zum Wochenspruch Matthäus 11,28: „Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.“
1
Sie haben oft ein etwas angespanntes Verhältnis: Charlie Brown und Lucy. Lucy ist die Forsche, die das Leben in der Hand hat wie eine Schubkarre, die sie beherzt vor sich herschiebt. Jedenfalls meint sie das. Charlie hingegen ist grüblerisch und bisweilen schwermütig. Manchmal, wenn Lucy den Doktor spielt, geht Charlie zu Lucy und bittet um einen Rat, den er dann bezahlen muss. In dieser kleinen Geschichte ist es anders. Da bekommt der etwas traurige Charlie, der sich oft ungeliebt fühlt, den Rat kostenlos.
Lucy meint, nicht geliebt zu werden sei nicht so schlimm; schlimmer sei es, sich im Wald zu verirren. Hier klingen Lucys eigene Ängste an. Als Charlie ihr das nicht glaubt, soll er es ausprobieren. Er steht eine Weile in dem, was Lucy einen Wald nennt. Und fühlt sich eigentlich recht wohl. Bis Linus, der Bruder von Lucy, des Weges kommt und sich wundert. Er kennt Charlie gut genug, um zu erkennen: Dein Leben ist wie ein einziger, dichter Wald. Da hat er recht. Charlie ist oft schwermütig und fühlt sich alleine gelassen. Das ist sein Kennzeichen in den Bildergeschichten der Peanuts. In einer anderen Geschichte sagt einmal der kluge Linus, Charlies zweitbester Freund nach dem Hund Snoopy, den Satz: „Von allen Charlie Browns der Welt bist du der Charlie Brownste.“
2
Das klingt sehr lustig, ist aber auch ungemein treffend: Charlie steht für alle Menschen, die an sich zweifeln. Die Welt macht ihnen Sorge oder gar Angst – und oft wissen sie nicht, wie sie darauf antworten sollen. Und dann kommt eben noch etwas hinzu, was ein Leben besonders schwer macht: Das Empfinden, nicht geliebt zu werden.
So fühlt sich Charlie – und so fühlen sich viele Menschen. Sie rätseln und fragen sich: Werde ich geliebt? Der Rat, den Charlie dann von Lucy bekommt, ist vielleicht gut gemeint, aber der blanke Unsinn. Lucy rät Charlie, sich einfach etwas noch Schlimmeres vorzustellen. Dann löse sich sein Problem. Das tut es natürlich nicht. Es wird nichts besser in meinem Leben, nur weil es vielleicht noch etwas Schlimmeres gibt.
Sich ungeliebt fühlen ist schlimm.
3
Wer sich so fühlt, braucht keine Ratschläge, sondern die Nähe von ein paar Menschen. Diese paar Menschen sollen uns nicht unsere Empfindungen ausreden; das geht gar nicht. Sie sollen uns auch nicht sagen, dass es Schlimmeres gibt als meine Gefühle; das hilft nicht, wie es Charlie auch nicht hilft. Die Menschen sollen einfach nur da sein. Da sein mit vielleicht der einen oder anderen Handreichung. Mit einem kleinen Dienst, der uns gerade nicht gelingt. Sie sollen so da sein, wie Jesus da war bei den an sich Zweifelnden seiner Zeit. „Kommt her zu mir“, hat er gesagt.
Wer meint, in seinem oder ihrem Leben fehle Liebe, braucht keine Worte, sondern Nähe.
4
Jesus konnte nahe sein und Nähe schaffen. Natürlich redete er auch, aber das ist zweitrangig. Wirklich nötig für die Mühseligen und Beladenen war die Nähe, die Jesus zeigte. Viele waren nicht wegen seiner klugen Sätze zu Jesus gekommen, sondern wegen des Gefühls von Nähe und Verständnis. Man muss nicht reden und keine Ratschläge geben, wie Lucy es tut. Nähe kann sehr still sein. Und je stiller sie ist, desto schöner und wahrer empfindet man dann einen Satz wie: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ Der Satz wird durch Nähe wahr. Niemand wird weggeschickt. Wer mit sich selbst hadert, bleibt einfach in der Nähe anderer. Nähe ist Trost.
Und diese Nähe ist bei Jesus oft ohne Ratschläge. Das macht ihn zum Heiland.
5
Wir sollten uns von Jesus etwas abschauen. Wir müssen niemandem etwas raten oder kluge Sätze sagen. Wir müssen auch niemanden darauf hinweisen, dass es anderen vielleicht noch schlechter geht als mir. Das wird oft stimmen, hilft aber nicht. Was wirklich hilft, ist Nähe. Unaufgeregtes da Sein. Nähe ist Trost. Und je mehr ich solche Nähe zu den an sich Zweifelnden aushalte, desto mehr wird aus Nähe ein klein wenig Liebe. Und andere fühlen sich besser.
Meine Nähe zeigt ihnen nicht nur, dass ich ihre Not aushalte; sie zeigt ihnen auch, dass ich sie mag. Ich bleibe bei ihnen, ich bin ihnen nahe, weil ich sie mag.
Jetzt ist die Zeit

Das Eingreifen Gottes
Gedanken zur Kirchentagslosung Markus 1,15a
1
Ich gestehe: Ich liebe die Art des Zeichners Uwe Krumbiegel, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und tatsächlich beginne ich den Tag mit diesen zwei Dingen: Ich sehe mir eine der Karikaturen an, die mein täglicher Kalender mir liefert, und ich lese Losung und Lehrtext, bevor es in den Alltag geht.
Der St.-Nimmerleinstag knüpft an die mittelalterliche Tradition an, Termine in Urkunden nicht mit einem konkreten Datum zu versehen, sondern auf die Festtage von Heiligen zu legen. Der Mensch war schon immer ein Schelm und es gibt keine bekannte Regel, zu der nicht ein kreativer Ausweg gefunden worden wäre. Alternativ gibt man heute den 30. Februar oder die 54. Kalenderwoche an. Die Briten sagen zu diesem Tag „when pigs fly“. Oder man nutz das schöne Wort „Prokrastinieren“ die Kunst des Verschiebens. J
2
Wenn ich ehrlich zu mir bin, kenne ich dies gut. All die Dinge, die eigentlich getan werden müssten, zu denen ich aber keine rechte Lust habe, verschiebe ich: Die Steuererklärung gehört für mich dazu. Ich gehe davon aus, dass jede und jeder etwas hat, welches er gerne auf den Tag, an dem die „Schweine fliegen (können)“ verschiebt.
Mit wenigen Strichen spießt Krumbiegel dies auf: Der Tag erscheint einfach im Kalender. Der Tag, der gar keinen Ort im Kalender hat, steht nun plötzlich drin. Es gibt kein Entrinnen. Ulf weiß: Er muss noch tausend Dinge erledigen. In seiner Gedankenblase manifestiert sich seine Haltung dazu: „Mist“.
3
Und dennoch strahlt der Cartoon eine Leichtigkeit aus, die ansprechend ist. Wo man den moralischen Zeigefinger erwarten könnte: „Nun tu doch endlich, was du dir vorgenommen hast!“– erwartet einen ein Schalk. Ein Aufblitzen der Unmöglichkeit, alles erfüllen zu können. Ein kreativer Umgang mit dem „Du musst!“. Ich finde Ulf sympathisch, so unrasiert er mit großen Augen auf das Kalenderblatt blickt. Insgeheim weiß ich, dass ich auch oft genug ein Ulf bin. Überrascht und unvorbereitet, nicht (genug) verplant, sondern eher stolpernd in das, was der Tag bringen mag.
4
„Jetzt ist die Zeit“ lautet die Losung des Deutschen Evangelischen Kirchentages in Nürnberg (vom 07.–11.06.2023). Das Bibelwort kommt aus Mk 1,15a, wo Jesus die ersten Jünger beruft. „Die Übersetzungsvariante aus dem Markusevangelium kann als klares Aufbruchssignal zur Abkehr von zukunftsgefährdenden Lebensweisen und Verhaltensmustern verstanden werden“, erklärt die Website des DEKT. Das klingt für mich nun leider doch sehr nach einem „Du musst!“. Und ich bin im Zweifel, ob dies dem biblischen Text gerecht wird. „Die Zeit ist erfüllt“, übersetzte einst Luther. Die Basisbibel bietet an: „Die von Gott bestimmte Zeit ist da.“ Ein Moment, den die Heilige Schrift an vielen Stellen beschreibt: Ein Augenblick in der Zeit, der geschenkt wird und dir begegnet ohne dein Zutun. Ein „Kairos“. Ein besonderer Zeitpunkt: Die Zeit der Gnade (2. Kor 6,2), eine Zeit des Aufatmens (Apg 3,20) und eine Zeit, seine Rolle" zu finden (Lk 17,1).
Ich hoffe, dass der DEKT nicht „moralisch rüber kam“, so wichtig es auch ist, selbst ins Handeln zu kommen angesichts der Herausforderungen, in denen wir uns befinden. Ich wünsche mir die Leichtigkeit Ulfs, der ja konfrontiert wird mit all dem, was er bisher nicht getan hat. Und gerne darf er sein „Mist“ dazu denken. Aber der Kairos hat ihn eben dennoch erreicht. Völlig unplanbar, völlig undenkbar ist der St.-Nimmerleinstag eben nun doch in den Kalender eingetragen. Ulf kommt nicht mehr an ihm vorbei.
5
Ich glaube, dass Gott so an uns handelt. Er berührt uns in den Momenten, die nicht wir uns mühsam gebastelt haben. Sondern er kommt wie „ein Dieb in der Nacht“. Unerwartet kommt er – und findet uns ungesichert vor. Natürlich folgt dann eine Entscheidung und auch ein Handeln. Die Bibel kennt auch falsche Entscheidungen und benennt sie.
Aber mir gefällt der Gedanke, dass Gott mir zuvorkommt und mich aufsucht. Nicht ich muss alles im Blick behalten. Einfach nur deshalb, weil ich es gar nicht könnte – so wie Ulf. Aber Gott hat mein Leben und meine Zeit im Blick. Dafür bin ich ihm dankbar.
„Die Zeit ist erfüllt“ (Markus 1,15)

Gedanken über Zeit und Reich Gottes
1
Auf dem Bild ist die Zeit stehengeblieben. Genauer: Es ist gar keine Zeit mehr da. Es gibt zwar ein Zifferblatt mit römischen Zahlen von eins bis zwölf – es gibt aber keine Zeiger mehr, die eine Zeit anzeigen könnten. Dafür steht dort der launige Satz: „zu jeder Zeit“. Das Bild, das von der Zeit erzählt, ist selber zeitlos. So zeitlos wie Jesus.
Als Jesus im Markusevangelium unsere Welt und ihre Zeit betritt, sagt er als Erstes: „Die Zeit ist erfüllt“. Das ist die klare Ansage eines Menschen, der sich seiner selbst bewusst ist. Mit mir, sagt Jesus, erfüllt sich etwas. Eine alte Zeit ist beendet, eine neue, erfüllte Zeit beginnt. Und die neue Zeit, sagt Jesus, wird immer erfüllt sein von mir.
Mehr Selbstbewusstsein geht nicht. Die Welt bekommt eine neue Richtung.
2
Die Planer und Gestalter des Deutschen Evangelischen Kirchentages haben den Satz aus Markus 1, Vers 15, leicht verändert. Sie nennen die Veränderung eine „Variante“. Bei ihnen heißt der Satz und die Losung des Kirchentages, der in der kommenden Woche in Nürnberg stattfindet: „Jetzt ist die Zeit“. Ein „Jesus sagt:“ haben die Gestalter des Kirchentages weggelassen. „Jetzt ist die Zeit“ kann alles Mögliche bedeuten. Wohl denen, die gleich wissen, dass Jesus diesen Satz gesagt hat.
Jesus sagt den Satz, nachdem Johannes der Täufer ihn im Jordan getauft hat. Bei der Taufe hörten alle, die anwesend waren, eine Stimme vom Himmel. Die sagte zu und über Jesus: „Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.“ Das klingt, als würde Jesus in diesem Augenblick von Gott als dessen eigener Sohn angenommen oder vorgestellt. Zum Beweis dessen muss der Königssohn dann die Versuchung vom Satan überstehen – was ihm gelingt. Nun ist alles auf dem Weg, auf dem Gott es haben wollte. Jesus kann unter Menschen. Dort sagt er als Erstes: „Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.“
Jesus füllt unsere Zeit mit dem Reich Gottes. Nun ist unsere Zeit nicht mehr sich selbst überlassen. In unserer Zeit zeigt sich noch etwas: das Reich Gottes. Das Reich der Liebe und der Fürsorge.
3
Zeit ist nicht alles. Uhren sind nicht alles. Zwar leben und handeln wir oft nach unserer Zeit, langsam oder schnell – zwar leben wir unser Leben in einer gewissen Zeitspanne, länger oder kürzer. Aber das, was auf unseren vielen Uhren zu erkennen ist, ist nicht alles. Es gibt in unserer Zeit eine andere, eine erfüllte Zeit. In uns und um uns wirkt auch das Reich Gottes – ob wir das mitbekommen oder nicht; ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Wir sind in unserer Zeit umhüllt von dem, was Jesus als Erstes sagte: „Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.“
Was aber haben wir davon, dass Jesus das sagt?
4
Wir haben davon die Fülle des Lebens. Das heißt: Wir haben nicht nur eine mehr oder weniger lange Lebenszeit, sondern auch einen besonderen Wert unseres Lebens. Wir können das Leben in Liebe und Fürsorge zueinander leben. Wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, dass und wie wir von anderen Menschen geliebt werden, wie sie auf uns achten – und wir dürfen uns jeden Tag klar machen, wie gut es ist, andere zu lieben und auf sie achtzugeben. Die Fülle des Lebens haben wir, weil wir einander lieben und füreinander da sein können. Wie Jesus es in seiner Bergpredigt sagte (Mt 5,8): „Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.“
Gott zeigt sich uns in denen, die lieben.
5
Das Reich Gottes ist das Reich der Liebenden. Da, wo es keine Bedingungen für Liebe gibt, wo Menschen nicht allein nach ihrem Tun bewertet werden. Das Tun kann sehr schlimm sein, das wissen wir und haben wir schon gespürt. Ein Mensch ist aber immer mehr als sein Tun. Das ist Jesus wichtig. Auch er kennt böse Menschen. Und verurteilt solches Böse sein. Zugleich weiß er aber, dass jeder Mensch auch lieben könnte, achtsam sein könnte auf andere. Das Reich Gottes ist immer eine Möglichkeit in meinem und in Ihrem Leben. Das sollen wir wissen – und möglichst zu nutzen wissen. Wir können immer Liebe sein.
Weil die Zeit erfüllt ist. Weil Jesus liebte. Im Namen dessen, der die Liebe ist. Diese Zeit braucht keine Zeiger auf der Uhr. Sie ist erfüllt „zu jeder Zeit“.
Erfüllt ist die Zeit, die wir in Liebe leben.
Das Herz der Welt

Gedanken zum Wochenspruch an Pfingsten (Sacharja 4,6b)
1
Ein Schnappschuss vom Heiligen Geist. So wirkt dieses Bild. Die Fotografin möchte die Klosterkirche fotografieren. Und wie sie abdrückt, flattert ihr der Geist in Gestalt einer Taube ins Bild. Vielleicht ärgert sie sich für einen Moment, schaut dann das Bild an und ist beglückt. So ein Bild kann man nicht machen. Das wird einer gegeben. Ein Schnappschuss vom Heiligen Geist. Der weht einfach dazwischen, ist nicht planbar. Dann kommt er und ist kaum zu vertreiben – aber auch nicht einzufangen. Einer der schönsten und wertvollsten Sätze über den Heiligen Geist steht schon im Ersten Testament, beim Propheten Sacharja (4,6b). Da heißt es: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“
2
Leider geschieht aber vieles durch Heer oder Kraft. Während ich diese Zeilen schreibe, ist Krieg in der Ukraine. Russland setzt auf seine Macht und will sich Teile der Ukraine „einverleiben“, muss man wohl sagen. Keinen Augenblick hat die russische Staatsmacht oder die russisch-orthodoxe Kirche auf den Geist von Verhandlungen gesetzt. Eine Weile hat Putin so getan und einen nach dem anderen empfangen. Zugleich aber hat er den Aufmarsch seiner Soldaten fortgesetzt. Seine Gespräche dienten zu keiner Lösung; er wollte nur Zeit gewinnen bis zum Überfall auf ein friedliches Land. Mit gewaltigen Lügen müssen die russischen Machthaber sich selber und der Welt gegenüber dieses Verbrechen gegen das Völkerrecht rechtfertigen. Kaum jemand – außer im eigenen Land – glaubt an die Lügen. Alle Macht den Gewehren; keine Macht dem Geist.
Wie mag dieses Verbrechen zu Ende gehen? Russland wird vermutlich ja nichts gewinnen. Womöglich verliert es sich selber.
3
Was mit Gewalt erobert wird, hat meistens keinen Bestand und bringt vor allem keinen Frieden. Dafür aber weitere Unterdrückung und eine Fortsetzung der Gewalt. Obwohl diese Erkenntnis nicht neu ist und von der Geschichte vielfach belegt wird, versucht man es immer wieder mit Gewalt.
Natürlich muss sich eine Gemeinschaft oder ein Staat verteidigen dürfen, auch mit Waffen. Aber es muss klar sein, dass wir mit Gewalt keine Herzen und keine Konflikte gewinnen. Da muss, auch wenn wir uns verteidigen, mehr sein. Dieses Mehr heißt klipp und klar: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“
4
Vertrauen in den Geist Jesu ist das oberste Gebot im Zusammenleben. Nicht, weil es so einfach wäre, sondern weil es der Weg ist, der am ehesten Frieden und Gerechtigkeit verspricht – in den Partnerschaften, den Familien, den Nachbarschaften, Vereinen und am Arbeitsplatz. Vertrauen in den Geist Jesu, der geraten hat: Sucht möglichst einen intelligenten Weg zur Versöhnung; einen Weg, der auf Gewalt oder Drohungen von Gewalt verzichtet. Und wenn ihr ganz ernsthaft danach sucht, wird es so sein, dass der Geist wie die Taube im Bild mitten in euer Leben flattert. Der Schnappschuss vom Heiligen Geist zeigt euch dann einen Weg – und wenn es erst einmal nur der Weg ist, sich nicht zu rächen, nicht zu vergelten, sondern zu schweigen und zu tragen, was dir angetan wurde. Es kann auch sehr hilfreich sein, einfach nichts zu erwidern. Dann laufen Vorhaltungen ins Leere. Manche wollen uns ja zu einem Ungeist locken – den Weg betreten wir dann nicht.
5
Möge der Geist wie eine Taube in unser aller Leben flattern. Und uns erinnern, dass es womöglich andere Wege gibt als nur die der Rache, der Vergeltung, des Erwiderns von Bösem. Jesus hat es versucht. Er hat versucht, der Gewalt und den Drohungen zu entgehen – durch Geist. Einmal schlägt er vor (Matth 5,40): Wenn dir jemand etwas nehmen will, gib ihm einfach noch mehr. Das nimmt ihm, bildlich gesprochen, den Wind aus den Segeln. Wehre dich ruhig – aber wehre dich mit Witz, mit Geist, mit der Bitte um Gottes Hilfe. Sei möglichst intelligenter als die, die mit ihren Drohungen herumfuchteln. Besiege sie mit dem festen Willen zur Versöhnung.
Da flattert dann der Heilig Geist ins Geschehen. Er ist so etwas wie der feste Wille, sich möglichst auf nichts Böses einzulassen. Besiegt das Böse, wo immer es geht, durch Geist und Witz. Lasst euch möglichst nicht auf Drohungen ein. Bittet Gott, dass ihr reich werdet an Geist.
Der Heilige Geist ist das Herz der Welt.
Die Schöpfung – Zufall oder Wille?

1
Hier protzt einer, könnte man sagen, mit seinem angeblichen Wissen. Mitten im schönsten Maienfrühling, sogar in kurzen Hosen, steht er neben einer Dame und gibt vor, etwas zu wissen. „Gott ist tot“, sagt er bedeutungsvoll zu der Dame im Strohhut. Das sind drei Worte, die so gewagt bis unsinnig sind, ähnlich wie die Worte „Gott gibt es!“ Was wissen wir schon ...
Aber dann setzt der Mann in kurzen Hosen seinen Satz noch fort und meint, nachdem er gerade den Tod Gottes festgestellt hatte „… aber er hat immerhin ein beachtliches Lebenswerk hinterlassen.“ Daran kommt der Mann nicht vorbei unter und neben den blühenden Landschaften, in denen sich die beiden gerade bewegen. Wir sehen Gott, sagt er, wir erkennen sein Lebenswerk der Schöpfung, das er hinterlassen hat. Auch wenn, wie der Mann meint, der Schöpfer tot ist.
2
Das Bild spiegelt eine verbreitete Ahnung und zugleich eine Verunsicherung wider. Wir stehen manchmal in der Schöpfung wie in einem großen Garten – und suchen den Gärtner, den wir nicht zu finden meinen. Wir erkennen, dass so etwas Großartiges wie die Schöpfung existiert und sich in jedem Frühling prachtvoll erneuert – einen Rückschluss auf den Schöpfer wagen viele aber nicht oder können viele nicht mehr vollziehen. Wir rätseln, woher das alles kommt – und lassen eine Antwort lieber liegen, als uns festzulegen. Das ist alles verständlich. Die Selbstverständlichkeit Gottes, die es vielleicht früher einmal gegeben hat, ist für unsere Zeit nur noch schwer anzunehmen. Wir wissen zu viel über die Gesetze der Schöpfung und über ihre Bedrohung, als dass wir dahinter noch einen gütigen Schöpfer vermuten können.
Für unsere Zeit und unser Erkennen der Welt und ihrer Möglichkeiten ist Gott ein großes Rätsel geworden.
3
Das ist nicht schlimm. Zu allen Zeiten gab es Menschen und Verhältnisse, in denen Gott den Menschen zum Rätsel wurde. Als Teile des Volkes Israel aus dem Heimatland ins Exil nach Babylon verschleppt wurden, wurde ihnen ihr Gott zu einem großen Rätsel. Wie kann er uns vom Tempel in Jerusalem wegnehmen?, war eine wichtige Frage etwa in den Jahren um 500 vor Jesus. Wie kann Gott so etwas tun? Die eigene Schuld war schnell vergessen, als man Gott Vorwürfe machen konnte.
Der Prophet Jeremia, der in dieser Zeit lebte, erinnert sowohl an die Schuld des Volkes als auch an die bleibende Gnade Gottes. Im 31. Kapitel geht Jeremia sogar so weit, im Namen Gottes einen neuen Bund anzukündigen – trotz der Schuld des Volkes, Gottes Willen nicht getan zu haben:
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr; sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen: „Erkenne den Herrn“, denn sie sollen mich erkennen, beide Klein und Groß, spricht der Herr: denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.
4
Wer Gottes Willen im Herzen trägt, heißt das sinngemäß, wird Gott erkennen. Das löst längst nicht jedes Rätsel, aber es macht doch auf eine besondere Weise nachdenklich. Eine der nachdenklichen Fragen könnte man dem Mann auf dem Bild stellen, der seiner Sache ja sehr sicher klingt: Meinst du wirklich, die Schöpfung lebt für sich alleine? Ich kann das nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass Gott ein Werk in die Welt setzt und dann stirbt. Und die Welt soll sich drehen und immer weiterdrehen, ohne Sinn und Verstand? Kann überhaupt jemand sterben, der solches Leben schafft?
Wir geraten hier schnell an die Grenzen des Denkbaren. Nur eins ist klar. Der Mann auf dem Bild möchte ein wenig von Gott retten, indem er auf sein Lebenswerk verweist. Aber ein bisschen ist Gott nicht zu retten. Entweder bekennt man ihn ganz oder es gibt ihn nicht.
5
Und damit sind wir – über den gut gemeinten und zuletzt doch unsinnigen Satz des Mannes – wieder bei uns. Ist alles Zufall – oder ist es gewollt? Das ist immer die Gottesfrage. Bin ich Zufall – oder bin ich gewollt? Und wenn ich gewollt bin – in welchem Geist lebe ich dann? In meinem oder im Geist Gottes, mit seinen Geboten im Herzen?
Darauf haben wir uns zu antworten. Und mit der Antwort leben wir dann. Bin ich und mein Leben ein Zufall – oder bin ich auf der Welt, weil Gott mich will? Die Antwort kann uns niemand abnehmen. Und sie prägt unser Leben. Einen heiter bis unsinnigen Ausweg, wie ihn der Mann auf dem Bild zu finden meint, gibt es nicht. Die Frage an uns bleibt direkt und klar: Ist mein Leben, ist das Leben Zufall oder gewollt?
Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Das Streicheln des Heilands

1
So wünschen sich viele den Herrn Jesus. Locker fallendes, leicht gelocktes Haar; sanfter, zugleich etwas unbelebter Blick; eine Art Aura ums Haupt. Dazu das schöne Gewand, aus dem seine schmalen Hände schauen. Die rechte Hand hält ein Schäflein, die linke streichelt vermutlich die Mutter des Lamms. Ein Bild des Friedens, dem die anderen Schafe in der Herde mit einem gewissen Wohlwollen gegenüberzustehen scheinen. Der Abendhimmel tut das Seine und deutet mit seinen warmen Farben Frieden an. Ein Bild vollkommener Harmonie von Gott, Natur und Menschheit. Vor allem, weil Jesus ja schweigt.
Leider sieht es so aus, als würde das Bild gerade abgeräumt. Es steht, etwas lieblos, in einem Hof vor einer Art Regenwasserauffangbecken. In der Nähe sehen wir noch, dass wohl ein zweites Bild mit lieblicher Berglandschaft alsbald verschwinden wird. Vielleicht hat ein Haus neue Mieter bekommen, die nun, wie man so sagt, klar Schiff machen. Man könnte an eine Sammlung von Sperrmüll denken.
Das macht dem Herrn Jesus aber nichts. Einen Stab hat er neben sich gelehnt, der wird beim Sitzen und Streicheln nicht benötigt. Der Herr streichelt, ob er nun bald auf dem Sperrmüll landet oder nicht.
2
Es gibt ein Lied zum Bild. Es heißt in seiner ersten von drei Strophen:
Weil ich Jesu Schäflein bin,
freu‘ ich mich nur immerhin
über meinen guten Hirten,
der mich wohl weiß zu bewirten,
der mich liebet, der mich kennt
und bei meinem Namen nennt.
Gedichtet wurde das christliche Kinderlied von der Diakonisse Henriette Maria Luise von Hayn (1724–1782), die 1766 nach Herrnhut in die Oberlausitz kam, wo sie dann 16 Jahre als Leiterin des Ledigen-Schwestern-Hauses der Muttergemeinde der Brüder-Unität verbrachte. Frau von Hayn starb dort 1782 mit 58 Jahren. Zwei Jahre nach ihrem Tod schrieb der deutsche Kirchenmusiker Christian Gregor (1723–1801) die Melodie zum dreistrophigen Gedicht der Diakonisse von Hayn.
Das Lied drückt aus, was das Bild zeigt und was Menschen sich ersehnen: Vollkommene Geborgenheit. Und je unbehauster sich ein Mensch empfindet, desto mehr mag er oder sie dieses Lied. Bei Andachten in Altenheimen kann man erleben, wie Tränen fließen, wenn dieses Lied gesungen wird. Dort empfinden Menschen, dass ihr Wohnen auf Erden zu Ende geht und die Wohnungen im Himmel noch kaum vorstellbar sind. Im Dazwischenleben ersehnt man sich Geborgenheit, das Streicheln des Heilands.
3
Der Heiland kann aber auch anders streicheln. Strenger, deutlicher, voller Ernst – vor allem mit Worten. Das tut er in der Bergpredigt, wo er sehr wohl den Mund aufmachen und Klartext sprechen kann. Vor allem, als es ums Beten geht (Matth 6,5-15).
Da beginnt er seine Rede sozusagen mit einem Frontalangriff: Seid nicht wie die Heuchler; stellt euch nicht dar mit eurer Frömmigkeit; meidet beim Beten einen sich aufblasenden Hochmut. Und vor allem: Plappert nicht. Denn, und jetzt spricht Jesus aus einem einmaligen Gottvertrauen heraus: Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Lasst uns nicht beten oder gar plappern um Überflüssiges, heißt das, sondern lasst uns ihn anbeten, ihm huldigen. Und wenn ihr bittet, dann um das immer Nötige: Brot, Vergebung und Abkehr vom Bösen. Das war es schon mit dem Bitten. Ansonsten: Huldigen wir ihm, beten wir ihn an. So streichelt uns der Heiland – selbst noch mit ernsten Worten.
4
Es ist der gleiche Heiland, der uns streichelt: der schweigende mit seinen Schäfchen im Arm – und der ernst sprechende, der uns jedes Heucheln versagt. Wir sollten uns nicht den Heiland aussuchen, den wir gerne hätten; wir sollen auch immer die andere Seite des Heilands mit- bedenken. Und je sanfter uns der Heiland dargeboten wird, desto stärker bemühen wir uns, seine ernste Seite dazu zu denken.
Vor allem aber beherzigen wir beim Beten seine uns streichelnden Worte: Heuchelt nicht; plappert nicht; Gott weiß doch, was ihr braucht. Und nehmen uns zugleich zu Herzen, dass unser Tun die Huldigung, die Anbetung Gottes ist: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Melancholie

Vom Leben mit Depression
1
David spielt auf seiner Harfe vor dem verstörten Saul und vertreibt den bösen Geist. Die Geschichte aus dem Alten Testament ist so ansprechend und berührend, dass sie von verschiedenen Künstlern umgesetzt wurde: in der Musik ebenso wie in der Literatur und vor allem in der Malerei.
Vor uns ist ein Gemälde des Malers Gerhard von Kügelgen, der um das Jahr 1800 lebte. Er lebte davon, dass er Porträts von Menschen seiner Zeit malte. Doch wichtig waren dem gläubigen Künstler auch Bilder von biblischen Szenen. So entstand 1807 das Bild von Saul und David.
2
Auf dem Bild fällt sofort die Gestalt Davids mit der Harfe auf. Im Stil der aufkommenden Romantik erscheint David zart und engelsgleich. Das Muster auf dem Vorhang lässt ihn geradezu als Boten Gottes erscheinen. David erscheint nicht als Hirte, der mit List und Geschick den Riesen Goliath besiegt. Er sieht auch nicht aus wie der künftige Heerführer und König Israels, sondern eher wie der zarte Liederdichter, der eine himmlische Melodie ins Dunkel bringen kann.
Gegenüber der Lichtgestalt David wirkt der König Saul eher düster. Sein Gesicht bekommt wenig von dem Licht ab, das auf David fällt. Zur Hälfte bleibt das Gesicht im Schatten, zu erkennen ist der unglücklich wirkende Gesichtsausdruck. Gegenüber dem aufrechten David sitzt Saul gebeugt und verkrümmt. Sein Kopf wirkt so schwer, dass er ihn bald aufstützen möchte. Es wird erzählt, dass Saul später gestorben ist, indem er sich in sein eigenes Schwert stürzte; auf dem Bild könnte die Lanze schon hier Gedanken an den Suizid andeuten. Saul wirkt schwermütig in der Darstellung Kügelgens.
3
Vielleicht kommen dem ein oder anderen Kunstkenner die Gesichtszüge Sauls bekannt vor. Tatsächlich hat Kügelgen in Saul einen bekannten Künstler seiner Zeit dargestellt: den Maler Caspar David Friedrich (1774–1840). Bis heute kennen und mögen sehr viele die Bilder von Caspar David Friedrich: Der Mönch am Meer, die Kreidefelsen auf Rügen. Den Bildern Friedrichs haftet etwas Melancholisches an, wahrscheinlich haben sie gerade darum solche Anziehungskraft.
Auch Kügelgen wusste um die melancholische Ader des großen Malers, denn die beiden kannten sich gut. Ein anderer Zeitgenosse bemerkte: „Dass Friedrich im höchsten Grade von melancholischem Temperament sei, das wussten alle, die ihn und seine Geschichte sowie den Grundton seiner künstlerischen Arbeiten kannten.“
4
Heute sprechen wir nicht mehr von Melancholie oder Schwermut, sondern von Depression oder depressiver Verstimmung. Zum Glück sagen wir heute nicht mehr, dass ein böser Geist die Seele verstört, und zum Glück wird Depression jetzt als Krankheit anerkannt, sodass immer mehr Personen offen über ihre Depressionen reden können.
Gut ist es auch, dass Depression mit Psychotherapie oder Medikamenten behandelt werden kann. Doch das hat auch seine Kehrseite: Schnell geht es dann darum, jede depressive Verstimmung zu beseitigen. Doch was wären die Bilder von Caspar David Friedrich ohne seine Melancholie. Auch Saul konnte mit seiner Schwermut viele Jahre König von Israel sein.
5
Kügelgen hat wohl mit Absicht Saul mit den Zügen Friedrichs gemalt. Als wollte er sagen: Es gibt Menschen, die melancholisch oder schwermütig sind. Das ist kein Makel, auch sie können Großartiges leisten in ihrem Leben. Genauso brauchen wir heute den Beitrag, den Menschen mit depressiven Verstimmungen und Erkrankungen für unsere Gesellschaft leisten.
Zugleich ist es gut, das Leiden zu lindern. In der Therapie können wir auch Gottes Zuwendung zu den Menschen sehen, so wie Gott durch Davids Musik dem König Saul zugewandt bleibt.
Musik erreicht die Seele, das gilt für gute, wie für schlechte Tage und auch heutzutage vermag Musik manchem Linderung verschaffen in seiner Schwermut.
Dann treffen Liedzeilen wie diese (aus Nun danket alle Gott EG 316,3) „In wieviel Not / hat nicht der gnädige Gott / über dir Flügel gebreitet!“ direkt ins Herz und die Seele.
Gott umhüllt die Liebenden

Gedanken zum Lied EG 116 „Er ist erstanden, Halleluja!“
1
Auf einmal stand es da, mitten auf dem breiten Gehweg neben der Kreuzung. Man kam um die Ecke, aus einer Bankfiliale oder der Bäckerei und las plötzlich: „Er ist erstanden, Halleluja!“ Normalerweise geht man hier einfach so vor sich hin oder schaut vielleicht schon mal angestrengt, ob man gleich über die Straße kommt oder auf Autos warten muss, die die Kreuzung überqueren. Aber eines Morgens, kurz nach Ostern, stand das hier da, mit Kreide auf die Straße geschrieben: „Er ist erstanden, Halleluja!“
Eine hübsche Idee, nicht wahr? Jemand schreibt das Evangelium auf die Straße, trägt es aus den Gottesdiensten in die Welt. Es ist ja auch so einfach. Vier Worte nur, die das ganze Osterfest in Worte fassen. Genau genommen nur drei Worte – und dazu noch ein Jubel: „Er ist erstanden.“ Keine Macht der Welt konnte Jesus im Grab halten. Und noch: „Halleluja.“ Gott ist größer als alle Mächte der Welt.
2
Vermutlich geht es bei den vier Worten um das Lied EG 116: „Er ist erstanden, Halleluja!“ Es könnte sein, dass jemand es im Gottesdienst gesungen hat und davon so erfüllt war, dass er oder sie es buchstäblich in die Welt tragen wollte, auf die nächstbeste Straße. Manches Glück kann man ja nicht fassen und muss es weitersagen. Erst dann entfaltet es sich und kommt im Herzen richtig an – wenn ich andere teilhaben lasse, wenn ich mein Glück zeigen kann. Oder es mit anderen singen kann wie bei diesem Lied, das seinen besonderen Schwung entwickelt, wenn man es singt und dabei vielleicht noch in die Hände klatscht und mit dem Körper schwingt.
Das Lied EG 116 stammt aus Tansania. Ulrich Leupold (1909–1970), Berliner Professor für Neues Testament und Kirchenmusik, wurde von der schwungvollen Melodie 1969 zu einem deutschen Text angeregt, der mitreißen kann – und etwas sorgenvolle Menschen mal eben in beschwingte Menschen verwandeln kann. Sogar gesetzten, eher zurückhaltenden Menschen geht das so. Ein bisschen Schwung leisten die sich auch bei diesem Lied, wenn sie erleben, was diese Melodie mit einem Körper machen kann.
3
„Er ist erstanden, Halleluja!“ Der besondere Schwung des Liedes kommt vor allem aus seinem Kehrvers:
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd‘ ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben, Halleluja!
Und da ist es dann die letzte Zeile, die Menschen in düsteren Zeiten ermutigen kann: „Jesus bringt Leben“. Warum kann das ermutigen?
4
Weil es uns an Jesus erinnert und daran, wovon und womit er lebte. Er lebte von seinem tiefen Gottvertrauen, das ihm sagte: Ich muss Gott nicht verstehen, um ihm zu vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Und weil der davon lebte, lebte er zugleich mit einer großen Zugewandtheit zu Menschen – auch in den dunklen Stunden vor seinem Tod. Er blieb den Menschen, sogar den Peinigern, zugewandt. Er verdammte sie nicht; er übersah auch im Schmerz nicht die Menschen, die ihm nahe blieben. Kurz gesagt: Jesus liebte, so gut es noch ging und so lange es ging. Das ermutigte ihn selber; das könnte uns ermutigen.
Gott umhüllt die Liebenden.
5
Die Liebe bringt Leben. Nicht nur Jesus, von dem hier gesungen wird: „Jesus bringt Leben, Halleluja!“ Die Zugewandtheit zu Menschen wird auch uns Leben bringen. Das Leben, das Gott denen schenkt, die lieben. Gott umhüllt die Liebenden mit seiner Kraft. Die Kraft Gottes hat Macht. Sogar Macht über den Tod. Das erfahren alle, die sich nach Jesu Tod in ihr Kämmerlein zurückziehen und denken: Alles ist aus, alles war vergebens.
Nichts ist aus; nichts war vergebens. Im Gegenteil. Es geht jetzt erst richtig los mit der Liebe zur Welt, zu Menschen - mit der unerschütterlichen Zugewandtheit zu dem, was Gott geschaffen hat. Jetzt wissen und singen wir, dass Gott die Liebenden umhüllt, wie er Jesus umhüllte. Jetzt wissen und singen wir, dass Jesus Leben bringt, auch uns Leben bringt. Lieben wir also, so lange es geht. Keine Liebe, auch die kleinste nicht, ist umsonst oder vergebens. Im Gegenteil. Jede Liebe, jede Zugewandtheit, auch die kleinste, wird uns stärken und unser Leben reich machen.
Mit seiner ganzen Kraft umhüllt Gott die Liebenden.
Er lebt mit uns
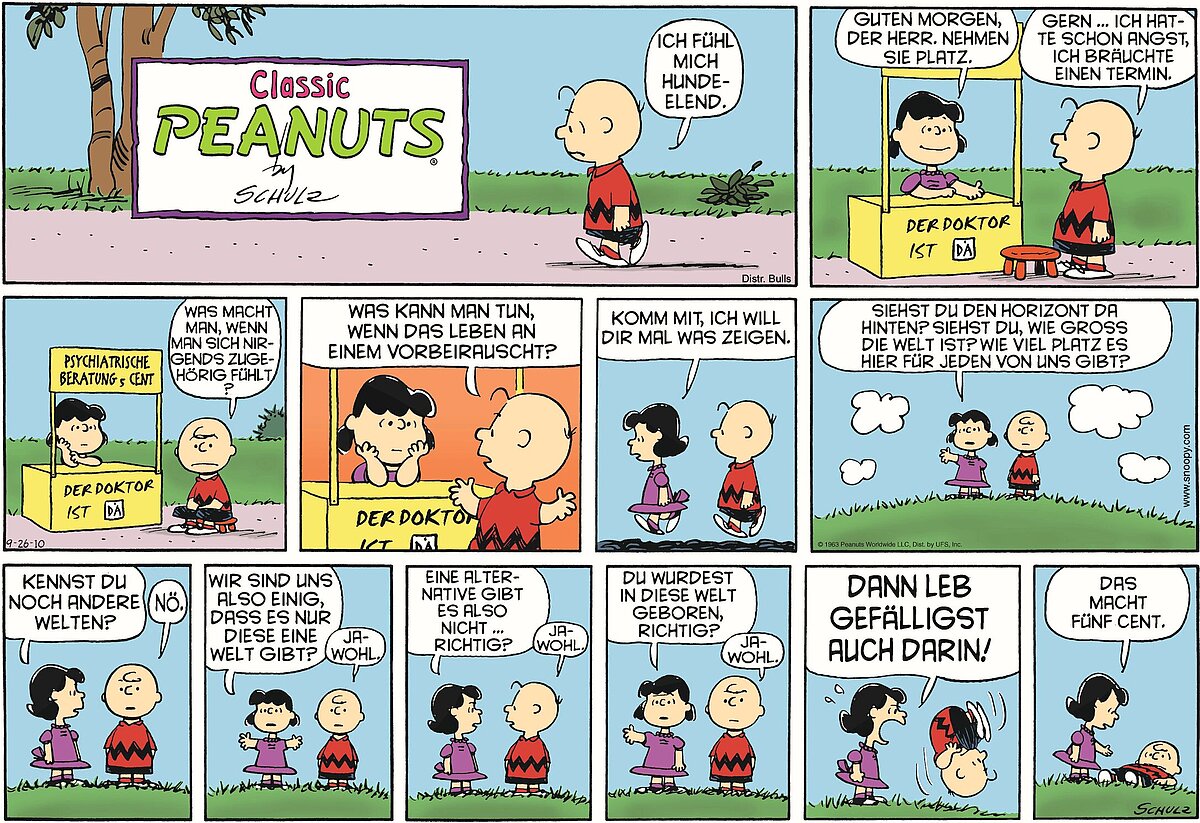
1
Dem Knaben Charly Brown ist „hundeelend“. Er nennt auch den verständlichen Grund dafür: „Was macht man, wenn man sich nirgends zugehörig fühlt? Was kann man tun, wenn das Leben an einem vorbeirauscht?“ Diese Fragen sind nicht nur berechtigt, sondern wohl vielen Menschen vertraut. Ebenso vertraut ist vielen, dass sie sich dann „hundeelend“ fühlen (ich verspüre das gerade in der Coronazeit) und sich fragen: Wie soll ich noch leben, wenn ich so empfinde?
Charly hat Glück und kommt sofort dran, als er Lucy aufsucht, die sich als „Psychiatrische Beratung“ ausgibt. Das ist, wie vieles bei Lucy, ziemlich großspurig. Mit ihrer gelegentlichen Grobheit und ihren meist starken Sprüchen verdeckt sie manche Unsicherheiten in sich. Hier aber ist sie zunächst anders. Erst verwickelt sie Charly in ein für ihre Verhältnisse einfühlsames Gespräch und zeigt ihm die eine Welt, die auch für Charly gemacht ist. Das Warten auf eine andere Welt oder das Warten auf ein völlig anderes Leben, so sagt sie in etwa, hat keinen Sinn – was Charly ihr bestätigt. Er stimmt zu, dass er in diese Welt, in dieses Leben geboren wurde.
Das ist der Moment, in dem Lucy ihre Rolle als „Bera-terin“ verlässt und das tut, was sie am liebsten tut, nämlich Charly anschreien: DANN LEB GEFÄLLIGST AUCH DARIN! Der arme Charly macht vor Schreck eine Rolle rückwärts, liegt platt auf dem Boden und hört dann noch, dass dieser laute Befehl der Lucy ihn auch noch fünf amerikanische Cent kostet.
2
Was für eine großartige Bildergeschichte, finde ich. Man muss vielleicht nicht so rabiat vorgehen, wie es Lucy tut – sie kann eben nicht anders. In der Tiefe ihrer manchmal etwas zu rauen Seele aber hat sie nur recht: Dies ist unsere Welt, dies ist unser Leben; hier gilt es, unser Leben zu leben. Selbstverständlich haben Menschen jedes Recht, sich auch mal „hundeelend“ zu fühlen. Gründe dafür gibt es genug.
Es gibt aber kein anderes Leben jenseits des Lebens, wo alles besser und schöner wäre. Es gibt dieses Leben. Und dieses Leben machen wir zu dem, was wir für das Beste halten – mit Gottes Hilfe.
3
Auch die Jünger Jesu mögen sich „hundeelend“ gefühlt haben in den Tagen nach dem Karfreitag. Ihr Freund und Gefährte ist tot; der, der ihnen Weg, Wahrheit und Leben war, ist nicht mehr bei ihnen. Meinen sie. Sogar der Fischfang geht schief. Bis ihnen ein Fremder am Ufer den Rat gibt: Macht es nochmal, fischt zur Rechten des Bootes - lebt wieder das Leben, das Ihr habt. Und siehe da, die Fischer konnten die Netze kaum ziehen, so groß war ihr Fang. Da sieht Petrus, was er zuvor nicht erkannt hat: Es ist der Herr! ER lebt mit uns. Darum gelingt uns der Fang.
Lucy ist nicht Jesus; und Charly Brown ist nicht Petrus. Aber etwas ist gleich an diesen beiden Geschichten: Ein Mensch traut einem anderen Menschen das Leben zu. Ein Mensch traut einem anderen Menschen zu, dass er das ihm gegebene Leben bewältigen wird. Und ein Mensch zeigt seine Nähe. „Er lebt mit uns!“ ist die freudige Überraschung des Petrus. Diese Überraschung schenkt ihm wieder etwas Lebensfreude. Er beginnt, seine Empfindung des „hundeelend“ zu überwinden.
Auch das ist eine Folge der Auferweckung Jesu: er zeigt sich, er nimmt wieder teil am Leben seiner Freundinnen und Freunde – auch wenn die ihn vielleicht nicht gleich erkennen. Etwas anderes aber erkennen und erfahren sie in den Tagen und Wochen nach Ostern: „ER lebt mit uns!“ ER traut uns unser Leben zu.
4
Darum trauen wir uns auch. Unser hoffentlich neuer, leiser Mut und die behutsame Tapferkeit unseres Lebens in schwierigen Zeiten muss nicht unbedingt – wie bei Charly Brown – mit Lucys Gebrüll und Charlys Rolle rückwärts beginnen. Und schon gar nicht mit einer Rechnung für einen guten Rat.
Petrus vollzieht die Wende mit einem eher beschämten Bad im See – als müsse er sich reinwaschen. Er weiß ja um seine Schuld von vor ein paar Tagen. Er hört aber keinen Vorwurf. Im Gegenteil. Beim gemeinsamen Essen bewegen sich alle, gemeinsam mit Jesus, allmählich zurück in ihr eigenes Leben, das ihnen gefehlt hatte. Zugleich wissen sie: „ER lebt mit uns!“ ER traut uns unser Leben zu.
Leben auch wir – in Gottes Namen und in seinem Geist der Liebe.
Wer im Namen Gottes lebt, wird von Gott getragen.
Der Sieg der Liebe

Gedanken über fürsorgliche Hände – mit 1. Korinther 16,14
1
Eine Hand, die sich selbst an einer Wand abgedrückt hat. Vielleicht wurde nach dem Abdrücken auch noch mit etwas Farbe und Pinsel nachgeholfen, damit der Abdruck kraftvoll zur Geltung kommt. Auch die Hand selber ist kraftvoll. Und sie hat zwei Farben. Blau als das Zeichen für Tiefe und Treue. Rot als Zeichen der Liebe, des Schmerzes, vielleicht des Opfers. Das Bild ist schlicht, die Geschichte zum Bild ist groß. Unfassbar groß. Dass uns gleich die Geschichte zum Bild einfällt, liegt am roten Punkt in der Mitte der Handfläche – dem Wundmal.
Wir sehen ein Bild von Jesu Hand, durch die ein Nagel geschlagen worden war. So sollte der Körper Jesu am Kreuz festgehalten werden. Jesu offene Wunden sollten dazu dienen, dass er schneller stirbt. Die Hinrichtung war ja an einem Freitag, der Sabbat war nahe. Und Jesu Körper sollte noch vor Beginn des Sabbats begraben worden sein.
2
Mit diesem Bild öffnet sich uns die ganze Geschichte Jesu. Seine helfenden Hände; sein Teilen des Brotes am Gründonnerstag und am Tisch in Emmaus; sein Segnen der Jünger, als er sie in die Welt schickt, damit sie von Gott und Jesus erzählen. Auf vielen anderen Bildern sehen wir ja, wie Jesus segnet: meist mit einer erhobenen Hand.
Der Handabdruck auf diesem Bild zeigt uns aber auch das Innere der Geschichte Jesu. Dieses Innere ist einmal die Treue Gottes – die Treue Jesu zu Gott und die Treue Gottes zu seinem Sohn auch dann, wenn Gottes Handeln nicht zu verstehen war. Zum anderen erkennen wir die Liebe Jesu, mit der er Menschen und Gott begegnet. Die Liebe Jesu geht so weit, dass er sich als Opfer versteht. Ohne sein Opfer würden die letzten Stunden in Gewalt ausarten.
Treue, Liebe, Segen – all das zeigt die hier abgebildete, vielleicht segnende Hand. Die Geschichte der Liebe Gottes und der Liebe Jesu stirbt nicht. Die Liebe stirbt nicht, sie verstummt nur. Aber bald spricht sie dann auch wieder.
3
Ostern ist ein Sieg der Liebe, erzählt uns dieses schlichte und starke Bild. Gott will, dass das Opfer gewinnt und nicht die Gewalt. Gott will, dass der Segen gewinnt und nicht die Rücksichtslosigkeit; dass die Liebe gewinnt und nicht die Verachtung. Die Hand zeigt die Treue Gottes zu Jesu Leben und Liebe. Sie erinnert auch daran, was Hände tun und lassen.
Es gibt ein Gedicht der polnischen Dichterin Wisława Szymborska (1923–2012), die 1996 den Literaturnobelpreis erhielt für ihre Dichtung. Das Gedicht trägt den Titel „Hand“. Es beschreibt die Knochen, Muskeln und Nerven einer Hand und sagt zum Schluss sinngemäß: All das reicht vollkommen aus, um entweder „Mein Kampf“ zu schreiben oder „Pu der Bär“.
Mit unseren Händen, so verstehe ich das, können wir grob sein und vernichten; wir können aber auch einfühlsam sein und Menschen aufrichten.
4
Nach Ostern sollten wir nicht bleiben, die wir sind. Wir sollten uns zur Liebe, zur Fürsorge hin verwandeln. Gott möchte, dass der Segen gewinnt und nicht die Rücksichtslosigkeit. Das dürfen wir uns sagen lassen von der verwundeten und kraftvollen Hand auf diesem Bild. Jesus, der Auferweckte, segnet auch die Jünger, die ihn verleugneten oder die in Panik weggelaufen sind. Jesus erbaut auch Petrus, der immer tapfer redete und dann von nichts wissen wollte. Jesus legt sein Wollen in die Hände und Herzen der Jünger und Jüngerinnen, die eine Weile brauchten, um die Auferstehung zu glauben und zu verstehen.
Jesus lässt sie nicht allein; lässt sie auch heute nicht allein – lässt uns nicht allein, wenn wir uns zur Liebe, zur Fürsorge hin verwandeln wollen. Wir sollten jetzt, nach der Feier des Osterfestes, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Da soll noch etwas sein.
5
Es soll noch so etwas wie ein Schubs sein – und Schubs für unser Herz. Wo kann ich mich – und wie kann ich mich – ein wenig verwandeln hin zu mehr Fürsorglichkeit, zu mehr Zuwendung zu anderen? Wo und wie kann ich mit meinem Herzen und mit meinen Händen Menschen erbauen, aufrichten, statt sie zu übersehen oder zu vergessen? Wo sollte ich auf mein Interesse verzichten, damit mehr Frieden möglich ist?
An Ostern, dem Sieg der Liebe über Schrecken und Tod, gibt uns Gott einen Schubs hin zur Liebe. Und bittet uns (1. Kor 16,14): Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen.
Das Tun des Nötigen

1
Ein ungewöhnliches Bild. Zuerst will man den Augen nicht trauen. Das Bild wird einerseits beherrscht von der Farbe Grün, andererseits von einem Ort, an dem man wohl noch keinen toten Jesus gesehen hat; nämlich Strand und Meer. Der Ort erklärt sich leicht: der in Paris geborene Maler wohnte in seinen letzten Jahren auf der zu Polynesien gehörenden Insel Tahiti, eine französische Kolonie. Dort suchte er das ursprüngliche, unverfälschte Leben. Die beherrschende Farbe Grün auf diesem Bild – es gibt im Werk des Malers auch noch einen „gelben Christus“ – dient einer gewissen Verfremdung. Man hat schon so viele Kreuzabnahmebilder gesehen. Hier sieht man sie, auf das Wesentliche beschränkt, buchstäblich in einem anderen Licht.
2
Der Maler Paul Gauguin hatte in seinem Werk unterschiedliche Malweisen. Eine Zeit lang war er Impressionist und tupfte seine Bilder, später, als er immer einfacher malen und gestalten wollte, nannte man ihn Symbolist. Gerne verfremdete er Gestalten, damit wir im Fremden das Vertraute neu sehen lernen.
Seine Vorstellung, auf Tahiti das ursprüngliche, unverfälschte Leben zu finden, war ein Irrglaube. In der Hauptstadt Papeete lebte die einheimische Bevölkerung in ärmlichen Wellblechhütten, westliche Kleidung hatte die traditionelle Tracht ersetzt, die Landesreligion und Traditionen waren von christlichen Missionaren unterdrückt worden. Die Lebensweise der Oberschicht unterschied sich kaum von der im Mutterland Frankreich. Gauguin setzte sich für die Rechte und Interessen der einheimischen Bevölkerung ein und griff die katholische Kirche an. Sein verletzendes Verhalten brachte ihn in Konflikt mit der Obrigkeit und gipfelte in der Verurteilung des Künstlers zu einer Haft- und Geldstrafe, die aber seine finanziellen Möglichkeiten überstieg. Gauguin war wegen verschiedener Erkrankungen bettlägerig geworden und bekämpfte seine Schmerzen mit Morphin. Er starb mit 54 Jahren und ist auf einer der Inseln Polynesiens begraben.
3
Die Figuren auf dem Bild zeigen eine gewisse Starrheit. Sie sind eher Symbol für das Geschehen, das sie darstellen. Christus ist gestorben, drei Frauen halten ihn, bevor er
in Kürze in eine Grabhöhle gelegt werden wird. Die drei Frauen sind grün wie Christus selbst. Vor dieser Figurengruppe ist eine eher geschäftig wirkende Frau mit einem Tier – sie ist unverfremdet und auch farbig gekleidet wie im richtigen Leben. Dazu noch zwei Unbekümmerte auf dem Weg zum Strand.
Nur die Figurengruppe um Jesus hat diese grüne Starrheit. Sie stellt symbolisch das dar, was damals, am Karfreitagnachmittag, geschehen ist. Christus wird vom Kreuz abgenommen und begraben. Sein Leben ist zu Ende. Geblieben sind noch drei Frauen, die einen Moment still trauern und dann ein letztes, gutes Werk tun. Wie vorgeschrieben musste der Leichnam vor Beginn des Sabbats begraben sein.
Das Geschehen damals können wir uns kaum trostlos genug vorstellen. Der Sohn Gottes verschwindet aus der Welt, sang- und klanglos. Die Jünger sind weg, irgendwo versteckt. Geblieben sind weinende Frauen. Sie tun, was getan werden muss. Ihre Zuneigung ist das Tun der Pflicht. Ansonsten kümmert sich niemand mehr um das, was an diesem Tag am Ölberg geschehen ist.
4
Manchmal ist Liebe das Tun der Pflicht, das sorgsame Tun der Pflicht. Dann kann man nichts mehr gestalten und mit nichts Großem mehr überraschen – man kann nur noch das Werk tun, das getan werden muss. Manche entziehen sich solchen Pflichten. Sie halten sich für Größeres geboren; Pflichten sind ihnen zu gewöhnlich. Für die Frauen unter dem Kreuz Jesu aber sind die Pflichten Liebesdienste. Sie fühlen sich dazu verpflichtet; empfinden es als Form der Liebe, die noch möglich ist. Sie warten auf keine Auszeichnung und auf keinen Lohn. Sie tun das Nötige – und das Nötige ist Liebe.
Sie rechnen mit nichts mehr, die Frauen. Ihre vielen Fragen an das, was geschehen ist, stellen sie hintan. Sie haben zu tun. Auch zwei Tage später haben sie zu tun. Sie müssen wieder eine Pflicht erfüllen und den Leichnam salben. Dann allerdings, am Ostermorgen, trifft sie die ganze Wucht des Himmels.
Das ist die Perspektive! Der Himmel lässt die Liebe auferstehen. Und verwandelt die Trauer der Frauen in Jubel.
Der zerbrochene Krug
Von Repair-Cafés, Weizenkörnern und einer alten japanischen Tradition
Gedanken zum Wochenspruch Johannes 12,24
1
Hier in Castrop gibt es oder gab es zumindest vor Corona ein sogenanntes Repair-Café. Dort werden Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen, kaputte und beschädigte Geräte und Gegenstände mitzubringen, die dann von Mitarbeitenden repariert werden.
Es scheint so, als ob nach langen Jahren der Wegwerfkultur an vielen Stellen ein Umdenken einsetzt. In Japan gibt es eine jahrhundertealte Kunst der Keramikreparatur, die sich genau diesem Ziel widmet. Sie nennt sich Kintsugi, was übersetzt so viel bedeutet wie „Goldreparatur“. Bei dieser Reparatur werden die Bruchstellen der Krüge und Schalen mit einem besonderen Lack neu zusammengeklebt, der mit feinstem Goldstaub vermischt ist.
Dadurch werden die Bruchstellen und Risse nicht übermalt oder kaschiert, sondern – ganz im Gegenteil – besonders hervorgehoben und sichtbar gemacht. Denn in der Kunst des Kintsugi werden die Brüche nicht als ein Makel wahrgenommen. Sie tragen stattdessen dazu bei, dass aus dem neu zusammengefügten Gefäß ein besonderes Kunstwerk wird. Es ist das Leuchten der goldenen Bruchstellen, die das Gefäß zu etwas Besonderem machen. Aus dem Zerbrochenen entsteht etwas Neues, Kostbares.
2
Obwohl Jesus von seiner Ausbildung her vermutlich Zimmermann war, hat er sich doch in seinem ganzen Leben als Meister des Kintsugi gezeigt. Mit einem weiten Herz für Menschen hat er ihre Verletzungen und Brüche liebevoll angesehen und sichtbar gemacht. Offenbar hatte er die Gabe, diese Lebensbrüche zu heilen und zu einem Teil eines neuen Weges zu machen. Sein Werkzeug, sein Goldstaub, war die Liebe – und die Fähigkeit, keinen Menschen aufzugeben. Die große Pointe seiner Botschaft besteht ja gerade darin, dass wir nicht so tun müssen, als hätte unsere Lebensschüssel keinen Sprung. Stattdessen lädt er zu einem wahrhaftigen Lebensstil ein, der sich nicht durch Perfektion und Makellosigkeit auszeichnet, sondern völlig auf das Vertrauen in den göttlichen Goldstaub setzt, der die Teile unseres Lebens zusammenhält.
3
Selbst den größten und ultimativen Zerbruch – den Tod – hat er aus dieser Perspektive der Hoffnung gesehen. Wahrscheinlich hatte Jesus schon seinen eigenen Tod am Kreuz vor Augen, als er zu seinen Jüngern sagte: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“
Im „Sterben“ und Aufbrechen verändert das Weizenkorn seine äußere Form. Aber selbst dieser Zerbruch trägt schon –zunächst noch unsichtbar und unter der Erde verborgen – den Keim eines Neuanfangs in sich.
4
Darin verbirgt sich das tiefe Vertrauen, dass Gott selbst aus dem Zerbruch am Ende unseres Lebens etwas ganz Neues erwachsen lässt. Aus diesem Vertrauen erwächst die Einladung zu einem wahrhaftigen Leben, das die Risse und Verletzungen nicht übermalt oder ausblendet, sondern sie immer wieder in Gottes Hände legt. Daraus erwächst ein Leben, das nicht dem Ideal von Perfektion und Makellosigkeit hinterherläuft, sondern darauf vertraut, dass mein Leben mit allen Brüchen und Scherben in der Hand Gottes steht – dem, so könnte man sagen, großen Kintsugi-Meister meines Lebens.
Licht und Dunkel - Gut und Böse

1
Wie sieht es aus, wenn Gott da ist? Das sind die Jugendlichen gefragt worden und sollten mit Ölkreide ein Bild dazu malen. Niklas malt einen hellen, lichten Punkt umgeben von Dunkel. Wo Gott ist, ist es hell, sagt er, als er das Bild vorstellt. Selbst ein kleines Licht macht das Dunkel hell. Und das Dunkel bleibt nicht dunkel, wenn Gott da ist.
2
Am Anfang, als noch alles dunkel war, beschreibt die Bibel, wie Gott zuerst das Licht schafft: Es werde Licht – und es ward Licht (1. Mose 1,3). Das Licht setzt sich durch. Und dabei gehört doch das Licht mit dem Dunkel zusammen. Finsternis und Licht werden von Gott unterschieden, beide bleiben und haben ihren Platz. Und Gott? Ist er, der das Licht geschaffen hat, nur dort, wo es hell ist?
Meine Erfahrung ist: Gott ist vielleicht immer da, aber ich spüre ihn nicht immer. Es gibt Zeiten, da scheint das Dunkel sich durchzusetzen. Da ist alles dunkel, wüst und leer. Meine Augen sehen den Weg nicht mehr, mein Herz ist betrübt. Zeiten der Dunkelheit.
3
Dunkelheitserfahrungen sind einsame Erfahrungen. Ich spüre Gott nicht – jedenfalls nicht unmittelbar. Ich spüre keine anderen Menschen. Vielleicht spüre ich noch nicht einmal mich selbst. Ich muss mir meinen Weg suchen, tastend und vorsichtig, damit ich nicht stürze. Hat es sich so angefühlt – damals im Garten von Gethsemane? Wie undurch-dringliche Dunkelheit, Einsamkeit und Traurigkeit? Wie hat Jesus es geschafft wieder aufzustehen? Wie gewinne ich die Kraft weiterzugehen, nicht aufzugeben?
4
Wo Gott ist, ist es hell. Das stimmt. Aber vielleicht gilt es andersherum nicht: Gott ist nicht nur dort, wo es hell ist, sondern auch dort, wo es dunkel ist. Vielleicht merke ich es erst im Nachhinein, dass er da war und dabei war. Vielleicht habe ich ihn nicht gespürt. Aber vielleicht erschließt es sich mir: er war dabei, er kennt das Dunkel, er hat es selbst erlitten, und jetzt teilt er es mit mir – und mit jedem Menschen.
Dunkel bleibt dunkel. Aber es gibt Ahnung des Lichts. Es wird nicht immer dunkel sein. Jesus muss es gespürt haben im Garten. Oder Elia unter dem Wacholder. Die Ahnung des Lichts gibt Kraft, wieder aufzustehen und weiterzugehen.
5
Ich denke an den Beginn der Welt. Am Ende war alles dunkel, schreibt die Bibel. Dann ließ Gott seine*ihre Stimme erklingen: Es werde Licht – und es ward Licht. Auch im Dunkel ist Gott da. Niklas hat recht: wo Gott ist, ist es hell. Aber Gott mutet mir eben auch zu, das Dunkel auszuhalten. Mein persönliches Dunkel, das zu meinem ganz eigenen Weg gehört. Das Dunkel der Welt, das ich erleide. Aber Gott kennt das Dunkel. Jesus ist vor dem Dunkel nicht geflohen, sondern ist hineingegangen, als es an der Zeit war. Und darum, allein darum, liegt im Dunkel die Verheißung des Lichts.
Versöhnung - Liebe bedingungslos

1
Eine belebte nächtliche Straße. Menschen sind unterwegs, Fenster sind erleuchtet. Das Leben draußen geht seinen Gang. Innen das Paar. Sie sind dunkel gekleidet und verschmelzen miteinander in einem innigen Kuss. Sie stehen am Fenster und sind doch ganz abgeschnitten von der Welt, die draußen lebt, von den Menschen, die unterwegs sind und ihren Wegen nachgehen. Ihre Gesichter sind einander nah. Die beiden sind unbedingt einander zugewandt.
Die Betrachterin, der Betrachter des Bildes ahnt das Gesicht des Mannes. Das Gesicht der Frau, ihrem Geliebten zugewandt, ist verborgen. In ihrer Hingabe gibt es nur sie beide füreinander.
2
Wie sind die beiden in das Zimmer gekommen? Ist es ihr Zuhause? Besucht einer den anderen? Haben sie sich in einem gemieteten Zimmer getroffen? Was ist ihre Geschichte? Die Unbedingtheit ihrer Umarmung lässt mich an eine Versöhnungs- und Vergebungsgeste denken. So, als suche einer Zuflucht in den Armen des anderen. Wer liebt, ist verletzlich. Und in steter Gefahr, den Geliebten, die Geliebte zu verletzen. Die Liebe ist verletzlich. Zwischen die Geliebten schieben sich eigene Bedürfnisse, eigene Schmerzen, eigene Ängste. Das Leben und seine Herausforderungen bringen Liebende auseinander, lassen sie den Blick füreinander verlieren. Es gibt Zeiten, da sind Liebende einander fremd. Die gemeinsame Geschichte hält sie zusammen, aber es ist manchmal nicht mehr als eine Erinnerung.
3
Liebe gibt es nicht ohne Schmerz. Wenn die geliebte Person sich abwendet, bleibt die Trauer. Manchmal auch Zorn und Verletzung. Dann geh doch, möchte der Verlassene rufen – du wirst ja sehen, was du davon hast. Und wenn die geliebte Person zurückkehrt und um Vergebung bittet … wenn der Weg zurück frei und offen ist … wenn eine versöhnende Umarmung möglich ist … wenn Herzen nicht
hart bleiben, sondern sich einander zuwenden … dann wird Versöhnung möglich. Dann können Liebende einander so küssen wie auf dem Bild. Dann gibt es keine Ablenkungen mehr von außen, sondern nur noch verbindende, erfüllende Liebe. Es gibt keine Garantie. Es ist eine Erfahrung eines geöffneten Herzens.
4
Das Bild vom Kuss am Fenster ist Teil des „Lebensfrieses“ von Edvard Munch. Erst 1918 gibt Munch einer Sammlung seiner Bilder diesen Titel, erzählt aber zugleich, dass eine Idee dazu bereits in den 1880er-Jahren in ihm entstanden sei. 1893 stellte er sechs seiner Bilder unter dem Titel „Studie zu einer Serie: Die Liebe“ für eine Ausstellung in Berlin zusammen. Der Kuss am Fenster ist Teil dieser Sammlung. Anfang des 20. Jahrhunderts wird das Gemälde mit 21 weiteren Werken Bestandteil einer vierteiligen Ausstellung. Es wird in deren erstem Abschnitt „Keimen der Liebe“ verwendet.
Munch hat das Motiv des Kusses in zahlreichen Werken, sowohl Ölgemälden als auch Holzschnitten, verarbeitet. Häufig gibt es dabei einen Kontrast von liebenden Personen und pulsierender Außenwelt. In späteren Ausarbeitungen des Motivs sind die Gesichter des Paares ineinander ebenso verschmolzen wie ihre Körper, was auf ihre innige Zusammengehörigkeit hinweist. Der Künstler selbst war ein Leben lang ehelos und musste sich mit einer psychischen Erkrankung arrangieren. Seine Bilder weisen eine Intensität und eine große emotionale Dichte auf.
5
Versöhnung. Liebe ist bedingungslos zugewandt. Ich kann mir keine Hintertür offen lassen. Es geht entweder ganz oder gar nicht. Ich stelle mir vor, wie eine der beiden Personen um Vergebung bittet, weil sie die Liebe verlassen hat, aus der Beziehung herausgefallen war. Und wie dann, nachdem der Schmerz seinen Ausdruck finden konnte, die Liebe wieder fließt – in einer Umarmung, die Geborgenheit und Vertrauen ausdrückt.
Es bleibt kein Rest. Ein Neubeginn ist möglich. Gott schenkt diesen Neubeginn immer wieder neu.
Land unter

1
Da braut sich aber was zusammen! Dunkle Wolken haben sich über der Nordsee zusammengezogen. Sie sehen aus, als wollten sie die Häuser einschüchtern. Diese wiederum sind eng zusammengebaut, um sich bei Sturm gegenseitig Schutz zu geben. Und sie stehen erhöht auf einer Warft, einem Erdhügel, der höher ist als die höchste Sturmflut, damit sie nicht vom Meer überspült werden. So hoffen es die Bewohner jedenfalls. Sie sind es gewohnt, dass mehrmals im Jahr die Hallig von der Nordsee überspült wird und dass dann nur noch die Häuser auf den Warften aus dem Wasser ragen. Sie nennen es „Land unter“. Und regen sich nicht mehr darüber auf.
Für Gäste vom Festland mag das bedrohlich wirken – die Halligbewohner haben sich damit arrangiert. „Wir haben eine Hassliebe zum Meer“, sagt ein alter Friese, der auf der Hallig geboren wurde. „Wir können ohne das Meer nicht leben. Aber wir mögen es nicht, wenn es durch unser Wohnzimmer fließt!“ Zum Glück hat es schon länger keine schwere Sturmflut mehr an der Nordsee gegeben. Nur: Sicher sein kann man sich da nicht. Eines Tages kann eine Sturmflut auflaufen, die höher ist als alles bisher Dagewesene. Damit müssen die „Halliglüüd“, die Bewohner der Halligen, immer rechnen.
2
Nicht nur Küstenbewohner kennen den Begriff des „Land unter“. Wenn man selber das Gefühl hat, dass im Moment allzu viel über einem zusammenschlägt, dann heißt es auch bei Landratten: „Bei mir ist gerade Land unter!“ Gemeint ist ein Zustand, in dem man die eigene Lage nicht mehr beherrscht, sondern nur noch auf das reagiert, was auf einen einprasselt. Wie gut tut es da, wenn sich nach und nach die Wogen glätten und man den Eindruck gewinnt, dass nun wieder alles unter Kontrolle ist.
Dabei kommt es auch darauf an, was der Auslöser für das „Land unter“ war: Ein stressiger Tag bei der Arbeit, kranke Kinder zu Hause oder eine starke Erkältung? Das ließe sich ja noch ertragen. „Augen zu und durch“, heißt es dann oft. Aber wenn es etwas Schlimmeres ist, was ist dann? Die Diagnose einer schweren Krankheit oder der Verlust eines nahen Angehörigen – das sind Situationen, die sich nicht einfach durch „Augen zu und durch“ bewältigen lassen. Da braucht es mehr. Und vor allem: Es braucht das Vertrauen, dass das Leben trotz allem weitergeht. Herbert Grönemeyer beschreibt das in seinem gleichnamigen Lied, wie ich finde sehr schön:
Der Wind steht schief, die Luft aus Eis.
Die Möwen kreischen stur,
Elemente duellieren sich,
du hältst mich auf Kurs.
Hab keine Angst vor'm Untergehen,
Gischt schlägt ins Gesicht.
Ich kämpf' mich durch zum Horizont.
Denn dort treff' ich dich
Der Himmel heult,
die See geht hoch,
Wellen wehren dich
stürzen mich von Tal zu Tal.
Die Gewalten gegen mich.
Bist so ozeanweit entfernt,
Regen peitscht von vorn
und ist's auch sinnlos,
soll's nicht sein.
Ich geb' dich nie verloren.
3
Von Jesus wird erzählt, dass er mit seinen Jüngern ins Boot stieg und über den See Genezareth fuhr. Als sie mitten auf dem See waren, brach ein Sturm los und ließ die Wellen über dem Boot zusammenschlagen. Die Jünger bekamen Angst. Aber Jesus schlief. Verrückt, oder? Sie mussten ihn wecken. Und als er aufwachte, machte er ihnen noch Vorwürfe: Warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Dann erst befahl er Wind und Wellen, sich zu legen (Mt 8,23-26). Warum erst dann? Hätte er nicht gleich reagieren können, als der Sturm aufzog?
Es hätte den Jüngern vermutlich nicht viel geholfen, um in diesem Leben zu bestehen. Denn Jesus wusste: Das, was noch über ihnen zusammenschlagen wird, wenn er nicht mehr da ist, ist eine Nummer zu groß, wenn sie darauf nicht vorbereitet sind. Die Jünger müssen das Vertrauen beizeiten einüben. Damit sie verstehen: Auch wenn Jesus nicht da ist, sind sie in seiner Hand. Er wird sie nicht dem Verderben aussetzen.
Wenn Sie wieder einmal den Eindruck haben: „Da braut sich was zusammen!“, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie dieses Vertrauen haben: Jesus ist da, auch wenn man ihn nicht sieht und nicht spürt. Und er wird nicht zulassen, dass Sie im Sturm vollends untergehen. Noch mal Herbert Grönemeyer:
Geleite mich heim raue Endlosigkeit,
bist zu lange fort.
Mach die Feuer an,
damit ich dich finden kann.
Steig zu mir an Bord übernimm die Wacht.
Bring mich durch die Nacht,
rette mich durch den Sturm.
Fass mich ganz fest an,
dass ich mich halten kann.
Bring mich zum Ende,
lass mich nicht wieder los
Zuhören

1
Maria und Marta – viele von Ihnen, vor allem Frauen, werden diese kleine Geschichte aus dem Lukasevangelium kennen. Kaum eine Geschichte der Bibel ist von Männern so misshandelt worden wie diese. Ich wähle diesen Ausdruck bewusst. Es waren ja früher ausschließlich Männer, die auf Kanzeln standen und die Heilige Schrift ausgelegt haben. Diese Männer waren oft schnell dabei, Marta zu schelten und Maria zu loben. Sie behaupteten, Jesus habe es so gemeint. Die gleichen Männer, die das von den Kanzeln verkündigten, ließen sich daheim das Dienen und Sorgen ihrer Ehefrauen sehr wohl gefallen und hätten sich vermutlich beschwert, wenn Frauen sich zum Besinnen in die Sessel gesetzt hätten. Das meine ich, wenn ich sage: Kaum eine Geschichte der Bibel so misshandelt worden wie diese. Sie erzählt nämlich keine Lebens-einstellung von Frauen, sondern einen Augenblick.
2
Der Maler Jan Vermeer hat diesen Augenblick meisterhaft eingefangen auf seinem Ölbild, seinem größten Bild überhaupt. Vermeers berühmtestes Bild: „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“, ist eins von nur 37 Bildern, die mit Gewissheit echt sind. Vermeers Leben war eher bitter und von vielen Schulden beherrscht. Er starb nach kurzer Krankheit mit nur 43 Jahren.
Das Bild mit Jesus, Maria und Marta könnte man ein Andachtsbild nennen, vor dem man ein wenig zur Besinnung kommen kann. Maria in kräftigem Rot sitzt zu Füßen Jesu, Marta bringt gerade einen Laib frisches Brot. Jesus sitzt entspannt; er schaut auf Marta und zeigt auf Maria. Was die drei sagen, lesen wir beim Evangelisten Lukas. Marta beklagt sich, dass Maria zu Füßen Jesu sitzt und ihr nicht beim Zubereiten hilft. Jesus sagt seinen berühmten Satz: „Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden.“
3
Der Satz Jesu ist keiner, der für die Ewigkeit gesagt ist. Es gibt Jesussätze, die zeitlos wahr sind. Es gibt aber auch viele Jesussätze, die nur für einen Augenblick gesagt sind. Der Satz, den Jesus hier sagt, ist nicht zeitlos. Er ist für diesen wichtigen Moment gesagt. Der Satz sagt nichts über die Rolle der Frau damals oder heute. Er darf von verkündigenden Männer nicht missbraucht werden – als habe Jesus hier ein für alle Mal angeordnet, was Frauen wann zu machen haben. All das ist Missbrauch der Erzählung.
Jesus geht es um diesen Moment. Er hat gerne in Häusern gegessen und getrunken. Alle diese Essen mussten vorbereitet werden, wohl immer von Frauen. Das hat sich Jesus gerne gefallen lassen. Jesus wird sich auch das Essen, das Marta gerade zubereitet, schmecken lassen. Es bereitet sich ja nicht von alleine zu. Marta tut also Gutes und sorgt vor. Alles das ist wichtig, auch für Jesus. Und dann ist auch noch der eine Moment wichtig, in dem Jesus redet und Marta gerade nicht aufpasst, sondern andere Sorgen hat wie: Wer hilft mir denn jetzt mal? Maria hilft nicht, weil sie zuhört.
4
Es geht in dieser Erzählung ausschließlich um den Moment, in dem Marta besser zugehört hätte, weil Jesus da ist. Es geht nicht allgemein um Sorge, Vorsorge oder Fürsorge. Marta macht alles richtig; Jesus wird sich gleich am Essen erfreuen. Marta ist nur kurz unachtsam. Das muss sie sich sagen lassen. Und Maria müsste sich auch etwas sagen lassen, wenn sie den ganzen Tag träumend auf dem Fußboden säße. Das Leben lebt sich nicht durch Träumen, könnte Jesus dann zu Maria sagen. Und hätte Recht.
5
Maria und Marta ist eine Momentaufnahme, die nicht zu einer Ewigkeitsgeschichte ausgedehnt oder aufgeblasen werden darf. Sie betrifft Männer ebenso. Der Moment heißt: Verpasst nicht, wenn Wesentliches gesagt wird; oder: Lasst die Geschäftigkeiten, wenn es ums Zuhören geht; oder, ganz biblisch: Wenn Jesus spricht, schweigen Menschen besser – und zwar Frauen und Männer.
Die Erzählung von Maria und Marta ist eine Erzählung vom Zuhören im rechten Moment. Auf Gottes und Jesu Worte sollte man immer hören, heißt das. Man sollte keines verpassen. Weil Gottesworte dem Leben dienen. Meinem und Ihrem Leben.
Wer zuhört, lernt viel.
Vor allem über sich.
Aussaat
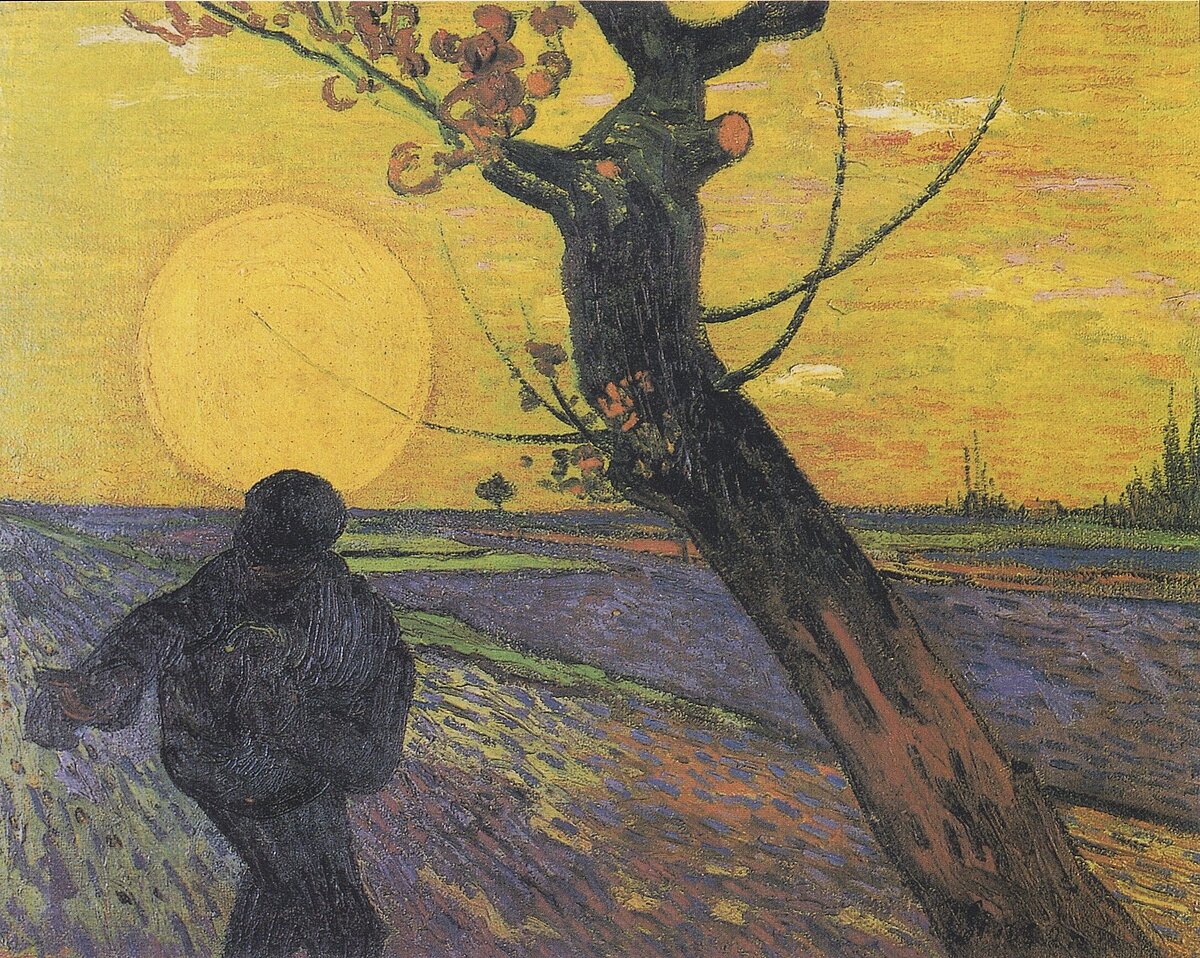
1
So kennen Ältere das Säen noch aus Kindertagen. Ein Mensch hat einen ziemlich schweren Sack um die Schulter, der voller Samenkörner ist. Mit Arm und Hand an der anderen Schulter greift er in die Körner und wirft sie mit einem Schwung aufs Land; in die Erde, wie er hofft. Dabei wird nichts dem Zufall überlassen. Der Sämann hat einen festen, gleichmäßigen Schritt. Bei jedem zweiten oder dritten Schritt wirft er Samen aufs Land. Das ist harte Arbeit. Auf dem Bild geht die Sonne schon unter, was wohl bedeutet, dass der Sämann schon den Tag über gearbeitet hat.
Vincent van Gogh lebte auf dem Land und war ein genauer Beobachter. Körperliche Arbeit war ihm nicht fremd, solange er gesund war. Es gibt andere Gemälde von ihm, die Menschen bei harter Arbeit zeigen, etwa bei der Kartoffelernte. Wenn der Sämann hier auf dem Bild sein Tagewerk getan hat, ist er erschöpft. Und kann nur noch eins tun: Hoffen.
2
Manche Hoffnung erfüllt sich nicht, wie Jesus weiß. Das Gleichnis Jesu vom Sämann ist der Wirklichkeit abgeschaut. Mancher Samen fällt auf den Weg statt in die Erde, mancher Same fällt unter die Dornen am Wegesrand. Auch die Körner, die auf felsigen Grund fallen beim weiten Armschwung des Sämanns, haben keine Chance, zum Korn zu reifen. Vielleicht übertreibt Jesus hier ein wenig, was die Misserfolge des Sämanns angeht, aber im Wesentlichen hat er Recht: Manche Hoffnung erfüllt sich nicht. In den nächsten Monaten braucht es ja auch noch einigermaßen gutes Wetter, um das Korn zur Reife zu bringen. Landwirtschaft, damals noch ohne Maschinen, war körperliche Schwerstarbeit.
Aber auch die Seele zahlte ihren Preis: Manche Hoffnung erfüllte sich nicht. Missernten waren eine Katastrophe und bedeuteten Hunger.
3
Zugleich entlastet uns Jesus mit seinem Gleichnis. Er sagt: Erfolg liegt nicht in unserer Hand. Das Wort Gottes lässt sich niemandem aufzwingen. Menschen streuen es wie Samen auf das Feld – aber dann haben sie nichts mehr in der Hand. Für einen Erfolg können sie nichts mehr tun.
Jesus hat doppelt Recht. Er hat Recht beim Säen des Wortes Gottes – und er hat Recht beim Säen von Worten überhaupt. Ob unser Säen von möglichst guten, hilfreichen Worten Erfolg hat, liegt selten in unserer Macht. Für uns gilt nur: „Redlich Reden“; so redlich wie möglich reden. Und hoffen, dass die Worte ihre gewünschte Wirkung erzielen – dass sie aufs gute Land fallen, aufgehen und hundertfach Frucht tragen.
4
Mit dem Gleichnis vom Sämann möchte Jesus uns entlasten. Für Erfolg sind wir nicht zuständig. Der Sämann gibt sich die allergrößte Mühe; er arbeitet schwer, sehr genau und in allen Belangen redlich. Aber den Erfolg schafft er damit nur bedingt. Und selbst der Same, der auf gute Erde fällt, braucht noch ein Wetter, das ihm hilft. Das beeinflussen wir schon gar nicht.
Unsere Sache ist das redliche Handeln, also die Aufrichtigkeit in möglichst allem. Wir sprechen Worte, die helfen sollen; wir reichen unsere Hände, die unterstützen können; wir bieten die eine oder andere Hilfe an oder nehmen uns Zeit zum Hören – aber über den Erfolg bestimmen wir nicht. Gott allein weiß, was er aus dem machen wird, was wir in Redlichkeit aussäen.
5
Lassen wir uns heute ruhig von Jesus entlasten: Wir hoffen; aber über den Erfolg bestimmen wir nicht. Gott allein weiß, warum manches so geschieht und anderes anders. Gott allein weiß, warum er – in unseren Augen – manchen Samen nicht aufgehen lässt. Denn das gehört ja auch noch dazu: Was wir einen Misserfolg nennen, kann in ein paar Wochen oder Monaten, vielleicht in Jahren, doch noch Früchte tragen, wenn Gott es will. „Erfolg oder Misserfolg“ – dass kann bei Gott etwas anderes sein als in unseren Augen. Noch eine Entlastung, die uns helfen kann.
Helfen bei dem, was allein unsere Sache ist: In Redlichkeit aussäen. Unser Handeln und Reden möge gut überlegt und aufrichtig sein. Mehr können wir oft nicht tun. Doch, eins noch: Hoffen. Hoffen darauf, dass Gott unser Tun in Segen verwandelt.
Wir sprechen unsere Worte redlich und in menschlicher Schwachheit; möge Gott seinen Segen darauf legen.
Ein Bild vom Menschen
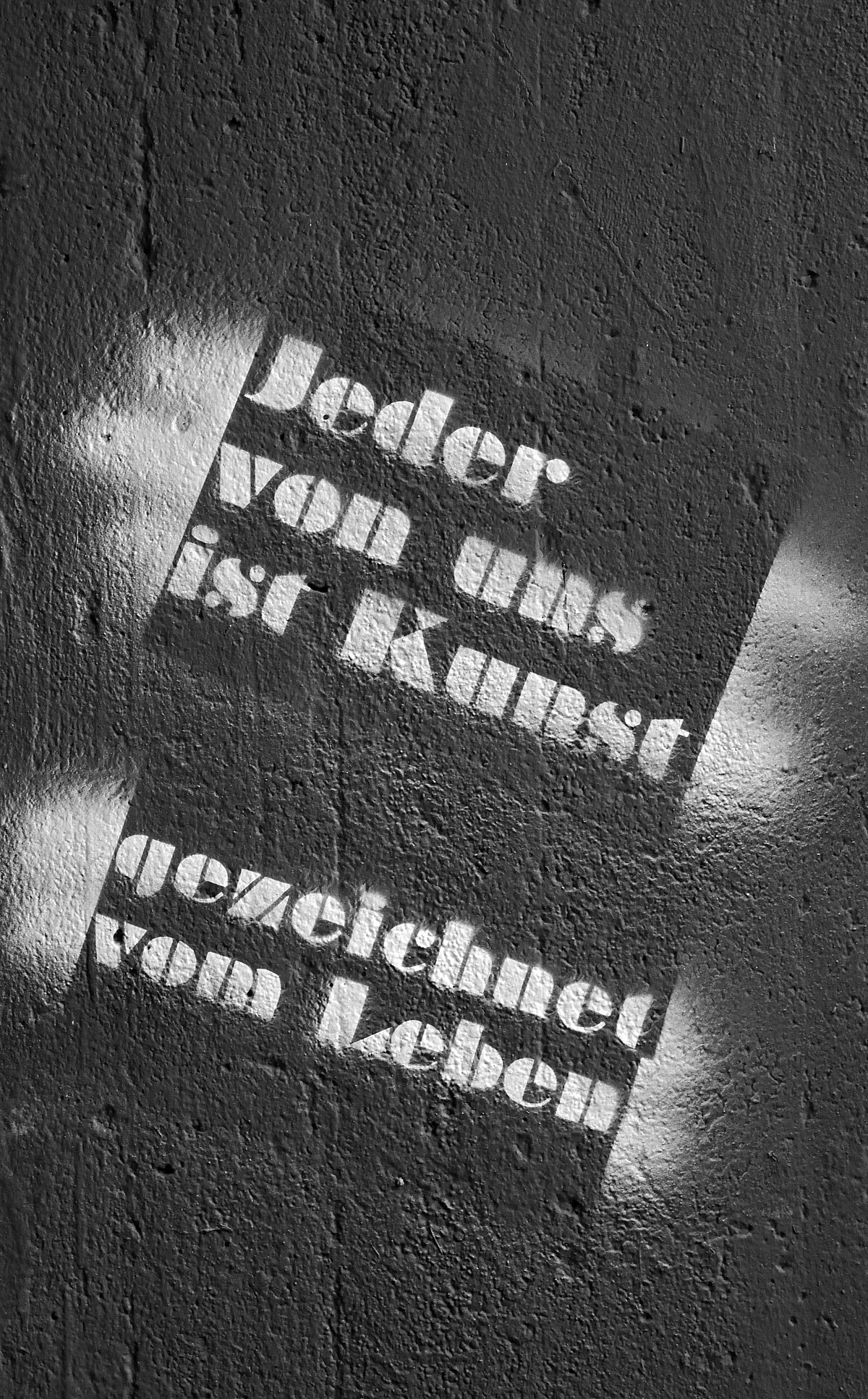
1
Das Bild ist eigentlich ein Text. Aber ein Text, der ein Bild vor unsere inneren Augen malt: ein Bild vom Menschen. Während Jesus oft eher bescheiden, fast schlicht vom Menschen spricht, sagt der Satz hier Größeres über uns: Jeder von uns ist Kunst, vom Leben gezeichnet. Das klingt schön. Und ehrlich. Jeder und jede von uns ist Kunst. Wir sind einzigartig, jeder und jede auf je eigene Weise. Einzigartig deswegen, weil wir vom Leben gezeichnet sind.
Kunst ist immer das Einzigartige, das Unverwechselbare. Kein Mensch gleicht dem anderen. Das ist wahr.
2
Wahr ist aber auch, was Jesus heute vom Menschen sagt. Wir sind nichts Besonderes, sagt er bei Lukas im 17. Kapitel:
Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet, und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt: Komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe; danach sollst du auch essen und trinken? Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr! Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte; wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren.
Wir können uns auf nichts etwas einbilden, wenn wir uns als Kinder Gottes sehen. Ein anständiges, gewissenhaftes Leben vor Gott ist nur unsere Pflicht. Eine manchmal angenehme, manchmal lästige Pflicht. Gott sagt dann nicht: Danke. Weil er ein anständiges, gewissenhaftes Leben von uns erwarten darf. Weil wir Kinder des Gottes sind, der von uns ein Gewissen erwarten darf. Gewissen ist das Tun von Gottes Willen. Mehr sind wir nicht.
3
Natürlich weiß Jesus, dass man mit wenig Anerkennung schlecht leben kann. Keinem Menschen wird es genügen, nur die Pflicht zu tun, um sich dann still und bescheiden zurückzulehnen. Auch wir hoffen auf Wertschätzung; auch wir möchten bedeutend sein dürfen. Wir können nicht leben und dabei nur daran denken, dass wir unsere Pflichten gegenüber Gott erfüllen. Menschen möchten mehr sein als „Pflichterfüller“.
Darum sagt Jesus auch mehr vom Menschen als nur diese Sätze. Etwas früher im Evangelium (Kapitel 15) hat er erzählt, wie ein Mensch seine Pflichten deutlich vernachlässigt. Gib mir mein Geld, mein Erbe, hat ein junger Mann da zu seinem Vater gesagt und ist in die Welt hinausgezogen. Das Geld war bald weg. Der junge Mann musste, wenn er weiterleben wollte, nach Hause zurückkehren. Dort erwartet ihn dann kein Donnerwetter, sondern Liebe. Obwohl er seine Pflichten vollkommen vernachlässigt hatte, hört er keine Vorwürfe. Er hört Liebe. Komm heim, sagt der Vater, als er den Sohn in die Arme nimmt. Und der Vater sagt: Hier gehörst du hin, zu mir und zu deinem Bruder.
Und was genau denkt Jesus nun von uns Menschen?
4
Vermutlich denkt er beides. Wir können uns auf nichts etwas einbilden. Wenn wir anständig und gewissenhaft vor Gott leben, tun wir einfach unsere Pflicht. Zugleich bedeutet das Leben vor Gott aber auch, dass wir ihm einzigartig sind. Wir sind Gottes Kunstwerke, der eine wie die andere. Wir sind vom Leben mit Gott gezeichnet, wie auch immer. Gott macht nicht hässlich, er macht unverwechselbar.
Und was haben wir davon?
Bestimmt haben wir etwas davon, in unserer Seele. Die ist von Gott gezeichnet. Die bringen wir immer mit, wenn wir vor Gott treten in einer Kirche; wenn wir zu Hause die Hände falten. Wir sollen dann wissen, dass Gott Sie und mich, seine Kunstwerke, kennt und schätzt. Wir sind ihm wert. Unter allen Umständen. Selbst wenn wir ihm davongelaufen sind. Wir bleiben ihm wert. Und jeder, jede, die ihr Gewissen wieder entdecken wie der davongelaufene Sohn, hat Gottes offene Arme. Komm heim, sagt Gott denen, die wieder zu ihm finden möchten oder ihn zum ersten Mal finden möchten. Komm heim, hier gehörst du hin.
Wir können ohne Gott leben, aber wir können unser Leben ohne Gott nicht verstehen. Wertvoll sind wir nicht durch das, was wir schaffen. Wertvoll sind wir, weil Gott uns kennt und sieht. Und uns vergibt, wenn wir ihn bitten. Sein Menschenbild ist: Wir sind seine Kunst, die er liebt. Über alle Maßen.
Das große Licht - von weit her

1
Weit gucken kann er von hier aus. Mindestens bis zum Horizont. Die Hände an den Kopf gelegt, lässt er den Blick schweifen. Nach Westen geht sein Blick, dahin, wo die Sonne untergeht. „De Utkieker“ heißt diese Skulptur. Hannes Helmke, ein Bildhauer aus Köln, hat sie geschaffen. Seit 2007 steht sie auf Spiekeroog, auf einer Düne oberhalb des Nordseestrands, dort habe ich sie im letzten Jahr bei einem Besuch auf der Insel entdeckt.
„De Utkieker“ – der Ausschau Haltende. Wonach schaut er? Hält er Wache, so wie es die Widmung am Fuß der Skulptur sagt? Passt er auf, dass der schönen Insel, dass ihrer Natur nichts Böses geschieht? So wie einer vom Burgfried aus Ausschau nach Feinden hält? Ein Wächter sehr hoch auf der Zinne?
2
Wer sich neben den Utkieker stellt, kann ebenfalls bis zum Horizont schauen. Der Utkieker allerdings sieht noch etwas weiter. Kann noch ein bisschen hinter den Horizont gucken, sieht, was wir noch nicht sehen können. Sieht nicht nur die Sonne einen Moment später untergehen, sieht auch schon das Schiff, das kommt, oder das Unwetter, das heraufzieht. Ich sehe was, was du (noch) nicht siehst, könnte er uns zurufen. Würden wir ihm glauben? Wären wir gespannt zu sehen, was kommt, was noch verborgen ist?
3
Es ist schon ein besonderer Ort, an dem diese Figur steht. Unter ihm breitet sich ein weiter Strand aus, der bei Sturmflut ganz schmal werden kann. Um ihn herum zerzaust der Wind die Dünengräser. Wer hier steht, spürt die Elemente hautnah – der Utkieker sogar im wahrsten Sinn des Wortes, denn er ist nackt. Und über ihm der Himmel – tags blau oder bewölkt regengrau, nachts mit dem Sternenteppich bespannt. Wer hier steht, ist sich selbst nah und zugleich seinem Ursprung. Ausgestreckt zwischen Himmel und Erde. Wo stehe ich im Leben? Wer bin ich, wer will ich sein? Was ist mein Grund und wohin geht mein Blick? So lässt sich an diesem Ort gut fragen.
Könnte es sein, dass „De Utkieker“ nicht nur Wache hält, sondern auch Ausschau hält nach Antworten auf solche Fragen? Antworten, die noch nicht da sind, noch verborgen sind hinter dem Horizont. Vielleicht müsste er sich auch umdrehen, eine 180°-Wende machen. Dann würde er die Morgensonne heraufziehen sehen, den neuen Tag. Er würde nicht mehr dem hinterherschauen, was gewesen ist. Vielmehr dem entgegen sehen, das kommt. Morgenglanz der Ewigkeit.
4
Es ist erst wenige Wochen her: Am Heiligen Abend haben wir gehört vom Volk, das im Finstern wandelt und ein großes Licht sieht. Klarheit umleuchtete die Hirten auf dem Feld. Das große Licht, das Gott uns schenkt – es kann mir und dir auch zur Klarheit verhelfen. Und das gilt für alle Situationen meines Lebens. In den sonnigen Tagen, aber vor allem auch in den Situationen, wo ich den Stürmen ausgesetzt bin, wo es rau und ungemütlich wird, vor allem dann, wenn ich nicht mehr klar sehen kann und die Zukunft eher grau und düster aussieht.
So dichtet es Jochen Klepper (EG 379):
Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann.
Von seinem Angesichte trennt uns der Sünde Bann.
Unsterblich und gewaltig ist unser Gott allein,
will König tausendfaltig, Herr aller Herren sein.
Und doch bleibt er nicht ferne, ist jedem von uns nah.
Ob er gleich Mond und Sterne und Sonnen werden sah,
mag er dich doch nicht missen in der Geschöpfe Schar,
will stündlich von dir wissen und zählt dir Tag und Jahr.
Nun darfst du in ihm leben und bist nie mehr allein,
darfst in ihm atmen, weben und immer bei ihm sein.
Den keiner je gesehen noch künftig sehen kann,
will dir zur Seite gehen und führt dich himmelan.
Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann. In diesem Licht stehen und leben, das sei uns gegeben. Bei allem, was war und was kommen wird.
Glaube ist dankbare Liebe

1
Ein großes, rotes Fragezeichen. Unübersehbar, mitten in München vor der Oper, ein beliebter, oft belebter Platz. Der Apostel Paulus liebte solche Plätze. Manchmal stellte er sich auf einen solchen und begann eine kleine Predigt. Das Eigenartige ist: Paulus schämte sich des Evangeliums wirklich nicht. Er war geradezu beseelt davon, möglichst oft möglichst vielen Menschen davon zu erzählen, dass schon der Glaube an Gott gerecht macht. Dass wir nichts leisten müssen, um Gott zu gefallen. Dass wir freudig Ja sagen können zu Gott – und dann in unserer Welt die anderen Menschen achten und fürsorglich behandeln. So einfach ist das mit dem Glauben, predigte Paulus dann.
Wir müssen uns vor Gott nicht in den Staub werfen und um Gnade winseln. Wir haben die Gnade schon. Seit wir getauft sind, sind wir begnadet. Mit Liebe begnadet. Wo wir gehen und stehen, sind wir von Gott geliebt. Und wo wir gehen und stehen, lieben wir einander.
2
Kann das wirklich so einfach sein? Da muss man doch mal ein großes, rotes Fragezeichen dahinter setzen und kurz überlegen, was Menschen alles für ihren Gott tun, damit er ihnen wohlgesonnen ist und bleibt. Das war schon damals so, im römischen Reich und bei den griechischen Gottheiten. Paulus hat sie alle kennengelernt. Er selber war ja Jude und wusste, welche Gesetze es zu erfüllen galt, um Gott gnädig zu stimmen. Überall galt, sich vor Gott ins rechte Licht zu setzen. Man zündete viele Lichter an oder opferte dies und jenes – immer mit dem einen Ziel: Gott möge wohlwollend werden, er möge gnädig auf einen schauen und vor allem gnädig handeln.
Dahinter wiederum setzt nun Paulus sein dickes Fragezeichen und sagt, den Propheten Habakuk aus den jüdischen Glaubensschriften zitierend: „Der Gerechte wird aus Glauben leben“. Das heißt nichts anderes als: Ihr könnt euch Gott nicht verdienen. Ihr müsst es auch gar nicht. Ihr lebt vom ersten Atemzug an wie in einer Umarmung Gottes.
3
Unsere Liebe zur Schöpfung, zu Geschöpfen, zu den anderen Menschen ist keine Leistung, sondern ein Dankeschön an Gott. Danke für das Leben auf der Erde; Danke für die Menschen, die mit uns leben und uns beim Leben helfen; Danke für die Frohe Botschaft, dass der Tod kein Nichts aus uns macht. Also: Danke, dass es Gott für uns gibt und er auf uns achtgibt im Leben und im Sterben.
Wir lieben einander, weil wir danken.
So sieht es Paulus. So schreibt und predigt er es immerzu und kann sogar scheiben (Röm 13,10): „Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung.“ Liebe ist keine besondere Leistung, sondern der besondere Dank an Gott. Das ist Glaube. Glaube ist Liebe aus Dankbarkeit.
4
Und jetzt noch mal – mit einem dicken, roten Fragezeichen: Glaube ist dankbare Liebe? Ist das wirklich so? Ja, das ist wirklich so. Paulus auf irgendeinem Marktplatz in Ephesus oder Athen würde jetzt vielleicht in die Hände klatschen und mit einem strahlenden Gesicht darauf bestehen: Liebe ist keine Leistung; Liebe will Gott nicht gnädig stimmen; die Fürsorge füreinander ist kein gnädiges Zuwenden von meiner Seite – alles das nicht. Mit meiner Liebe zur Schöpfung und den Geschöpfen bringe ich Gott meinen Dank fürs Leben; meinen Dank dafür, dass es mich gibt und dass ich das Leben auch genießen darf. Das darf ich, trotz aller Schrecken. Ich darf genießen. Und meine kleinen Lebensfreuden darf ich dann auch anderen zeigen und sie achten. So gut es eben geht. Und solange meine Kräfte reichen.
Ich muss nicht lange fragen und überlegen. Es geht nicht darum, ob andere meine Zuwendung verdienen. Es geht darum, dass ich damit danken will; danken meinem Schöpfer.
5
Das dicke, rote Fragezeichen auf dem Bild hilft uns ein wenig, auch uns selbst infrage zu stellen und zu fragen: Bin ich Gott recht? Die Antwort des Paulus auf diese wertvolle Frage wird dann lauten: Eindeutig Ja. Und nun geht hin und seid so dankbar wie möglich. Zeige deiner ganzen kleinen Welt deinen Dank. Und sage bitte nicht, du hättest nichts zu danken. Das stimmt vermutlich nicht.
Wenn ich das rote Fragezeichen sehe, sehe ich Paulus, der das Denken auf den Kopf stellt und mich fragt: Dankst du genug? Glaube ist dankbare Liebe. Glaube ist nicht, dauernd zu fragen, ob es Gott wohl gibt und ob es Gott für mich gibt. Das wirst du dann sehen und erkennen, wenn du liebst.
Wer liebt, dem ist Gott nahe.
Suche nach Gottes Nähe

1
Von Zeit zu Zeit finden sich Menschen in Situationen wieder, die sie sich nie gewünscht haben. Sie sehen sich gezwungen, Dinge zu organisieren, von denen sie nicht die geringste Ahnung haben, müssen Verantwortung tragen, um die sie nie gebeten haben, und Aufgaben bewältigen, denen sie sich nicht gewachsen fühlen. Wer solche Lebensabschnitte kennt und sie überstanden hat, kann von Geschenk und vielleicht sogar Gnade sprechen. Wer sie aktuell durchlebt, hat allen Grund zu Klage, Protest und Fluchtgedanken: Wie komme ich aus dieser Situation bloß (heil) heraus?
2
Das Aquarell zeigt unterschiedliche Strukturen. Farben und Formen sind nicht klar voneinander abgetrennt, Gegensätze gehen ineinander über. Deutet die verästelte Struktur im Vordergrund das Thema „Lebenswege“ an? Mose wirkt klein und gebeugt, die karge Welt um ihn herum ist im Vergleich zu ihm selbst riesig. Spontan könnten zunächst Gefühle von Überwältigung, Verlassenheit und Isolation im Vordergrund stehen.
3
In der Betrachtung des Mose fällt auf, dass sein Blick auf Dunkles zu seinen Füßen gerichtet zu sein scheint. Das Dunkle, vor dem Mose steht, mag die ungewisse Zukunft sein, der er sich ausgesetzt fühlt. Verwechselt er seine Ansprüche mit dem Anspruch, den Gott geltend macht? Dass er mit Gott im Gespräch ist, kann man nicht sehen. Dieses Gespräch spielt sich offensichtlich in seinem Inneren ab. Für Außenstehende scheint er nicht ansprechbar. Seine Haltung spricht dafür, dass Mose innehält.
4
Ganz anders dagegen wirken die riesigen Wolken, die Mose umgeben. Dass sie starken Wind verursachen, drückt der trockene, blätterlose Baum aus, der abgestorben aussieht. Verglichen mit diesem toten Baum, dessen Äste nur noch in eine Richtung zeigen, scheint Mose nicht vom Wind betroffen zu sein, sondern in Windstille zu stehen. Steht für ihn nicht sogar die Zeit still? Sein Umhang hängt locker herab. Die Wolkenmassen, die sich ineinander zu fügen scheinen, bilden über ihm ein lückenloses Dach. Unter diesem Dach wird ein Raum erkennbar, den Mose (noch) nicht im Blick zu haben scheint. Im Gesamtbild ist der Ort, an dem Mose steht, der hellste und ruhigste Ort des Bildes. Nur das, was sich oberhalb Moses abspielt, wirkt für sich genommen bedrohlich. Über und hinter ihm ist so etwas wie ein hauchdünner Wolkenstrich zu sehen. Ganz nah, aber nicht zu nahe. Was mag das sein?
5
Not lehrt nicht beten. Not sondert den notleidenden Menschen ab. Von Unwichtigerem. Auch von anderen Menschen. Wer angesichts schwieriger Zeiten das Gespräch mit Gott sucht, geht wortwörtlich ins Gebet hinein. Geht in einen windstillen Raum und greift dort auf eine Ressource zurück, die immer zur Verfügung steht. Gott wirkt ständig und ohne Unterbrechung. Genau deswegen kann jemand, der Gottes Nähe sucht und sich nach seiner Gnade sehnt, davon ausgehen, dass sie im Überfluss, ohne Begrenzung vorhanden ist. Bestimmend ist also nicht der Anlass, zu dem sich ein Mensch bittend an Gott wendet, sondern dass es jederzeit möglich ist, sich Zutritt zu diesem Schutz-Raum zu er - beten.
Siehe, das Lamm des Lebens
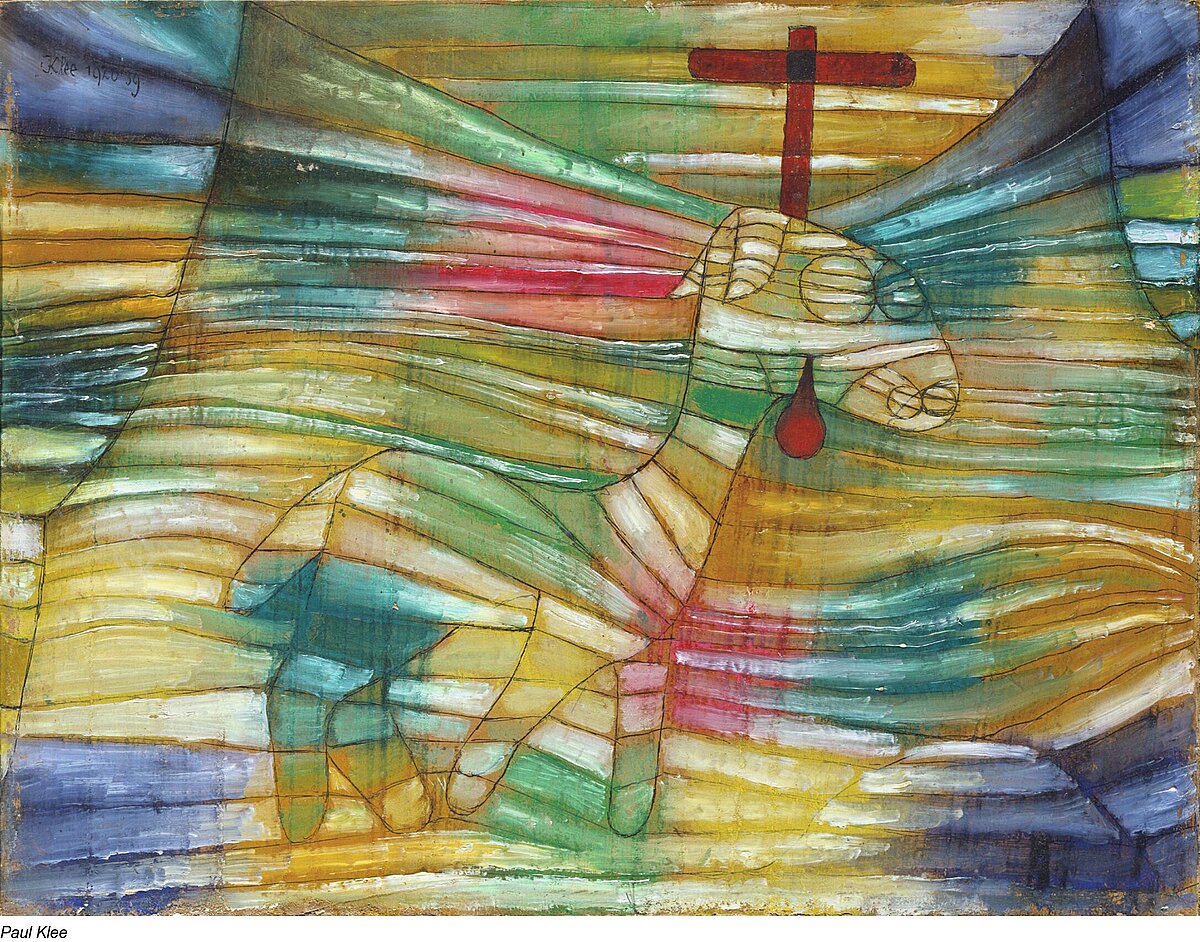
1
„Das Lamm“ – so hat der Künstler Paul Klee dieses Bild genannt. Unschwer kann man die gezeichneten Linien erkennen, die ein Lamm darstellen, auch wenn es mit den Farben der Umgebung fast verschmilzt. Als Paul Klee dieses Bild 1920 malte, hatte er gerade die Farben als Ausdrucksmittel seiner Kunst entdeckt. Das ganze Bild ist bestimmt von geschwungenen Streifen in Pastellfarben, eine bunte Welt aus blauen, grünen, gelben und roten Farbtönen. Das Lamm hat teil an diesen Farben. Es sieht aus, als wandere es mit halb geschlossenen Augen durch diese farbige Welt.
Und doch bleibt etwas Fremdes bei dem Lamm: Ein roter Blutstropfen rinnt über seine Wange, oberhalb des Kopfes erhebt sich ein ebenso rotes Kreuz. Damit bekommt das Bild einen irritierenden Akzent, der das harmonische Spiel der Farben und Linien unterbricht. Vor allem jedoch kann man in Kreuz und Tropfen einen Hinweis darauf sehen, wen Paul Klee hier meint: Das Lamm Gottes, als das Jesus Christus bezeichnet wird.
2
„Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt“ (Johannes 1,29) – so sagt Johannes der Täufer über Jesus. Genau genommen erzählt der Evangelist gar nicht die Taufe direkt, es kommt alles auf das Zeugnis von Johannes dem Täufer an. Das hat seinen Grund: Woran sollte man erkennen können, dass in Jesus Gott selbst in der Welt erschienen ist? Es kann nur dadurch sichtbar werden, dass der Täufer es bezeugt: Dieser ist größer als ich, dieser ist Gottes Sohn, auf diesen sah ich den Geist Gottes herabkommen. Und vor allem: Dieser ist das Lamm Gottes, das uns Leben und Freiheit bringt. So wie zum Passahfest die Lämmer geschlachtet werden. Ihr Blut bedeutet für das Volk Israel Freiheit und Leben. So bringen die Tränen und das Blut Christi uns die Liebe Gottes nah und lassen uns leben. „Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden“, singen wir, wenn wir Abendmahl feiern.
3
„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar“, hat Paul Klee geschrieben. Kunst ist keine Kopie der sichtbaren Welt, sie macht die tiefere Bedeutung sichtbar. So wie die Worte im Johannesevangelium.
Es geht da nicht darum, wie es im Einzelnen vor sich gegangen ist, als Jesus von Johannes im Jordan getauft wurde. Es geht darum, was an tieferer Wahrheit sichtbar wird: Gott erscheint in dieser Welt.
So ist auch das Bild von Paul Klee zu verstehen: Es geht nicht um ein Abziehbild eines sichtbaren Geschehens, es geht um die neue Wirklichkeit, die sich auftut. Die geschlossenen Augen des Lamms könnten darauf hinweisen: Schaut nicht auf die äußeren Dinge, schaut, wie dahinter Neues Wirklichkeit wird. Die Streifen im Hintergrund könnten wie ein Vorhang sein, hinter dem das Kreuz sichtbar wird. Rot ist ja nicht nur die Farbe von Blut und Gewalt, sondern auch die Farbe der Liebe und Hingabe.
4
So wird das Bild vom Lamm zu einem Bild der Hoffnung. Vielleicht hat Paul Klee damit auch seine tiefe Hoffnung ausgedrückt: Nach den Schrecken des 1. Weltkriegs sollte das Leben wieder bunt und friedlich sein. Über allem steht das Kreuz, das Zeichen der Liebe Gottes durch Leid hindurch. Jesus ist gegenwärtig, wenn auch kaum zu erkennen in den vielen Farben der Welt.
Ich frage mich, wo das Kommen Jesu für uns sichtbar wird. Wo erscheint uns die Liebe Gottes? Mir fällt auf, dass auf dem Bild – abgesehen vom Kreuz und dem Tropfen – nur an zwei Stellen die Farbe Rot vorkommt, jeweils in unmittelbarer Nähe zum Lamm. Mir sagt das: Wo ich Hingabe erfahre oder selbst Liebe weitergebe, bin ich dem Lamm nahe.
5
Man hat Paul Klee vorgeworfen, seine Bilder wären kindliche Malerei. Mit dem großen Kopf und nebeneinander liegenden Augen wirkt die Darstellung des Lamms auf den ersten Blick naiv. Das Lamm wandert wie ein selbstvergessenes Kind durch das Bild. Doch damit gewinnt das Bild bei allem inhaltlichen Gewicht eine freundliche Leichtigkeit.
Darum ist es Paul Klee auch gegangen: Mit seiner Kunst bringt er Leichtigkeit in unsere Wahrnehmung, in unser Denken und Leben. Gerade so kann neues Leben sichtbar werden, so kann Gott in unserem Leben erscheinen. Das Bild vom Lamm ist für uns eine Einladung zum Leben.
Weihnachten im Dreiklang

Gedanken zu Josef und Jesaja 9,5
1
Wer ist eigentlich Josef? Diese Frage stellt die große Wochenzeitschrift „Die Zeit“ in der Weihnachtswoche Endlich ist mal Josef zu sehen! Das war mein erster Gedanke, als ich das Bild von Guido Reni sah. Auf so vielen weihnachtlichen Darstellungen ist Josef nur Beiwerk. Er steht meistens ein bisschen hilflos neben Maria herum, verschwindet etwas hinter Ochs und Esel oder sitzt gar draußen vor dem Stall, weil er drinnen keinen Platz zu haben scheint. Aber nicht auf diesem Bild.
Guido Reni schenkt uns eine Szene, die anrührender nicht sein könnte. Josef trägt seinen Sohn auf dem Arm und scheint sein Glück über das Kind kaum fassen zu können. Es ist eine stille Szene – von Engeln, Hirten und Königen keine Spur. Nur Josef mit Kind in wohltuend warmen Farben; beschienen von einem Licht, das von oben her auf die beiden fällt.
2
Das Besondere an dieser Szene ist der Blick zwischen den beiden. Josefs Augen scheinen sich nicht von seinem Sohn lösen zu können. Als könne er nicht begreifen, dass dieses kleine Wesen auf seinem Arm nun wirklich auf der Welt ist und zu ihm gehört. Ganz genau möchte er ihn erkennen. Auch der kleine Jesus sieht seinen Vater an. Zwischen den beiden, dort, wo ihre Blicke sich treffen, entsteht etwas. Das sehen wir, wenn wir auf das Bild schauen. Wir fühlen es, können es aber nur schwer in Worte fassen. Es ist der Moment, in dem Beziehung entsteht. Für diesen Augenblick gibt es nur den anderen, der sich seinen Weg durch die Augen in das Herz bahnt.
3
Auch wir als Betrachter und Betrachterinnen sind wie gefesselt von diesem Augenblick; von dem, was dort geschieht zwischen Vater und Sohn. Es braucht fast ein bisschen Überwindung, sich von den Blicken abzuwenden und noch den Rest des Bildes wahrzunehmen.
Erst dann fallen die Hände auf. Wie zärtlich Josef den Säugling trägt! Fast als hätte er Angst, ihn zu stark zu drücken. Er trägt ihn wie das Kostbarste, was er je in den Armen gehalten hat, und nimmt ihn mit hinein in den Schutz seines Mantels. Auch das Kind hält etwas in seinen Händen. Seine Finger umschließen einen Apfel.
4
Auch wenn es so aussieht, als halte das Kind den Apfel eher beiläufig, ist die Wahl der Frucht von Reni wohl nicht zufällig geschehen. Apfel heißt in lateinischer Sprache Malus – dasselbe Wort bedeutet aber auch böse, schlecht. Dieses Wortspiel hat in der kirchlichen Tradition dazu geführt, dass die Frucht, die Eva im Paradiesgarten vom Baum der Erkenntnis pflückte, mit einem Apfel identifiziert wurde. Der Apfel steht sinnbildlich für die Schuld des Menschen.
Es gibt aber noch eine andere Interpretation des Apfels in der Kunst: Er steht wegen seiner Kugelgestalt auch für Vollkommenheit, Schönheit, für Macht und Herrschaft. Hinter dem Kind mit dem Apfel in der Hand verbirgt sich das Bild, das so schwer zu begreifen ist: Gott legt die Herrschaft über die Welt, mit all dem Guten und Bösen, in die Hände seines Sohnes, der als neugeborenes Menschenkind in die Welt der Menschen kommt.
5
„Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst“ (Jes. 9,5). Liebevoller als in dem Bild von Guido Reni kann man kaum ausdrücken, wie diese Herrschaft ausgeübt wird. Sie vollzieht sich im Sehen, im Halten und im Lieben. Mit diesem Dreiklang wird das noch kleine Jesuskind groß werden und auf die Menschen zugehen. Er wird sie so ansehen, dass sie sich selbst in seinem Blick neu begegnen können. Er wird sie halten, als wären sie das Kostbarste auf der ganzen Welt, und sie so lieben, dass er sich selbst hingeben und in ihnen verlieren wird. Sehen, Halten, Lieben – das ist der Klang von Weihnachten und wie schön wäre es, wenn das auch der Dreiklang wäre, der das Jahr 2023 bestimmen würde.
Der Weg zur Krippe - anders als erwartet

1
Etwas verlegen – geradezu entschuldigend – sagte mir jemand aus der Gemeinde: Ich bin kein häufiger Kirchgänger, aber wenn ich in einer anderen Stadt bin, dann gehe ich als Erstes in die Kirche und schau sie mir an und genieße die Stille und Ruhe. Manchmal sitze ich da eine halbe Stunde. Das tut mir gut.“ Viele Menschen tun das, und es ist schön, wenn die Kirchen einladend und offen sind.
So habe ich es in einer süddeutschen Kirche erlebt. Die Kirchentür war im Frühsommer offen und beim Betreten stand mitten im Gang ein Wegweiser „Zur Krippe“. Doch meine Augen zog es nach rechts. Mich zog gleich ein imposanter barocker Altarraum in den Bann. Goldene Leuchter, hochragende Marmorsäulen, posaunenspielende Engel, über-große Gemälde, lichtdurchflutet durch die Seitenfenster; kostspielig, ausladend, überbordend – und das alles zur Ehre Gottes, dachte ich.
2
Doch hier geht es nicht zur Krippe. Zur Krippe geht es entgegengesetzt nach links, wie das Hinweisschild zeigt. Was für eine Gegenüberstellung: Auf der einen Seite der prunkvolle Altar, um den Glanz und die überwältigende Größe Gottes darin zu entdecken. Auf der anderen Seite ein erbärmlicher Holzstall mit dem herbergslosen Gotteskind, das die Ärmsten der Armen, die Hirten, in rauer Nacht um sich hat. So dachte ich.
Als ich dem Hinweisschild folgte, erwartete mich eine Überraschung. Ich sah zwar einen Esel, suchte aber vergeblich den Stall, die Krippe und nach den Hirten. Dort war nicht die Weihnachtsszene dargestellt, sondern die Szene der Bekehrung des Paulus in Damaskus, wie sie Lukas in seiner Apostelgeschichte erzählt (Apg 9). Paulus, der die Christen verfolgte, wurde vom „Licht des Himmels“ umleuchtet und vom Heiligen Geist erfüllt. Drei Tage lang konnte er nichts sehen. Dann „fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde sehend“ und ließ sich taufen. Aus dem Saulus wird sprichwörtlich der Paulus.
3
Meine Erwartung wurde enttäuscht. Aber irgendwie fiel es mir dann auch wie Schuppen von den Augen: Sollte ich das vermutete Weihnachtsgeschehen vielleicht gar nicht als Zuschauer durch eine Scheibe betrachten, sondern jetzt vielmehr mich selbst befragen, ob die Menschwerdung Gottes in der Krippe zu Betlehem etwas mit mir zu tun hat, ob sie mich ergreift und bewegt wie damals den Apostel Paulus? Schließlich fragte ich mich: Wie, wenn es nicht um ein historisches „damals zu Weihnachten“ geht, sondern um ein heutiges, persönliches Angesprochen- und Ergriffensein? Plötzlich stehe ich selbst wie Paulus bei seiner Bekehrung vor der Frage: Wo stehst du, was siehst du, was glaubst du? Ich werde vom Betrachter zum Angesprochenen.
Der strahlende, leuchtende Prunk auf der einen Seite der Kirche kann mich blind machen. Er kann aber auch Ausdruck tiefer, dankbarer Glaubenserfahrung von Menschen zur Ehre Gottes sein, die den Weg zur Krippe gefunden haben und sich an Christus orientieren.
4
Ich musste damals zunächst schmunzeln und doch hat mich diese Kirche zum Nachdenken bewegt. Sie hat Beides, was unseren Glauben ausmacht „geboten“: Die Freude über die Größe und über alles strahlende Herrlichkeit Gottes und dabei die innere Umkehr nicht vergisst. Das ist es, glaube ich, was auch die Adventszeit ausmachen sollte, dankbarer Freude und innerer Neuausrichtung.
Ein unvergesslicher Blick

1
Eine junge Frau im dunkelblauen Tuch. Helles Gesicht, Blick leicht abgewandt. Eine Hand abwehrend erhoben, während die andere Hand das Tuch vor der Brust verschließt. Die junge Frau erinnert mich etwas an die Schauspielerin Sibel Kekilli, aber dies ist kein Glamour-Bild vom roten Teppich irgendeines Filmfestivals. Kein Bild von heute oder vorgestern, sondern ein halbes Jahrtausend alt – gemalt von Antonello da Messina 1475. Und eine Geschichte, 2.000 Jahre alt.
2
Die Geschichte ist weltberühmt und unzählbar oft gemalt. Hier aber nicht aufwendig erzählt mit großer Bühne, allerhand Requisiten, Architekturkulisse und allen Protagonisten. Kein Raum, keine Kulisse – nur eine Frau, ihre Hände, ihr Blick.
Die rechte Hand erschrickt, wehrt einen unerwarteten Gast ab. Der dynamische Luftzug seiner Ankunft scheint die Blätter des Schriftstücks, in das sie vertieft war, noch aufzuwirbeln. Die Rechte hält ihn erschrocken und irritiert auf Abstand, lässt ihn aber doch seine Botschaft sprechen. Die linke Hand fasst das um den Kopf gelegte Tuch vor der Brust zusammen. Die junge Frau verschließt sich nicht. Sie versucht, bei sich zu bleiben. Übersinnliche Ekstase sieht anders aus. Die Botschaft trifft auf Fragen, auf Zweifel und berührt doch das Herz unter ihrer Linken.
Ihr Blick wendet sich nach innen – als fühlte sie bereits, was eben angekündigt ist: das besondere Kind in ihrem Leib. Die Gesichtszüge entspannt. Die Lippen umspielt ein leises Lächeln. In allem birgt sie sich im blauen Tuch der Treue Gottes. Kein Goldbrokat oder glänzende Seide. Ein schmuckloses Alltagstuch des tiefen Gottvertrauens.
3
Sie haben die Geschichte längst erkannt. Ein Engel kommt und verkündigt der jungen Maria, dass sie schwanger werden und ein Kind gebären wird: Jesus. Sein Reich wird kein Ende haben. Aber wie soll das zugehen? Bei Gott ist nichts unmöglich. Und Maria willigt ein.
Heilsgeschichte reduziert und konzentriert auf eine Figur, zwei Hände und einen Blick. Wer das Bild schaut, ist kein unbeteiligter Zuschauer, sondern mittendrin im Heilsgeschehen, weil ganz dicht dabei und ganz nah dran an Maria. Kein fernes Bühnenstück, sondern überwältigende Beteiligung mit Nähe und Gefühl.
4
Wie sehr unterscheidet sich doch diese unabgelenkte Nähe und solches Gefühl von dem Geschehen im Advent, so kurz vor dem Weihnachtsfest. Ruhe und tiefe Erkenntnis gegenüber möglicher Hast und Hetze – ohne Blick für das Wesentliche. Verinnerlichte Erwartung und leise Vorfreude gegenüber dem lauten und manchmal hektischen Geschenkestress.
Ich wünsche mir nicht nur im Advent mehr von Marias nach innen gerichtetem Blick der leisen Vorfreude. Ich wünsche mir eine bleibendere Irritation über den verheißenen Weltenherrscher, der die bestehende Welt auf den Kopf stellen wird. Wo solche Betroffenheit und beständige Irritation ausbleibt, entfernt sich das Heilsgeschehen wieder von mir, und eine alte, allzu bekannte Geschichte bleibt ein fernes Spiel, das nach den Festtagen schnell wieder vergessen ist.
Aber dieser Blick, den der Maler Antonello da Messina vor über 500 Jahren einfing, dieser Blick ist unvergesslich.
Weniger wollen, weniger erwarten

1
Wir sollten hinten anfangen, die beiden Geschwister zu verstehen. Hinten, mit den in fetten Buchstaben gedruckten Worten der fassungslosen Lucy. Die ruft aus: WAS UM ALLES IN DER WELT IST DAS DENN FÜR EIN BRIEF?!! Vermutlich setzt ihr Verstand kurz aus. Ihr Bruder Linus schreibt dem Weihnachtsmann, dass der in diesem Jahr ruhig mal an ihrem Haus vorbeigehen könne; er, Linus, sei „wunschlos glücklich“. Dies hält er für eine „irgendwie erfrischende Einstellung“.
Lucy offenbar nicht. Sie ist außer sich. Freiwillig auf Geschenke verzichten? Das ist Lucys Sache nicht. Wenn sie etwas dazu tun kann, wird dieser Brief den Weihnachtsmann nie erreichen.
2
Weihnachten ohne Wünsche? Das ist schwer vorstellbar. Die Selbstlosigkeit, in der Linus hier auf Geschenke verzichtet, ist selten. Noch seltener ist sein wunschloses Glücklichsein. Oder ist es vielleicht ein Trick, mit dem er auf sich aufmerksam macht, damit der Weihnachtsmann erst recht zu ihm kommt? Zuzutrauen wäre das dem Zeichner der Peanuts, Charles M. Schulz (1922–2000). Der kennt sich gut aus in Kinderseelen, auch in ihren verschlungenen Pfaden. Und manchmal ist in einem „wunschlos glücklich“ ja noch die leise Hoffnung, ein anderer möge sich bitte etwas einfallen lassen.
Weihnachten ohne Wünsche ist schwer vorstellbar. Es muss dabei nicht immer um Geld gehen. Aber auf friedliche Zeiten, auf eine gemütliche Zeit mit der Familie oder auf Fürsorge und Liebe untereinander hofft man wohl doch.
Und auf Gott irgendwie auch, oder?
3
Natürlich stimmt es: Vieles, was heutzutage für Menschen zum Weihnachtsfest gehört, hat mit dem ursprünglichen weihnachtlichen Geschehen wenig zu tun. Das, was wir den „weihnachtlichen Rummel“ nennen und an dem wir uns oft beteiligen, ist aus Sicht des Stalls von Bethlehem eher fremd. Auch die Unruhe, die viele im Advent ergreift, passt nicht recht zur stillen Anbetung der Heiligen Drei Könige oder zum Lobgesang der Engel.
Aber es sind ja schließlich auch zweitausend Jahre vergangen seit der Geburt Jesu. Da kann man schon mal ein wenig ausschmücken – und Glühwein wird in der Adventszeit so wichtig wie kaum etwas anderes. Eins bleibt ja bei allem, was geworden ist aus der Zeit des Advents: Es gibt eine Sehnsucht nach Heilem, nach heilen Momenten im Leben – eine Sehnsucht nach Gott. In einem biblischen Text zum 2. Advent wird Gott direkt angesprochen – man könnte auch sagen: Gott wird frontal angegangen:
So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung! Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater; denn Abraham weiß von uns nichts, und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater; »Unser Erlöser«, das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, HERR, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind! Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsre Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kundwürde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen! Von alters her hat man es nicht vernommen, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren.
Der ganze Text ist ein einziger Aufschrei. Mit doppeltem Inhalt. Im ersten Teil ist er eine gewaltige Klage, dass auch Gott Verantwortung hat. Im zweiten Teil wird Gott angefleht, zur Erde zu kommen; mitten hinein in das Leben derer, die nach ihm rufen. Die Worte sind ein Schrei nach Gott; er soll heilen, was von uns nicht zu heilen ist.
In dieser Sehnsucht nach Heilem sind schon alle unsere Wünsche und Hoffnungen der Adventszeit umschlossen. Wir schmücken und schenken und beten, weil wir die Nähe Gottes fühlen wollen. Wir suchen einen adventlichen und weihnachtlichen Frieden in und um uns, der höher sein soll als menschliche Vernunft. Das dürfen wir auch hoffen. Wir dürfen von Gott erwarten, dass er „wohltut denen, die auf ihn harren“.
5
Und wir dürfen alles tun, um Gott den Weg zu uns zu bereiten. Ein großer Schritt ist, nicht nachtragend zu sein. Zu möglichst niemandem. Um Gottes willen einen inneren Frieden zu schließen mit sich und dem, was uns im vergangenen Jahr belastet hat. Wir wollen es niemandem nachtragen, möglichst. Wir wollen den Frieden nicht von anderen erwarten, sondern von uns selbst. Wir stehen dann Gott nicht so sehr im Weg, der ja mein friedvolles Herz wünscht.
Noch einen kleinen Schritt zum Heilwerden zeigt mir der kleine Linus auf dem Bild. Ich könnte auf Wünsche auch verzichten, selbst wenn Lucy darüber entsetzt ist. Weniger wollen, weniger erwarten macht mich innerlich freier. Vielleicht bringt es mich auch Gott näher. Ich hoffe es wenigstens und bitte Gott darum. Hilf mir, Gott, könnte ich bitten – hilf mir, einfacher zu werden.
Vielleicht erkenne ich in der Einfachheit besser, wie wohl Gott schon an mir getan hat und noch tut. Vielleicht sehen Wunschlosere klarer, was Gott schon alles erfüllt hat.
Frieden auf Eden

Leise Musik gegen das Kriegsgedröhn
1
Wir schauen auf die gemauerte Ziegelwand einer Kirche und sehen rote Klinker, blaugraues Fachwerk, drei schlichte Fenster und ein nahezu leeres Spendenbarometer für die Sanierung des Kirchturms, die sich wohl noch etwas hinziehen wird. Eine Kirche, wie sie überall stehen könnte.
Erst auf den zweiten Blick fällt der dünne Schriftzug im unteren Drittel der Fenster auf: Friede auf Erden. Die Botschaft ist ordentlich in Schreibschrift geschrieben. Zurückhaltend, nahezu höflich kommt sie daher.
Eine Leuchtschrift, die nicht leuchtet, verkündet die wichtigste Botschaft des Christentums: Friede auf Erden.
2
Nach den Erfahrungen dieses Jahres macht mich der hübsch geschwungene Schriftzug in seiner ganzen Harmlosigkeit beinahe ärgerlich. Wir alle haben die Bilder des Krieges in der Ukraine gesehen, die Zerstörung und die Not, die er mit sich gebracht hat.
Da sollte doch die Friedensbotschaft hell leuchten. Eigentlich sollte sie in fetten Druckbuchstaben grell blinken. Auf jeder Kirche und überall dort, wo das Evangelium verkündet wird - nicht allein als frommer Wunsch, sondern als dringlichste Aufforderung. Mit Ausrufezeichen. Frieden auf Erden!!!
Ich frage mich, wie wir unsere ureigenste biblische Botschaft wieder zum Strahlen erwecken? So, wie es uns vor mehr als 2.000 Jahren verheißen worden ist:
„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er‘s stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.“ (Jes 9,1.4-6)
3
Als ein Licht für die Menschen, die in der Finsternis sitzen, so leuchtete eine junge Ukrainerin Anfang März in unsere Welt hinein. Über die sozialen Medien verbreitete sich ein Video von der Geigerin Vera Lytovchenko. Sie stand in einem eleganten Abendkleid in einem Luftschutzkeller in Charkiw, während die russische Luftwaffe die Stadt angriff, und spielte atemberaubend schön ein ukrainisches Volkslied. Um sie herum saßen die Menschen, die sich in den Keller geflüchtet hatten, und hörten zu.
Geigenklänge, eine vertraute Melodie, gegen das Gedröhn der Stiefel und Bomben. Die Musikerin sagte in einem Interview: „Wir sind in diesem Keller zu einer Familie geworden, und als ich spielte, weinten sie. Sie vergaßen für einige Momente den Krieg und dachten an etwas anderes.“ Das ukrainische Außenministerium teilte das Video von Vera Lytovchenko am 07. März 2022 als Zeichen der Hoffnung.
4
Es ist der erste Advent und wir erwarten den, der uns Frieden bringt. Auf einem Esel zieht er ein in unsere Welt, demütig, bescheiden. So wie der Schriftzug an der Kirche leuchtet und blinkt er nicht. Im Gegenteil. Man muss schon genau hinsehen, um das Königliche in einem Kind zu sehen und das Friedensreich in einem Lächeln und einer ausgestreckten Hand.
Jesus Christus bringt andere zum Leuchten. Sein Licht scheint durch sie hindurch, wenn sie etwas von seiner Botschaft begreifen und lebendig werden lassen. Friede auf Erden – das ist ein großer Satz. Aber mit Gottes Hilfe sehen wir überall auf der Welt kleine Lichter: eine Initiative für Flüchtlingshilfe in Berlin, ein Schulprojekt im Kongo, Saatgut und Wasserpumpen für Sambia, ein Orchester für Israelis und Palästinenser, eine Organisation für Kinderrechte in Paraguay, sauberes Trinkwasser in Vietnam.
Friede auf Erden hat viele Buchstaben. Überall auf der Welt leuchten sie auf, bis auch der letzte Mensch ihre Botschaft lesen und begreifen kann. Darauf hoffen wir.
Eine friedvolle erste Adventswoche wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Der Weg zum Himmel

1
Ein trostloses Bild ist das. Ein Bild vom Vergehen. Hier regt sich kein Leben mehr. Wir sehen nur den Untergang von sechs ehemals leuchtenden Kerzen. Und wie wir darauf sehen, wird uns wehmütig. Jesus hat eben Recht: „Himmel und Erde werden vergehen“.
Ja, der Anblick hat ein wenig von Weltuntergangsstimmung. Alles vergeht. Der November zeigt das mit viel Wucht. Die Natur scheint zu verschwinden – bis auf die nackten Äste, die gerade noch standhalten.
2
Eine gewisse Weltuntergangsstimmung durchzieht auch den biblischen Text für den Ewigkeitssonntag. Es sind Worte Jesu über das Ende von allem. Zum Teil sind es Bildworte – oder gleichnishafte Worte.
Neben den Vorhersagen, die Jesus hier trifft, fällt etwas auf, was nicht so ganz zusammenpasst. Einmal sagt Jesus (V. 30): Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht – um dann aber etwas später (V. 32) zu sagen: Tag und Stunde weiß auch der Sohn nicht. Das ist auffällig und gibt zu denken. Jesus hofft, könnte man sagen, dass mit ihm auch das Ende der Zeit gekommen ist, und zwar „zeitnah“, wie man heute sagt. Gleichzeitig muss Jesus zugeben, dass auch er nicht weiß, wann Tag und Stunde des Hausherrn sind.
Und, wie wir ja wissen, war das Ende der Zeit nicht zu der Zeit Jesu. Himmel und Erde sind noch nicht vergangen.
3
An solchen Worten wie diesen haben sich in den zwei Jahrtausenden seit Jesus allerlei Phantasien entzündet. Das sollte uns nicht wundern. Immer wieder haben Gläubige versucht zu erkennen, wann die Zeit zu Ende geht - und dieses „Jetzt“ war manches Mal: in Erwartung des Jahres 1000; bei schweren Naturkatastrophen oder Seuchen; bei Missernten. Immer fühlten sich Menschen dann wie an einem großen Ende, an einem Ausgelöschtwerden wie auf dem Bild.
Aber immer setzte sich die Zeit fort. Manchmal ging es schleppend wieder aufwärts, manchmal ging es bald steil bergauf mit der Hoffnung. Wenn wir daraus eine Lehre ziehen wollen, dann diese: Über das Ende der Zeit wissen wir nichts. Und ob das Ende der Zeit wirklich ein Weltuntergang ist, ein Verlöschen von allem, wissen wir auch nicht. Was wir wissen können, woran wir uns festhalten können in jeder schweren Zeit, sind die Worte Jesu (V. 31): Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden nicht vergehen.
4
Dann wachen wir doch; halten wir uns einfach fest an den Worten Jesu. „Wer zu mir kommt“, hat Jesus ja gesagt
(Joh. 6,37) und hören wir immer noch gerne als Jahreslosung dieses Jahres, „wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.“ Ein Satz zum Festhalten. Mehr müssen wir erst einmal gar nicht wissen über den Glauben im Leben und das mögliche Ende der Zeit.
Wir können Jesu Hand halten, wenn wir uns an seinen Worten festhalten. Wir können nachdenken und fragen, wie Jesus wohl denken und leben würde, wäre er in unserer Lage. Wir müssen nicht verzagen; wir dürfen hoffen: Auch wenn wir einmal unsere Augen schließen, wird Jesus uns nicht abweisen. Das Ende unserer Zeit und das Ende der Zeit ist nicht das Ende Gottes und seines Sohnes. Wir bleiben gehalten.
5
Halten wir die Hand Jesu ganz fest, indem wir uns an seinen Worten festhalten. Schönere Worte und einen besseren Halt werden wir nicht finden. Jesu Worte vergehen nicht. Ein Satz von ihm liegt mir besonders am Herzen. Ich würde ihn sehr gerne beherzigen (Luk. 6,26): „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht …“
Das wünsche ich mir und Menschen, die miteinander leben. Ich wünsche es mir für alle Menschen, die für andere Menschen Verantwortung tragen: Bringt die Zeit nicht mit Streitereien und Rechthabereien zu, sondern mit größtmöglicher Barmherzigkeit. So viel Zeit hat das Leben nicht, um unerlöst oder verkrampft zu leben in allerlei Konflikten. Nehmen wir uns lieber Jesu Bitte zu Herzen: „Seid barmherzig!“ Wir leben dann entspannter, gelöster. Und können uns vielleicht sagen: Ich habe das mir Mögliche getan, besten Wissens und Gewissens. Ich habe meine Zeit, wann immer es ging, dem Erbarmen gewidmet. Wenn etwas unsere Lebenszeit überstehen wird, sind das unsere Werke der Barmherzigkeit.
Erbarmen ist ein Weg zum Himmel.
Der Welt standhalten

Gedanken zu Lukas 18,1-8
1
Wir schauen hier auf eins der berühmtesten Gemälde des niederländischen Malers Vincent van Gogh. Vermutlich gehört es zu den bekanntesten Gemälden der Welt. Es heißt auch so, wie es aussieht: Sternennacht.
Es ist tiefblaue Nacht mit leuchtendem Halbmond, abnehmend. Die Sterne sind lampionartig; sie strahlen so hell wie Sonne und Mond. Ganz vorne eine dunkle Zypresse, dahinter ein Dorf im Tiefschlaf, eher schemenhaft zu erkennen.
2
Die Entstehung des Bildes, ein Jahr vor dem Tod des Malers, ist Forschern bekannt. Es wurde wohl nach einer früheren Bleistiftskizze gemalt – allerdings nicht vor Ort, sondern in der Nervenheilanstalt, in der sich van Gogh gerade befand, Er hatte sich dort selbst eingewiesen, weil er den Alltag nicht mehr bewältigte. Es heißt, Baum und Dorf auf dem Bild entsprächen etwa dem Blick aus van Goghs Krankenzimmer. Soweit das Wirkliche auf dem Bild.
Zugleich ist eine kräftige Portion Rausch auf dem Bild. Farbenrausch und innere Aufgewühltheit. So sieht sie ja nicht aus, eine Nacht mit Sternen. Die innere Aufgewühltheit des Malers überträgt sich in die Farben und ins Leuchten. Es ist kein ruhiger Abendhimmel zu sehen, sondern eine Art Explosion in Gelb – die wiederum das Blau kräftiger macht, als es in einer Sternennacht tatsächlich ist.
Hier kämpft einer mit allem: mit sich, mit der Nacht, mit der Hoffnung. Dieser Kampf leuchtet auf dem Bild. Es ist Hoffnung und Bedrohung zugleich. Die Weltuntergangsstimmung des Malers überträgt er auf die Leinwand – und lässt zugleich auch erkennen, wie großartig die Schöpfung aus seiner Sicht sein kann.
3
Ein Jahr zuvor hatte van Gogh seinem geliebten Bruder Theo geschrieben: „Mit einem Bild möchte ich etwas Tröstliches sagen, so wie Musik tröstlich ist.“ Das ist van Gogh hier gelungen, finde ich. Zwar erkennt man immer noch das Aufgewühlte, zugleich aber empfindet man durch die berührenden Farben, dass sich der Himmel schützend über einen wölbt. Wir sind behütet. Es sind viele Schrecken in der Welt – es ist aber auch Schutz und Gnade um uns.
Van Gogh wusste sich immer behütet. Der Himmel und Gott waren ihm keine Schrecken. Und auch in seiner Weltuntergangsstimmung, aus der heraus er sich auch das Leben nahm, hatte nichts Gottloses. Er hatte Angst vor der Welt, nicht vor Gott. Über Gott schreibt er das, was er sein kurzes Leben lang machte: „Die beste Art, Gott kennenzulernen, ist, viele Dinge zu lieben.“ Solange sein Bruder Theo ihm helfen konnte, hielt Vincent der Welt stand. Erst als Theo selber in eine gewisse Not geriet, wurde van Goghs eigene Verzweiflung zu groß.
4
Der Welt standhalten – das ist unsere große Aufgabe. Manchmal ist sie spielerisch leicht zu bewältigen, diese Aufgabe. Manchmal tun wir uns unendlich schwer und neigen zur Verzweiflung, vor allem in Kriegszeiten. Vermutlich hat Jesus das alles gewusst, er war ja weder ein Schwärmer noch ein Träumer. Und stellt uns in dem denkwürdigen Gleichnis von der Witwe (Lukas 18,1-8) eine besondere Haltung vor: Lasst im Bitten nicht nach; bedrängt Gott wie die Witwe den Richter; macht Gott viel Mühe. Das ist ein ungewöhnlicher Gedanke – als sei Gott gelegentlich ein wenig schläfrig und müsse kräftig angestupst werden.
Lassen wir hier das Gottesbild beiseite und bedenken wir das Verhalten der Witwe. Auch sie ist in Weltuntergangsstimmung; sie leidet am Unrecht, das ihr widerfahren ist. Dem entkommt sie durch Standhalten. Sie widersteht der Verzweiflung und drängt sich an Gott heran. Das ist der Anfang der Hilfe.
5
Wir halten der Welt stand, indem wir uns festhalten an dem, der außerhalb der Welt ist. Glaube ist Standhalten; Glaube ist, Gott nicht von der Seite zu weichen, unter keinen Umständen. Van Gogh zweifelte an der Schöpfung und hielt sie manchmal für missraten. Er zweifelte aber nie am Schöpfer.
Die Witwe zweifelt nicht am Richter, sie weckt aber seine Sinne. So hält sie stand. Es gibt Wege auch in großer Not. Wir können immer beten; wir können immer lieben; wir können uns immer die Liebe anderer gefallen lassen.
Wenn Gott selbst zu schweigen scheint, spricht er in Gestalt der Liebe.

Gottes Hand hält dich
1
Ein Sommertag in den österreichischen Bergen. Auf der Startwiese der Paraglider herrscht Hochbetrieb: Männer und Frauen fliegen hinab ins Tal. Ihre Gleitschirme leuchten in bunten Farben. Ein bisschen sehen sie aus wie Schmetterlinge, wie sie da leicht und fröhlich ihre Kurven ziehen.
Im Bild ist ein einzelner Paraglider zu sehen. Wir stehen links hinter ihm. Sein Gesicht ist nicht mehr im Bild. Wir sehen ihm nach, wie er aus voller Kraft Anlauf nimmt. Er beugt sich weit nach vorne, lehnt sich in die Seile, durch die er mit seinem Gleitschirm verbunden ist. 27 qm dünne Folie, blau mit grünen und weißen Elementen. Sie knistert leicht, als der Wind hineinfährt und sie entfaltet.
2
Spürst du dieses Kribbeln im Bauch, die Vorfreude auf den Moment, alles hinter dir zu lassen, frei und leicht durch die Luft zu schweben? Der weite Blick über die Berge, komplette Stille in diesem Raum zwischen Himmel und Erde. Unendliches Glück.
So stelle ich es mir vor.
Oder ist da doch eher Herzklopfen und das Gefühl, sich zu überwinden? Dieser Schritt hinein in die Luft, wo mein Leben nur an einer dünnen Plastikfolie hängt – würde ich ihn wagen? Angst oder Freude? Wunsch nach Kontrolle oder der Traum, sich tragen zu lassen? Zuschauer bleiben, mit beiden Beinen am Boden, oder mitfliegen, hinein in diesen wunderschönen Sommertag?
Wie würdest du dich entscheiden?
3
Die Paraglider auf der Startwiese nehmen sich Zeit für den Moment vor dem Start. Sie sind ganz bei sich, voller Konzentration. Spricht die eine oder der andere von ihnen innerlich ein Gebet?
Gottes Hand hält dich. Das ist mein Gebet, das ich dem Paraglider hinterherschicke, als er abhebt. Gottes Hand hält dich, sage ich leise zu mir selbst und bin voller Sehnsucht, mich diesem Wort ganz und gar anzuvertrauen und zu spüren, wie es mich trägt.
4
Mein Glaube an Gott ist wie ein Gleitschirmflug. Will ich den Glauben wagen? Oder bleibe ich lieber mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen? Kann ich vertrauen auf einen Gott, den ich nicht sehen kann? Das braucht Mut.
Und es verspricht auch unendliche Freiheit: Ich lege mein Leben in deine Hand, Gott, und lasse alles hinter mir, was mir schwer auf den Schultern liegt. Die Sorgen um meine Zukunft, meine Verpflichtungen, meine Ängste – ich streife sie ab und fliege zwischen Himmel und Erde. Jubelnde Freude über diese Welt und über mein Leben, sich aufgehoben fühlen, getragen wissen. So möchte ich Gott spüren und an ihn glauben, mit jeder Faser meines Körpers.
Werde ich mich trauen? Und du?
Unverschämte Zuversicht

Gedanken zu Psalm 46
1
Was ist hier eigentlich wo auf dem Bild? Zuerst fallen die kräftigen Farben auf; unten ein mehrfaches Blau, oben im Wesentlichen ein leuchtendes Rot – darin aber auch Bräunliches und Orange. Erst beim genauen Blick auf die großen Flächen fällt etwas ganz Kleines auf, was sich genau in der Mitte des Bildes bewegt: ein Schifflein mit geblähtem Segel und einer Gestalt, die das Boot zu lenken versucht. Das Boot wirkt ein wenig wie eingekeilt zwischen dem bewegten Meer und der Hand, die es zu beschützen scheint.
Das Bild gibt einen Satz wieder, der zum Reformationsfest gehört. Der Satz steht im Psalm 46 und lautet: „Darum fürchten wir uns nicht … wenngleich das Meer wütete und wallte.“
Lesen Sie vielleicht mal den Psalm im Ganzen!
2
Martin Luther hat diesen Psalm geliebt. Vielleicht wegen der geradezu unverschämten Zuversicht, die aus den Sätzen des Psalms strahlt. Luther hat nach diesem Psalm auch ein Lied gedichtet und eine Melodie komponiert (EG 362): Ein feste Burg ist unser Gott. Das ist kein Kampflied gegen die katholische Kirche, wie es früher leider oft verstanden wurde. Es ist ein Lied, das die geradezu unverschämte Zuversicht das Psalms in Worte fasst. In seiner vierten Strophe drückt das Lied aus, was Martin Luther am Herzen lag: Das Wort sie sollen lassen stahn; das heißt: Unser ganzes Vertrauen im Leben – was immer uns auch widerfahren sollte – gilt den Zusagen Gottes.
3
Was ist das: unverschämte Zuversicht? Das ist ein nach vorne Schauen, das sich nicht beirren lässt. Es ist ein Festhalten an der Treue Gottes. Es ist die Hoffnung, dass uns nichts von Gott und seiner Liebe trennen kann. Und es ist ein sich dafür nicht Schämen.
Natürlich bleiben im alltäglichen Leben immer Zweifel, manchmal auch große Zweifel. Bildlich gesprochen wütet und wallt das Meer beinahe täglich – die schlechten oder bösen Nachrichten reißen nicht ab. Auch Berge können, bildlich gesprochen, ins Meer fallen. Wir erleben oder sind Zeugen vieler Tragödien, die Menschen an den Rand des Zusammenbruchs bringen können. Es ist längst nicht alles schön – noch nicht einmal dann, wenn wir gerade etwas
als sehr schön empfinden. Irgendjemand leidet immer. Und wir leiden mit.
4
Dennoch gibt es auch das: unverschämte Zuversicht. Es gibt Hoffnung; und es gibt Menschen mit einer Hoffnung, die sich nicht beirren lässt von wütenden Meeren. Ihre Zuversicht ist immer einen Hauch größer als ihre Zweifel. Ihre Hoffnung ragt aus dem Finsteren heraus und lässt sie ein klein wenig leuchten. Zu diesen Menschen gehörte, neben vielen anderen, auch Martin Luther. Was hat ihn gehalten in den schweren Zeiten? Was hält Menschen einigermaßen aufrecht, auch wenn sie von vielem niedergedrückt werden?
Die Zuversicht hält sie aufrecht, die manchmal unverschämte Zuversicht – die sich nicht schämt, der Hand Gottes über sich immer mehr zu vertrauen als den Bedrängnissen um sie herum. Sie leben ihr Leben, sie tragen ihr Leid, sie seufzen und klagen Gott ihr Leid – und doch wissen sie sich zugleich auf eine eigenartige Weise getragen. Sie fühlen etwas und bekennen: Gott ist größer. Seine größere Macht trägt mich.
5
Das können wir einander nicht beweisen. Aber wir können es Menschen ansehen und können es selber auch ein wenig erlernen. Das geht durch Festhalten am Wort. Davon erzählen Menschen, die in größter Not waren. Sie haben sich sozusagen festgekrallt am Wort. Sie haben den Psalm 23 gebetet: „Der Herr ist mein Hirte“;oder den Psalm 46: „Gott ist unsere Zuversicht und Stärke“. Das immer wieder Sprechen und Festhalten an diesen Worten hat sie etwas beruhigt, getröstet. Vielleicht erst einmal nur für ein paar Momente. Aber immerhin. Sie haben im Dunklen zu einer gewissen Zuversicht gefunden.
Andere haben dann auch noch mehr gefunden, nämlich nahezu unverschämte Zuversicht. Das sind die Menschen, die uns leuchten, trösten, die Lachen schenken und Hilfe anbieten, weil es ihnen selber gerade gut geht. Alle die sind unsere Zeugen, dass wir nicht dem wütenden Meer des Lebens ausgeliefert sind, sondern im Schutz und in der Begleitung Gottes leben. Das sogar dann, wenn sich unsere Wünsche nicht erfüllen.
Die sich an Gottes Wort festhalten, die werden auch von seinem Wort gehalten.
Staunen über das Wunder

Gedanken zur Heilung des Gelähmten
1
Bilderreihen zu biblischen Geschichten finden sich oft in alten Kirchen. Im Mittelalter konnten viele Menschen nicht lesen, so entdeckten sie in den Bildern eine Welt, in der Gott selbst gegenwärtig schien.
Genau das beabsichtigte der Kupferstecher aus Basel, der seit 1616 in Frankfurt am Main und Oppenheim für den Verleger Johann Theodor de Bry arbeitete. Matthäus Merian war offenbar ein tiefgläubiger Mensch. Er beschäftigte sich mit religiösen Fragen. Ihm war bewusst, dass es nicht auf Stand und Wissen ankam, sondern auf den Heiligen Geist, um die „Seligkeit“ zu erlangen. Im Jahr 1630 erschien in Straßburg eine Ausgabe der Lutherbibel, illustriert mit insgesamt 157 Kupferstichen zum Alten und 77 zum Neuen Testament. Etwa 100 Jahre später wurde Merians Bibelzyklus in aufwendiger Weise mit kostbaren Deckfarben von einem unbekannten Künstler koloriert.
2
Dieses Bild Merians stellt die Heilung des Gichtbrüchigen aus dem Markusevangelium dar. Wenn ich dieses Bild betrachte, steht mir die Szene lebendig vor Augen. Eng gedrängt stehen die Menschen im Raum zusammen, um Jesus zu erleben. Plötzlich wird das Dach geöffnet. Das erregt Aufmerksamkeit. Noch halten die Männer, die den Kranken herunterlassen, die Seile fest in der Hand. Alle erwarten gespannt, was als nächstes geschieht.
Das Gesicht des Gelähmten ist vom Leiden gezeichnet. Ängstlich schaut er zu Jesus. Der hat noch keine Augen für ihn. Er richtet seinen Blick nach oben zu denen, die den Kranken zu ihm bringen. Jesus „sah ihren Glauben“ – heißt es im Text. (vgl. Mk 2,5) Um Jesu Kopf glänzt ein Heiligenschein, der die Umstehenden erleuchtet.
3
Gegenüber breitet ein zweiter Mann seine Arme aus. Seine Haltung wirkt fast wie ein Spiegelbild zu Jesus. Das könnte Petrus sein, der voller Ehrfurcht auf das Wunder wartet, das gleich geschehen wird. Rechts von ihm eine Frau.
Ihre ausgestreckte Hand und ihr liebevoller Blick scheinen einen freundlichen Segen zu den Gefährten des Kranken zu schicken. Als wolle sie sagen: „Das habt ihr gut gemacht. Gott segne euch für eure gute Tat!“ Ich sehe sie als Maria Magdalena an.
Hinter Petrus und Maria Magdalena stehen zwei grimmig blickende Männer. Der eine scheint dem anderen etwas zuzuflüstern. Ob das die Schriftgelehrten sind, die kritisch auf das schauen, was Jesus tut und sagt?
Interessant sind auch die Personen im Vordergrund: Eine Frau sitzt auf einem Kissen. Sie blickt zur Seite, während sie gleichzeitig nach oben zeigt. Als wollte sie sagen: „Das kann doch nicht wahr sein. Das glaube ich jetzt nicht.“ Neben ihr kniet ergriffen ein Mann. Er erinnert mich an die Hirten an der Krippe. Vielleicht sind es die Gastgeber, die Jesus in ihrem Haus empfangen, ihm Herberge geben? Neben Jesus fällt ein Mann zu Boden. Das Geschehen haut ihn einfach um.
Keine Person im Raum ist ohne Emotion. Jedes Gesicht spricht Bände. Von Entsetzen bis Ergriffensein ist alles dabei. Die großen Gesten und die differenzierte Mimik stehen für starke Gefühle.
4
Wo finden Sie sich wieder in diesem Bild? Näher dran am Geschehen bei den Jüngern und Jüngerinnen, eher unbeteiligt am Rande oder gar bei den Kritikern und Zweiflern? Oder bei den Freunden auf dem Dach? Sie haben die Fäden in der Hand, vertrauen darauf, dass Jesus ihrem kranken Freund hilft. Ein bisschen erinnern sie mich an Engel. Engel, die den, der es aus eigener Kraft nicht schafft, zu Jesus tragen.
Ich frage mich, wann ich jemals so ergriffen gewesen bin, wie die Menschen hier im Bild. Und ich wünsche mir, dass Jesus mein Herz berührt und zum Staunen bringt über die Wunder in meinem Leben. Von ihm geht Heil und Segen aus und erfüllt alle, die auf ihn vertrauen.
Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Gott leuchtet, wo wir lieben

1
Das Bild hat etwas Anrührendes – und zugleich etwas Armseliges. Am schlimmsten ist, dass dieser Zettel noch da liegt, der auf den „Christlichen Büchertisch“ verweist. Ein Tisch mit rohen Holzplanken, der in der Sonne steht und leer ist. Einfach leer, als hätte Gott nichts mehr zu sagen.
Das Bild erinnert an etwas, was wir ja erleben: Kaum jemand interessiert sich für „das Christliche“. Die Angebote der Gemeinde werden entweder nicht beachtet oder machen kaum jemanden neugierig. Die Kirchen, so alt und schön sie manchmal sein mögen, sind sonntags oft leerer, als sie sein sollten. Dörfer mit prachtvollen alten Kirchen müssen darüber nachdenken, ob es außer Gottesdiensten und Amtshandlungen noch andere Möglichkeiten gibt, die Kirche zu nutzen. Viele Kirchen sind schon „umgewidmet“, Gemeindehäuser oder Pfarrhäuser verkauft. Die Kirche, könnte man sagen, zieht sich aus der Welt zurück.
Oft wirkt es, als sei oder werde das Christliche abgeräumt.
2
Nein, wir sollten das nicht bejammern. Aber ehrlich ansehen und aussprechen sollten wir es schon. Wir spüren oder hören es an vielen Orten: Zusammenlegungen, Streichungen, Aufgabe von Diensten, die früher selbstverständlich waren. Hinzukommt ein wahrer Teufelskreis: Konzentration von Arbeit bedeutet oft nicht, dass sie besser wird; die geringere Zahl von Gottesdiensten bedeutet nicht, dass in die verbleibenden Gottesdienste mehr Menschen kommen. Es gibt Ausnahmen, natürlich. Es gibt die sogenannten „Leuchttürme“, die dann für einige Zeit ausstrahlen, bevor auch sie wieder verlöschen. Große Kirchentage, Gemeindefeste, Kirchenkreismissionen, Gottesdienste auf der Bundesgartenschau oder musikalische Ereignisse, die vom Glauben erzählen. Dann sind Stühle, Bänke und Tische voll. Aber Alltag ist das nicht.
Alltag ist oft das Seufzen, weil wir mit dem Christlichen auf dem Rückzug sind.
3
Genau da hinein spricht ein wunderbarer biblische Text aus dem 5. Buch Mose. Die fünf Bücher Mose sind nicht von Mose allein verfasst, diesem gewaltigen Gottesmann, der das Volk Israel aus Ägypten führte. Vermutlich sind die Bücher Mose erst nach dessen Tod entstanden, um die Geschichte des Volkes aufzuschreiben, damit sie für Jüngere nicht in Vergessenheit gerät.
Und gegen Ende der Geschichte des Auszuges aus Ägypten, als das Volk Israel dem Gelobten Land schon nahe ist, kommt noch einmal eine große Zusammenfassung dessen, was es mit den Geboten, den Worten Gottes auf sich hat: Lesen sie vielleicht den Text aus 5. Mose 30, 11-14 noch einmal.
4
Das ist zeitlos schön und zeitlos wahr. Was immer wir aufgeben oder aufgeben müssen – eins bleibt: das Wort Gottes. Das Wort von der Liebe zur Welt, von der Liebe Gottes zu Menschen, von der Liebe der Menschen zu anderen Menschen. Das Wort Gottes ist nahe bei uns – als Taufspruch, als Konfirmationswort oder Trauspruch, als Wort zum Begräbnis. Und als ein Satz, dem Wochenspruch dieser Woche, der klarer nicht sein kann (1. Joh. 4,21): Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott, liebt, dass der auch seinen Bruder und seine Schwester liebe.
So sind Gott und Jesus in der Welt und bleiben in der Welt: als Worte, die leuchten und uns einen Weg im Leben zeigen. Wir mögen viele Formen der Kirche verändern oder aufgeben müssen – das Wort geben wir nicht auf. Gott ist nahe bei uns in seinem Wort. Er ist nicht nur ferne im Himmel oder jenseits des Meeres. Er ist in unseren Herzen durch seine Worte der Liebe.
5
Wir, die wir hier sitzen und hören, nachdenken – wir hier sind die Lebendigkeit des Wortes Gottes, die Lebendigkeit seiner Liebe. Bei allem, was uns traurig stimmt über das abgeräumte Christliche, bleiben doch: Wir. Wir leben Gottes Wort. Wir prägen unsere Umgebung mit seiner Liebe. Wir Menschen sind sein Wort in unserer Welt. Das ist viel. Das lassen wir uns nicht nehmen und nicht wegräumen.
Wir zeigen der Welt, dass es Gott gibt. Gott beweisen die, die lieben. Wer liebt, dem ist weniger bange vor der Zukunft, vor der eigenen und vor der der Kirche. Wie wir lieben, so zeigt sich Gott – uns und anderen.
Das Christliche ist nicht Gebäude oder Büchertisch oder Gemeindehaus; das Christliche ist Liebe zum Bruder und zur Schwester. Gott leuchtet, wo ich liebe.
Willkommen

1
Der Aufsteller auf dem Bild gehört zu einem Café mit Außengastronomie direkt am See. „Welcome“; „Willkommen“. Bei meiner Spazierrunde am Kemnader See komme ich gerne an diesem Aufsteller vorbei. Jedes Mal lese ich aufs Neue, was auf der Tafel steht. „All sizes. All colours. All cultures. All genders. All beliefs. All religions. All ages and types. All people. Love lives here!“ Zu Deutsch: „Alle Größen. Alle Hautfarben. Alle Kulturen. Alle Geschlechter. Alle Glaubensrichtungen. Alle Religionen. Alle Altersgruppen und Typen. Alle Menschen. Liebe lebt hier.“
Da hat sich jemand die Mühe gemacht, alle Unterschiede aufzuzählen und keinen zu vergessen – damit sich wirklich alle, die vorbeikommen, eingeladen fühlen.
2
„Welcome“; „Willkommen.“ Heute folge ich der Einladung und reihe mich in die Schlange ein, die sich vor der Verkaufsbude gebildet hat. Ich schaue mich um, wer außer mir seinem Kaffeedurst, seiner Lust auf Eis oder einem Stückchen Kuchen gefolgt ist. Vor mir stehen junge Eltern mit zwei kleinen Kindern, die herumwuseln. Vor ihnen drei Frauen mit Kopftüchern, davon eine ältere. Sie könnte die Mutter der beiden jüngeren Frauen sein, sie unterhalten sich lebhaft auf Türkisch und lachen. Davor zwei Männer mittleren Alters in Joggingmontur, die das Angebot studieren, und ganz vorne zwei junge Paare mit Rollerskates, die gerade ihre Bestellung aufgeben.
3
Da ich nur langsam vorrücke, schweift mein Blick umher. Ich entdecke auf den Bänken und Sitzen rund um die Verkaufsbude eine bunte Mischung unterschiedlicher Menschen. Ich höre polnisch, russisch, türkisch und eine Sprache, die ich nicht kenne. Manche Gäste haben eine dunkle Hautfarbe.
Ein älteres biodeutsches Ehepaar in meiner Nähe lässt es sich schmecken. Die beiden wirken entspannt. Von den weiter entfernten Plätzen am See dringt Gelächter von einer Gruppe Studierender herüber. Mittlerweile bin ich an der Reihe, bestelle einen Latte Macchiato und werde gefragt, ob ich Hafer- oder Kuhmilch nehme. Vegan lebende Menschen sind also auch willkommen.
4
Ich suche mir einen Platz mit Blick auf den See und den Aufsteller. Ich lese ihn mir noch einmal leise durch. „All people.“ erinnert mich an das Lied “Imagine” von John Lennon. “Imagine all the people livin‘ life in peace… imagine all the people sharing all the world”; zu Deutsch: „Stell dir vor, alle Menschen lebten in Frieden… stell dir vor, alle Menschen teilten die Welt.“
Ich lehne mich zurück, nehme einen Schluck Latte Macchiato und schaue mich um. So einfach kann das Leben sein, so entspannt, so heiter. Ich fühle mich wohl inmitten der unterschiedlichen Menschen, die es sich heute hier gut gehen lassen und das Leben in diesem Augenblick genießen so wie ich.
5
Ich erinnere mich an die Kinderbibelwoche, die wir gerade beendet haben, Farben sind das Kleid Gottes, - Gottes Welt ist bunt, Gott liebt die Welt in ihrer Verschiedenheit, für dene und jede ist er da, das haben wir den Kindern mit auf den Weg gegeben.
In diesem Café würde es Gott gefallen, denke ich so vor mich hin. Schließlich lebt hier die Liebe. Vielleicht sitzt er ja unerkannt unter uns und lässt es sich gutgehen zwischen all seinen Menschen. Vielleicht lächelt er und freut sich, dass es an diesem Nachmittag an diesem Ort gelungen ist, friedlich miteinander das Leben zu genießen. Fast wie im Paradies.
Ich lächle auch. Was für ein wunderbarer Ort, was für ein wunderbares Café. So einfach geht Liebe manchmal, denke ich. So schön und unkompliziert kann das Leben sein. In einem Gartencafé an einem Sonntagnachmittag.
„Welcome“; „Willkommen.“ Ich breche wieder auf und freue mich schon auf meinen nächsten Besuch.
Dank ist Demut

Gedanken zum Gleichnis vom reichen Kornbauern (Lukas 12,16-21)
1
Hier hat es jemand nötig, könnte man sagen. Nötig, den Dank sozusagen hinauszuschreien. DANKE JESUS steht schräg auf einem hochpreisigen, schwarzen Auto. Unübersehbar sind die Buchstaben und der Dank selbst dann, wenn der Wagen schnell an einem vorüberfährt.
Man kann sich, wie oft im Leben, Unterschiedliches dabei denken. Man kann denken, dass es hier einer nötig hat, Dank zu bekunden; dass ihm oder ihr Jesus so ans Herz gewachsen ist, dass das Herz gleichsam überläuft vor Dank. Man kann aber auch ein gewisses Mitleid mit dem Menschen haben, der Jesus geradezu riesig auf sein Auto kleben muss. Denn nicht alles, was unbedingt raus muss, ist auch angenehm zu lesen oder zu hören für andere. Schließlich kann man in dem DANKE JESUS etwas Protziges erkennen im Sinne von: Seht her, was Jesus mir möglich macht; nämlich ein hochwertiges Auto – und was habt ihr anderen?
2
Warum macht jemand so etwas? Nehmen wir das Beste an. Das Beste ist ein Gefühl von Gnade, die der Besitzer oder die Besitzerin des Autos empfindet. Mir wurde, heißt das dann, die Gnade zuteil, so ein Auto kaufen und fahren zu können. JESUS persönlich hat mir dabei geholfen, so viel zu verdienen, dass ich mir das leisten kann. Dann kann man sich für diesen Menschen und für sein Empfinden von Gnade freuen – und kann immer noch ein wenig peinlich berührt darüber sein, dass hier jemand meint, das mit dem Dank auch ganz laut sagen zu müssen.
Muss Dank so laut sein?
Nein, natürlich nicht. Nachdem ich das Auto ein paar Mal in unserem Stadtteil gesehen hatte, hatte ich mich an den Anblick gewöhnt; und mein Gefühl einer gewissen Peinlichkeit hatte sich gelegt. Und je länger ich über all das nachgedacht hatte, desto näher rückte sich mir das Auto und der Dank an die biblische Erzählung vom reichen Kornbauern (Lukas 12,16-21). Der ist auch eins, nämlich laut.
3
Allerdings ist er nicht laut gegenüber Jesus, sondern gegenüber seiner eigenen Seele. Der Bauer sieht seinen gewaltigen Besitz in vielen Scheunen und sagt dann: „Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat … habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut!“ Der Bauer lässt alle an seinem Wohlstand teilhaben: erst baut er große neue Scheunen, dann klopft er sich auf die eigene Schulter und lobt sich für die Gnade.
Das ist das Problem am Dank. Man sollte mit ihm nicht protzen. Man sollte nicht stolz sein auf seine Art zu danken. Hier ähneln sich der Dank für das hochwertige Auto und der Dank für die neuen Scheunen des Kornbauern. Alle sollen den Dank unbedingt sehen; alle sollen sie dankbar sehen.
Man darf aber nicht stolz sein auf seinen Dank. Dann ist es keiner mehr. Dann streift der Dank den Hochmut.
4
Dank ist Demut. Man kann nicht stolz sein auf seinen Dank – oder auf die Gnade, die man erfährt. Das hat etwas seltsam Hochmütiges. So kommt es mir bei dem lauten Dank auf dem Auto und dem lauten Stolz des Kornbauern vor. Danken sie wirklich – oder wollen sie vor allen Dingen anderen ihren Dank zeigen?
Das können wir nicht beurteilen; aber wir können auf die Gefahr hinweisen. Lauter Dank steht immer in der Gefahr, dass sich Eigenlob hineinmischt: Seht her, wie dankbar ich bin. Man darf aber nicht auch noch stolz sein auf seinen Dank. Dank darf nicht laut sein.
5
Dank ist Demut; und Demut ist leise. Weil Gnade leise ist.
Wir werden nicht herausfinden, warum sich jemand die Buchstaben DANKE JESUS aufs Auto kleben lässt. Wir nehmen das Beste an: Er oder sie ist dankbar für die Möglichkeit, dieses Auto fahren zu dürfen – diese Gnade im Leben erfahren zu dürfen. Dennoch bleibt ein seltsames Gefühl: Warum muss der Dank so protzig auf einem hochwertigen Auto stehen? Würde man das auch auf einen Maßanzug oder ein Ballkleid kleben lassen?
Dank sollte leise sein; es muss ihn niemand mitbekommen oder gar mit der Nase darauf gestoßen werden. Was Gott mir Gutes tut, empfange ich dankbar und in aller Stille. Gott, dem aller Dank gebührt, braucht meinen Dank nicht auf einem Auto zu lesen. Ihm genügt es, wenn ich ihm im Stillen meinen Dank für die Gnade überbringe und dann an andere weitergebe.
Schön wäre es, ich öffnete meine Scheunen und ließe andere an meiner Gnade teilhaben.
Lasten leichter nehmen

Gedanken über einen eher sorglosen Christus
1
„Einer trage des anderen Last“ – das klingt sehr mühsam und anstrengend. Das klingt auch nicht motivierend oder einladend, sondern eher deprimierend: Das klingt so, als ob sowieso niemand glaubt, dass das was bringt oder nützt oder hilft. Aber als guter Christ – und als evangelischer noch dazu – möchte man so etwas weder denken noch sagen, sondern packt dann eben wieder mal einmal mit an. Und hinterher ist man dann froh, dass es vorbei ist und dass man ja irgendwie auch was geschafft hat: Den Mühseligen und Beladenen geht es jetzt ja etwas besser.
2
Ich war angenehm überrascht, in der Kirche von Rättvik am Ufer des Siljansees in Mittelschweden einen Christus auf dem Altar stehen zu sehen, der seine Last leichter zu nehmen scheint. Sehr souverän hält dieser Christus mit der einen Hand das Kreuz – und spendet mit der anderen Hand eher beiläufig noch seinen Segen. Da wird nicht geweint oder geschwitzt oder geblutet; da wird noch nicht einmal gelitten und auch nicht gestorben – aber das Kreuz wird auch nicht versteckt oder verschwiegen. Allerdings wirkt dieses Kreuz kleiner als üblich und ist deshalb vielleicht auch leichter als gewöhnlich.
3
Dieser Christus hat eine ungewohnte Ausstrahlung. Sein Blick mit erhobenem Kopf wirkt gelassen und konzentriert und schaut über mich hinweg zu einem Horizont, den ich nicht überblicke. Sein Körper macht einen beinahe athletischen Eindruck es ist nicht dieser leidende Christus, den wir von so vielen anderen Bildern kennen.
Bereitschaft zum Aufbruch spricht aus seiner Körperspannung; vielleicht sogar Tatendrang. Das Kreuz in seiner linken Hand jedenfalls lastet ihn nicht aus. Er hält es fest, aber ohne jede Anstrengung und vielleicht auch nur, damit das Kreuz nicht umkippt. Seine andere Hand baumelt lässig entspannt; der Segen wird nicht persönlich gespendet, sondern großzügig verteilt: Es ist genug für alle da.
4
Genauso großzügig ist auch Jesu Umhang geschnitten: kein verschämtes Tüchlein im Beckenbereich, sondern locker, leicht und luftig fällt ihm der Stoff über die Schultern, passend übrigens zum Haar. Dieser Christus steht auch nicht mit beiden Beinen fest auf dem Boden, geschweige denn, dass er aufgehängt wäre. Ihm reicht ein Standbein, um sein Spielbein frei zu haben für einen nächsten Schritt – ob mit Kreuz oder ohne, das werden wir sehen.
Wobei es eigentlich gar nicht so wirkt, als ob das Kreuz ihn störe. Warum sollte es? Es ist ein goldenes Kreuz: eher ein Schmuckstück in der ansonsten schlichten Farbgebung. Nein, um diesen Jesus muss man sich keine Sorgen machen. Der schafft das, was er sich vornimmt. Allerdings wirkt er bei dem, was er gerade im Kopf oder auf dem Herzen hat, auch nicht hektisch oder eilig. Vielleicht überlegt er, was als Nächstes zu tun wäre.
5
Und vielleicht senkt er dann doch seinen Blick zu uns und fragt, ob wir mitmachen. Ich würde es tun.
Deswegen bin ich auch nicht verwundert, was für ein Gedenkstein neben dieser Kirche mit dieser Christusfigur steht: ein Denkmal für Gustaf Erikson Wasa. Diesen Familiennamen kennt man vielleicht vom Knäckebrot oder vom Skilanglauf. Das passt beides, denn Gustaf kam aus einfachen Verhältnissen und musste weite Wege gehen – äußerlich und innerlich –, um sein Volk in die Freiheit zu führen. Aber er hatte eben genug Mut und Kraft und Geduld und wurde schließlich Schwedens erster König. Ja, Jesus fordert uns heraus – aber er fordert nie mehr, als wir geben können.
Der Warnruf vor der Apokalypse
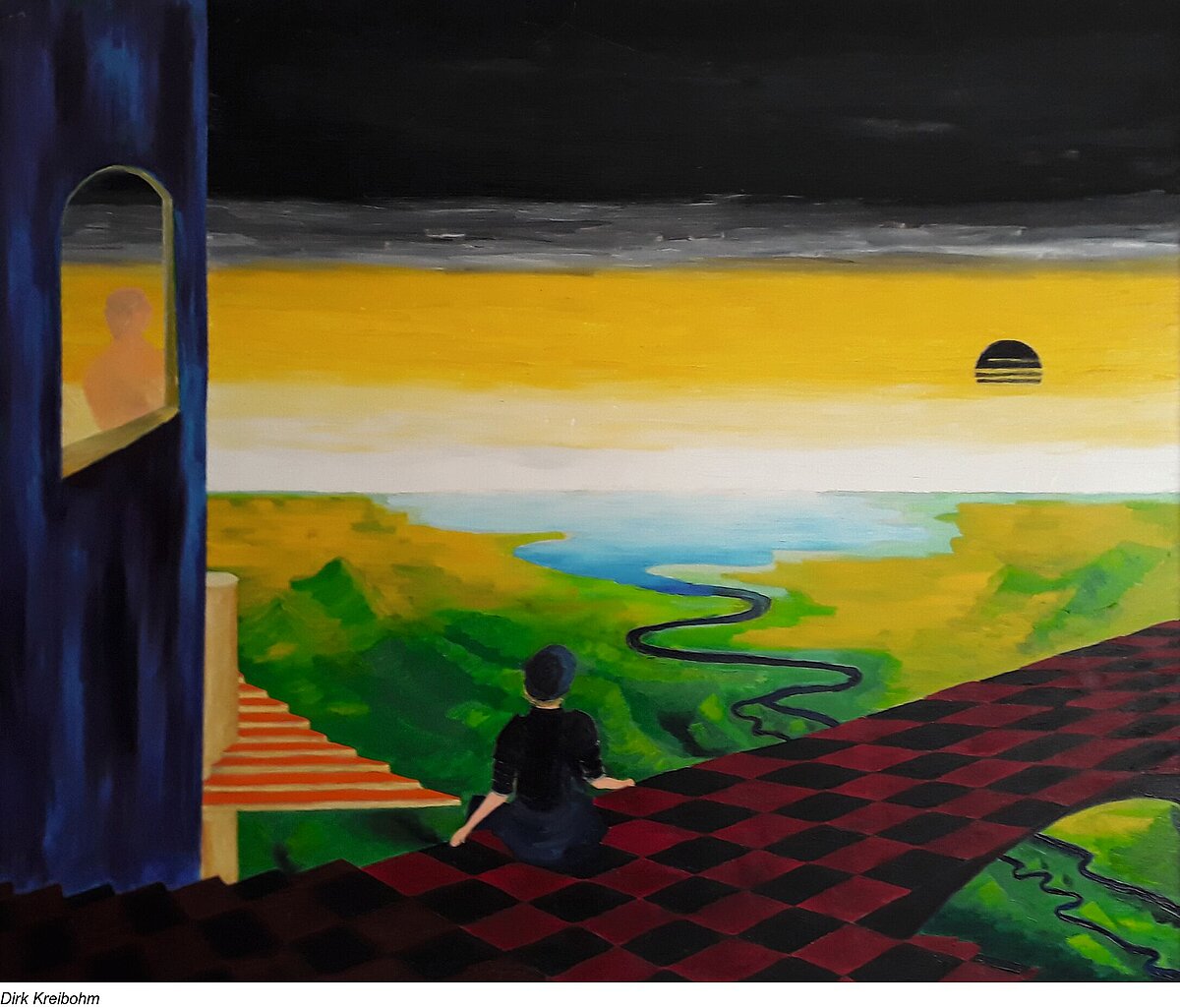
1
Der Künstler erzählte zu dem Bild eine Anekdote. Nach einem Taufgespräch betraten er und der Pfarrer das Atelier. Insbesondere vor diesem Gemälde blieb der Pfarrer stehen und sagte spontan: Die Apokalypse. Nach einer Weile der intensiven Betrachtung fügte er hinzu: Der Tag vor der Apokalypse. Er schien immer noch nicht zufrieden zu sein, deutete dann auf den Mann im Turm und meinte: „Ein Warner wie der Prophet Jesaja.“
Der Künstler, Dr. Dirk Kreibohm, sagte, er hätte nicht an Jesaja gedacht, als er das Bild malte, aber er stimmte dem Pfarrer zu. Es seien Gedanken gewesen, wie sie der Prophet wachruft, die ihn bestimmt hätten, die Komposition des Bildes so zu gestalten.
2
Wenn ich das übergroße Bild betrachte, fällt mein Blick zunächst auf den Jüngling. Er sitzt, den Rücken dem Betrachter zugewandt, auf einer schwebenden, bogenförmigen, aus roten und schwarzen Quadern bestehenden Brücke, die aus dem Nichts zu kommen und im Nichts zu verschwinden scheint. Der Jüngling ist mittelalterlich gekleidet mit seinem blauen Wams und einer dunkelblauen, turbanähnlichen Kopfbedeckung.
Seine feingliedrigen, kaum angedeuteten Hände liegen zart auf der Brücke, ohne sich festzuhalten. Er sitzt über dem Bodenlosen und sein Blick, den der Betrachter verfolgt, fällt in eine tiefe, bewegungslose, nur durch Farben angedeutete Landschaft. Sie besteht aus einer grünen Ebene, durch die sich ein blauer Fluss schlängelt, und einem in Gelb übergehenden Gebirge. Der Fluss mündet im Hintergrund in einen See oder in ein Meer, worüber sich weiß, dann hellgelb, dunkelgelb, blauschwarz und schwarz der Himmel abhebt.
3
Über der Landschaft schwebt eine blau-schwarze Sonne ohne Hof. Sie ist es, in Verbindung mit dem schwarzen Himmel, die dem Bild den bedrohlichen Charakter verleiht. Noch ist die Landschaft still und friedlich, aber in Gedanken sieht bzw. ergänzt man die Rauchwolken des Krieges, der Zerstörung oder eines sonstigen Unheils, das in naher Zukunft bevorsteht.
Was mich persönlich bewegt und mir zu denken gibt, ist die Passivität und Gleichgültigkeit des Jünglings. Mit kaltem Interesse erwartet er die Bedrohung, die Katastrophe. Ich, als Betrachter, ahne bzw. vermute ganz stark, dass der Jüngling nicht eingreifen wird, selbst wenn es sein eigener Untergang wäre.
4
Aber da ist dann noch die andere, die linke Bildhälfte. Eine schwebende, orangefarbene, sich nach oben verjüngende Treppe schmiegt sich an einen Säulenstumpf. Auch sie kommt aus dem Nichts. Sie führt nicht zu dem blauen Turm, der von der unteren bis zur oberen Bildhälfte reicht. In dem Turm befindet sich ein mittelalterlich anmutendes Fenster. Das Seltsame ist: das Fenster führt zu keinem Raum, sondern die Farben des Himmels werden weitergeführt. Durch das Fenster sieht man den angedeuteten Kopf und nackten Oberkörper eines Mannes. Er wirkt kraftvoll. Aus erhöhter Perspektive überschaut er die Landschaft. Im Unterschied zum Jüngling wirkt er bewegt, von leidenschaftlichem Interesse wie jemand, der eingreift. Er ist wie ein Rufer, ein Warner.
5
Vielleicht ist das ja Jesaja, der zwei Jahre warnend und nackt durch Jerusalem ging. Auch könnte der Mann im Turm den Jüngling wachrütteln wollen. Es ist so, als würde im Bild eine unsichtbare Diagonale zwischen dem Mann im Turm und dem Jüngling bestehen. Und es scheint, als würde der Jüngling nicht hören wollen.
Und das scheint mir so wichtig zu sein dieser Tage: die eigene Passivität zu überwinden. Und das ist auch die Intention des Künstlers. Er hat zumindest zu seinem Bild gesagt, die Landschaft sei in klaren positiven Farben gehalten, um damit deutlich zu machen, wie schön und erhaltenswert diese von Gott geschaffene Welt ist. Er wünscht sich, dass wir innehalten und das wahrnehmen, um uns dann dafür einzusetzen.
Hellwach und müde
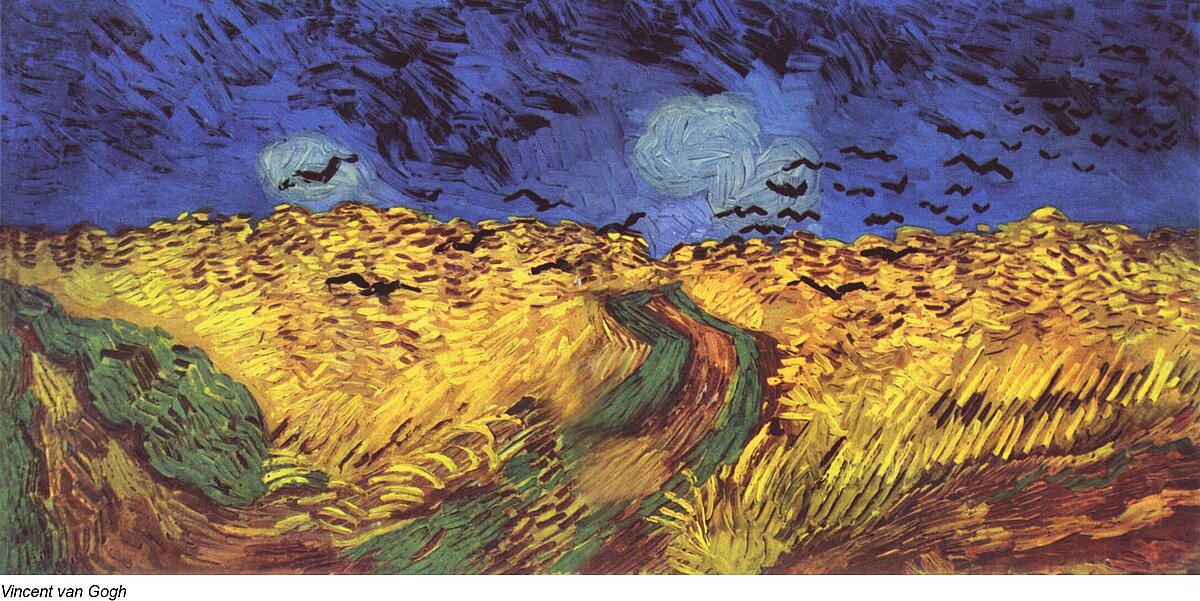
Gedanken zu Lukas 10,25-37
1
Die Farben sind das Wichtigste. Vordergründig geht es auf dem Bild um ein Kornfeld und den Himmel und viele Krähen; wesentlich aber sind die Farben. Sie explodieren geradezu: das Kornfeld in Gelb, der Himmel in Blau und die Krähen in ihrem bedrohlichen Schwarz. Selbst wenn das alles schnell hingemalt sein sollte im Monat seines Todes, ist es doch vom Maler wohl bedacht und tief empfunden. Es gibt keine reine Freude, liest man in und hinter den Farben. Was lebt, ist bedroht. Das Dunkle legt sich auf das Helle. Es kann auch umgekehrt sein. Bei van Gogh aber nicht, kurz vor seinem Tod.
2
Er konnte nicht mehr, der Vincent van Gogh. Er war 37 Jahre alt und hatte kein Geld mehr, schon lange nicht mehr. Er wollte seinem Bruder nicht länger zur Last fallen – der hatte ihm jahrelang vorbildlich mit Leinwand und Farben geholfen. Zudem war van Goghs Seele angeschlagen, vielleicht schon zerrüttet. Irgendwie fühlte er, dass es nicht mehr weitergehen konnte. Van Gogh war lebensmüde im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ändert aber nichts daran, dass er in seinen Briefen Wunderschönes über das Leben und die Liebe geschrieben hat. Man kann ja beides sein: hellwach und müde. Und hellwach schreibt van Gogh:
Es ist gut, viele Dinge zu lieben, denn darin liegt die wahre Kraft,
und wer viel liebt, leistet viel und kann viel erreichen,
und was aus Liebe getan wird, wird gut gemacht.
Und in einem anderen Brief schreibt er:
Je mehr man liebt, um so tätiger wird man sein.
3
Das würde uns der barmherzige Samariter bestätigen. Falls der überhaupt darüber nachgedacht hat. Seine Liebe, seine Fürsorge für den Verletzten ist ja gedankenlos im besten Sinne des Wortes. Zwei, die vorher vorbeigingen, haben nachgedacht und entschieden, dass sie keine Zeit haben – wirklich keine Zeit haben oder gefühlt keine Zeit haben wollten.
Der Samariter hatte vermutlich auch keine Zeit – aber er dachte nicht darüber nach. Er half. Weil die Not eines Menschen die eigene Zeit außer Kraft setzt, sozusagen. Das war dem Samariter vollkommen klar, falls er überhaupt darüber nachgedacht hat.
Er fragt sich das alles nicht; er legt Hand an.
4
Dazu kann man Menschen nicht auffordern; das müssen sie fühlen. Einem Menschen zu sagen und ihn aufzufordern: Du musst aber doch helfen! – ist ein zutiefst unsinniger Satz. Man hilft dann vielleicht, aber mit zusammengebissenen Zähnen. Das ist weniger Hilfe als ein eigenartiges Pflichtgefühl. Und vermutlich ist man dann auch schnell wieder weg, wenn das Nötigste getan ist.
Nein, zur Hilfe gehört das Herz. Das Herz eines Samariters sozusagen. Das Herz denkt nicht, es tut. Es sieht die Not und überlegt nicht, wie es um die eigene Lust und Zeit bestellt ist, sondern tut das Nötige.
Liebe ist das Tun des Nötigen.
Liebe geschieht hellwach - selbst dann, wenn man müde ist.
5
Nicht immer ist Müdesein eine Entschuldigung. Natürlich darf man müde sein angesichts der Aufgaben und Probleme, vor die uns das Leben stellt und im Bedenken der Nachrichten, die uns täglich zu Ohren kommen. Es wäre verwunderlich, würde man da nicht auch müde und wollte mal nichts mehr sehen und hören. Eins sollte man dabei aber möglichst nicht, nämlich die Liebe verschlafen; sozusagen mit offenen Augen verschlafen. Das Herz schläft nie, es schlägt. Das Gefühl für andere braucht keinen Schlaf – vorausgesetzt, man hat es. Und wenn man mit und für andere fühlt, bleibt man hellwach, auch wenn man müde ist. Wie der Samariter. Der musste auch wohin; der hatte auch Arbeit, vielleicht Familie oder Freunde, die auf ihn warten; der wollte auch weiterkommen und Geld verdienen. Der konnte sich womöglich auch nicht leisten, anzuhalten und zu helfen.
Und er tat es doch.
Der Samariter ist ein Sinnbild für das Hellwachsein in der Welt, auch wenn die Welt uns oft müde macht. Die Liebe sollte nicht schlafen. Wir tun uns selbst etwas Gutes, wenn unser Herz auch für andere schlägt und sogar für die, die wir uns nicht ausgesucht haben, die einfach nur Not haben. Ihnen gilt unser Herz. Trotz allem, trotz unserer eigenen Sorgen.
Liebe ist ein leichtes Neigen des Herzens hin zu anderen.
So erheben wir uns über die Müdigkeiten und erwecken und erbauen uns selbst.
Der andere Blick

Gedanken über ein neues Sehen des Gewohnten
1
Einen anderen Blickwinkel einnehmen, die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen, das war das Ziel von Jürgen Redecker aus Kirrlach in Baden-Württemberg. Er hat über einen längeren Zeitraum, an allen möglichen und unmöglichen Orten, einen Kopfstand gemacht und seine Frau gebeten, ihn dabei zu fotografieren. Viele unterschiedliche Orte für einen anderen Blickwinkel hat er gefunden: einen Zahnarztstuhl, einen Golfplatz, eine Fußgängerzone, Privatgrundstücke. Er hat auf einem gedeckten Tisch Kopfstand gemacht und schließlich auf der steinerne Brücke in einem Waldstück. Die Brücke verbindet verschiedene Waldwege miteinander und ist ein beliebter Treffpunkt für Senioren und Seniorinnen aus den umliegenden Orten. Für den Kopfsteher, Jürgen Redecker, war es faszinierend, vertraute Orte aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Dabei hat er sich ganz eingebracht. Ein Kopfstand fordert einen Menschen heraus, braucht Konzentration, Kraft und Übung, Überwindung und Mut. Und er hat viel daraus mitgenommen.
2
Das Bild vom Kopfstand fasziniert mich; noch mehr fasziniert mich die Idee dahinter. Einen neuen Blick auf vertraute Orte wagen, eine neue Perspektive einnehmen, das tut mir gut. Es hilft mir zu mehr Spielraum im Denken, zu mehr Freiheit in meinen Urteilen, zu neuen Gedanken. Es bricht Fronten auf und klärt meinen getrübten Blick. Es entspannt die Anspannung.
Ein Prozess kommt in Gang, ein anderer Blickwinkel gewinnt Raum. Die Sache mal auf den Kopf stellen und aus einem anderen Blickwinkel betrachten, nicht mit sortierten Gedanken und Urteilen, sondern frisch und anders. Besonders in festgefahrenen Strukturen hilft das weiter, wenn man denkt, dass es nicht mehr anders geht, als es schon immer war. Dann hilft ein Kopfstand auf einer Brücke.
Das auf den Kopf stellen, was schon immer war.
3
Das ist das, was auch Jesus immer wieder ins Leben von Menschen einbringt. Aber er geht noch weiter, als nur die Verhältnisse auf den Kopf zu stellen. Wenn Jesus Menschen begegnet, dann gehen manche nach der Begegnung in ein neues Leben, befreit von allem, was sie bislang beschwert hat, ermutigt und begeistert. Jesus legt Menschen nicht darauf fest, so zu sein, wie sie immer schon waren; das ist eine große Gnade.
Für jeden gibt es die Chance sich zu verändern. Jesus macht dazu keinen Kopfstand, aber stellt alle bisherigen Urteile über einen Menschen auf den Kopf.
4
Nicht an einer Brücke über einen Bach, aber an einem Brunnen trifft er einmal eine Frau (Johannes 4). Sie kommt aus der Stadt, die etwa einen Kilometer vom Brunnen entfernt liegt. Sychar ist ein Ort mitten in Samarien. Juden lebten nicht bei diesem Volk mit anderer Kultur und anderem Glauben. Lieber machten fromme Juden einen Umweg von mehreren Tagen, wenn sie von Judäa nach Galiläa reisten.
Die Frau kommt also näher. Sie hat einen Eimer dabei. Sie geht zum Brunnen, um Wasser zu holen. Vielleicht hatte jemand das Wasser daheim umgeschüttet. Vielleicht wollte sie aber auch nur niemandem begegnen. Mittags war man eigentlich allein am Brunnen, aber nun sitzt da Jesus.
5
Jesus spricht die Frau an und überwindet kulturelle und religiöse Grenzen mit seiner Ansprache. Die beiden unterhalten sich, der Anfang des Gesprächs ist holprig. Aber am Ende des Gesprächs zieht sie los in ein neues Leben. Sie wird zu einer Missionarin der guten Nachricht von Jesus. Ihr Leben wurde auf den Kopf gestellt und wieder zurück auf die Füße. Sie hat einen neuen Blick auf ihr Leben gewonnen.
Vielleicht steht ja bei Ihnen ja auch die Welt schon mal Kopf
Wer sich selbst erhöht

Gedanken zu Lukas 18,9-14
1
Der Intercityexpress wird zu spät bereitgestellt. Am Bahnsteig drängen sich die Reisenden. Sobald der Zug zum Halten kommt, setzt sich die wartende Masse in Bewegung,. Die Ersten drücken auf den Türöffner, bevor dieser grün aufleuchtet. Geschäftsreisende erklären ihrem Gesprächspartner am Telefon, dass sie endlich einsteigen dürfen. Aber ob bei den vielen Leuten auch bald abgefahren wird?
2
Vielleicht schaffe er es doch nicht pünktlich zum Termin, sagt ein Anzugträger. Eine Frauengruppe reicht kichernd die Kühltasche über ihre Köpfe weiter, damit der Proviant auf jeden Fall im Zug ist. Eine Lehrerin versucht ihre Klasse zur Ordnung zu rufen. Über das Getümmel hinweg wiederholt sie vernehmbar Wagennummer und Sitzplätze. Ein Ehepaar mit Hut, Stock und Koffer ohne Rollen kommt nur mühsam vorwärts. Fast hätte der Rucksack auf dem Rücken einer Jugendlichen sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Eine Familie aus Asien schaut sich verunsichert um. Im Gedränge hätte eine Mutter beinahe das Kleinkind an der Hand verloren: Der Schreck steht beiden ins Gesicht geschrieben. Ein Ehemann belehrt seine Frau etwas zu laut, dass das mal wieder typisch sei für die Deutsche Bahn, und hofft wohl auch auf ein Nicken der Umstehenden. Sie senkt den Kopf.
3
Die Stimme aus dem Bahnhofslautsprecher mahnt, alle Türen zu nutzen. Im Waggon geht es hektisch weiter. Die einen haben sich auf einen reservierten Platz gesetzt. Andere sind in den falschen Wagen eingestiegen. Sie versuchen nun, durch den Zug gehend zu ihrem Ziel zu kommen. Ein BahnComfort-Kunde erhebt mit Unterton Anspruch auf den Sitzplatz, auf dem schon ein Pendler Platz genommen hat. Die Koffer der Fernreisenden sind zu groß, um an einem Kinderwagen problemlos vorbeigeschoben werden zu können. In der Ablage über den Sitzplätzen ist schnell kein Platz mehr für Tüten und Taschen. Einige, die bereits sitzen, kommentieren das Geschehen. Sie schmieden unsichtbare Allianzen durch Blicke, Kopfschütteln oder kurze Bemerkungen über die anderen Reisenden: Durch ihr unmögliches Verhalten hätten sie die Abfahrt des Zuges verzögert und sorgten immer noch für Unruhe.
Und über all dem steht auf der Zuganzeige:
Wir reinigen – einsteigen! Via: bitte nicht!
4
Erst muss ich schmunzeln, dann fange ich an zu grübeln: Hätte ich mich darauf eingelassen, in diesen Zug einzusteigen, wenn sich die Ankündigung „Wir reinigen“ nicht nur auf die Müllbehälter, sondern auch auf die Menschen auf den Sitzen bezieht?
Wie müsste eine Einladung aussehen, damit wir auch dann einsteigen und uns auf einen sauberen Blick auf unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen und zu Gott einlassen?
Denken Sie – wie ich – eher „bitte nicht“? Bitte nicht jetzt!
Lukas 18,9-14
Vom Pharisäer und Zöllner
Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die andern, dies Gleichnis:
Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner.
Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme.
Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.
5
Jesus reagiert mit seinem Gleichnis auf eine Haltung, die er bei einigen Umstehenden wahrgenommen hat. Er kleidet sein Urteil in die Beschreibung der Begegnung von zwei Menschen mit Gott. Mitten in ihrem Alltag suchen sie den Tempel auf, um zu beten. Sie wollen ihr Verhältnis zu Gott klären. Auf das erste Hören oder Lesen hin scheint alles eindeutig zu sein
6
Das Verhalten der beiden Betenden wird erst einmal ohne Wertung nebeneinandergestellt. Der eine bringt umfassend vor, was er selbst Redliches geschafft hat. Der andere spricht in fünf Worten aus, was Gott für ihn tun soll. Nur der abschließende Satz der Rede Jesu macht den Unterschied.
Wer aber jetzt mit anderen über das unmögliche Verhalten des Pharisäers den Kopf schüttelt, ist in die Falle des Gleichnisses getappt: Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden (Lk 18,14 b).
Helige Orte

Gedanken zum Wochenspruch Psalm 33,12
1
Die bekränzten Männer tragen schwer an der Kriegsbeute. Da ist der siebenarmige Leuchter, den die römischen Legionäre bei der Eroberung Jerusalems im Tempel erbeutet haben. Auch den Tisch für die Schaubrote haben sie mitgenommen, die Gott als Opfergaben und den Priestern als Nahrung dienten. Ganz rechts ist er zu sehen, zusammen mit den Posaunen, die zu Gebeten und Feiertagen riefen. Daneben laufen Sklaven mit einem Strick um den Hals. Römische Feldzeichen ragen zwischen den Menschen hervor wie Plakate bei einer Demonstration.
Es geht ja um eine Demonstration bei diesem Triumphzug 70 n. Chr., der auf dem Titusbogen in Rom dargestellt wird. Es geht um das Zurschaustellen von militärischer Überlegenheit, von der Macht des Imperium Romanum.
2
Die Bewohner der Provinz Judäa hatten diese Macht in Zweifel gezogen. Sie hatten aufbegehrt gegen die fremde Herrschaft im schon lange nicht mehr eigenen Land. Sie hatten sich gewehrt gegen die römischen Gesetze und Steuern und vor allem dagegen, dass sie den römischen Kaiser und seine Bilder als gottgleich verehren sollten. Immer wieder hatten die Besatzer die jüdische Bevölkerung damit provoziert. Und als der Konflikt eskalierte, schlugen sie brutal zurück.
Der Tempel von Jerusalem wurde entweiht und ausgeplündert. Dann ging er in Flammen auf und brannte nieder, bis das sichtbare Zentrum jüdischen Glaubens verschwunden war. Bis heute.
3
Wo ist Gott, wenn sein Haus verschwindet? Der Gott, der versprochen hatte, Israel zu segnen, zu begleiten, groß zu machen … Hatte er sich zurückgezogen? Und wie würde man ihm wieder nahekommen können? Schon als der Tempel noch stand, ahnte man, dass Gott zu groß sei, als dass ein Haus ihn fassen könnte. Und doch war der Tempel gebaut worden. Wie auch Kirchen gebaut worden sind. Menschen haben nun mal einen Sinn für besondere Orte. Für das Versprechen von Gottes Nähe. Für Heiligkeit.
Aber die Idee von Heiligkeit ist anfällig für falsche Sicherheiten. Schon die Propheten Amos und Hosea hatten das angemahnt. „Wie könnt ihr glauben, Gott zu gefallen, wenn ihr im Tempel Opfer bringt, aber anschließend eure Nachbarn weiter ausbeutet und verachtet?!“ riefen sie. Anders ausgedrückt: Wenn ihr nicht euren Mitmenschen ein Nächster oder eine Nächste sein könnt, werdet ihr auch am heiligsten Ort Gott nicht finden können!
Als im Jahr 70 n. Chr. der heiligste Ort verschwunden war, erfüllte Klage die Straßen Jerusalems. Und doch: Aus der Gewissheit, dass Gott dort ist, wo das Gute unter den Menschen wohnt, erwuchsen Ideen für einen Gottesdienst, der ohne Tempel auskommen konnte. Die bekränzten römischen Männer trugen heilige Gegenstände durch die Straßen Roms, die ihre Funktion nie wieder erfüllen würden. Gott selbst aber konnten sie nicht durch die Stadt tragen. So blieb die Hoffnung, dass Gott sich auch nach dieser Katastrophe finden lassen würde.
4
Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat, heißt es im Wochenspruch Psalm 33,12. Lange Zeit dachten Christen, Gott hätte das Volk Israel von sich weggestoßen und sich stattdessen der Kirche Jesu Christi zugewandt. Durch die Tempelzerstörung fühlten einige sich darin sogar noch bestätigt. Sie hielten sich selbst für Gottes wahre Erben.
Inzwischen haben wir erkannt, dass Gott keine Lieblingskinder hat. Unter all den Kindern Gottes auf der Welt sind Juden und Christen besonders eng verbunden. Uns verbindet nicht nur die Hebräische Bibel, sondern vor allem die Überzeugung, dass Gott sich immer wieder finden lässt. Und uns verbindet die Sehnsucht nach einer gotterfüllten Zukunft, in der alle Orte heilig werden darin, dass man an ihnen Gott begegnen kann. Aber auch dadurch, wie wir Menschen einander begegnen.
Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Fließend weitergeben

Geschenktes nicht festhalten
1
Das Brunnenhaus des Zisterzienser-Klosters Maulbronn steht seit dem 13. Jahrhundert in der Nordseite des Kreuzgangs, auf der Südseite der Klausur, im Kreuzgang direkt gegenüber vom Speisesaal der Mönche. Im Frühjahr sieht man heute durch die Bögen des Kreuzgangs einen prächtig blühenden Magnolienbaum. Hier am Brunnen haben sich die Mönche die Hände gewaschen, hier ist wöchentlich die Tonsur der Haare geschnitten und die Rasur vorgenommen worden.
Das Brunnenhaus ist eine besondere Erfindung der Zisterzienser und zeigt die Bedeutung, die man im Orden dem Wasser als Quelle des Lebens zumaß. Es ist mehr als ein Ort der Hygiene, es ist auch ein Symbol für den Brunnen des Heils (vgl. Joh 4,14). Das Spiel des Wassers über mehrere Schalen ist Teil der Kontemplation genauso wie das Plätschern des Wassers, das in der Stille der Klausur überall zu hören ist – und Grundlage des Sprachbilds, das Bernhard von Clairvaux in seinem Brief malt.
2
Im Gewölbe über dem Brunnen findet sich ein Bild der Gründungslegende – ein Maultier an einem Brunnen. Der Legende nach soll Ritter Walter von Lomersheim dem Maulesel einen Geldsack aufgeladen und das Tier ziehen lassen haben. Dort, wo es anhalten und die Last abwerfen würde, wollte er ein Kloster bauen. Der Maulesel blieb auf seinem Weg an der Stelle des heutigen Klosters stehen und brachte durch Hufschläge eine Wasserquelle aus dem Fels hervor. Eine Variante der Legende berichtet, dass Mönche einen Maulesel mit auf den Weg genommen und an eben jener Stelle ihr Kloster errichtet hätten, wo das Tier innegehalten und getrunken hatte.
Wasser war eine wichtige Voraussetzung zur Errichtung eines Klosterbaus. In der zisterziensischen Architektur und Theologie erhielt der Brunnen im eigens errichteten Brunnenhaus seine besondere Wertschätzung und Bedeutung, die auch theologisch reflektiert wurde.
3
Der Brunnen in Maulbronn ist im 19. Jahrhundert in seine heutige Gestalt mit drei Schalen und dem Bronzeaufsatz, der ursprünglich dem mittelalterlichen Abtsbrunnen entstammt, erweitert worden. In seiner jetzigen Form macht er das Sprachbild des Zisterzienser-Abts Bernhard von Clairvaux anschaulich: Der Brunnen kann das Wasser nicht festhalten, sondern gibt weiter, was er empfängt. Lebendig fließendes Wasser füllt seine oberste Schale, die, sobald sie gefüllt ist, das Wasser in die mittlere und dann in die untere Schale weiterfließen lässt. Sie gibt nicht mehr als sie empfängt – und sie hält gleichzeitig das, was sie empfangen hat, nicht fest.
4
Nicht festhalten – weitergeben – das Leben in Fülle fließen lassen – und zugleich nicht mehr geben, als mir geschenkt ist: in seiner Lebendigkeit entlastet und berührt mich das Bild des Brunnens.
Das Brunnenhaus in Maulbronn ist einer meiner Lieblingsorte. Es zeigt mir das Geheimnis, was Gott von uns Menschen will und wie er will, dass wir Leben gestalten: alles Wichtige im Leben erhalte ich geschenkt – und ich kann und soll es nicht festhalten; es soll von mir an andere weiterfließen und erst im Fließen zeigt es dann seine Schönheit und seinen Reichtum.
Die Liebe zum Ausdruck bringen

1
Da stehen sie, die würdigen Herren. Wir brauchen keine Farbe, um zu erkennen: es sind sogenannte Würdenträger; Herren der Kirche, Bischöfe oder Kardinäle. Sie stehen in einem etwas eigenartigen Raum. Rechts über ihnen an der Wand wohl das Bildnis eines oder einer Heiligen. Die Würdenträger, wie sie genannt werden, stehen in zwei Grüppchen zusammen.
Die zwei vorne bewegt etwas. Einer sagt: „Ich sage Ihnen, das nächste große Ding ist KG –- Künstlicher Glaube!“ Damit spielt er wohl an auf etwas, was in der digitalen Welt viele Schlagzeilen macht: die Künstliche Intelligenz; die selbst fahrenden Autos und die für mich denkenden Computer. Und er hält den „Künstlichen Glauben“ für ein großes Ding. Warum er das denkt, bleibt sein Geheimnis.
2
Was könnte das sein, ein „Künstlicher Glaube“? Ich kann mir darunter nicht so recht etwas vorstellen. Jeder Glaube hat ja etwas Künstliches, gewissermaßen. Weil ein Glaube, wie zum Beispiel der christliche Glaube, nicht immer auf Tatsachen beruht, sondern oft auf Deutungen der Tatsachen. Dass Jesus gelebt hat und wie er gelebt, gesprochen und gehandelt hat – ist das eine. Das andere ist die Deutung. Weil Jesus so gelebt, gesprochen und gehandelt hat, kann er nur Gottes Sohn gewesen sein. Dass Jesus gelebt hat, ist unumstritten. Was das für uns bedeutet – darüber kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein.
3
Das Wort „künstlich“ ist hier aber nicht schön. Es klingt wie „unwirklich“. Das ist ein Glaube nie. Er mag umstritten sein, aber er ist nicht künstlich. Wir haben unterschiedliche Ansichten, aber keine künstlichen. Was der Herr auf dem Bild für ein „großes Ding“ hält, klingt nach einer besonderen Sorge. Womöglich fürchtet er, überflüssig zu werden, was sein Amt und seine Würden angeht. Vielleicht meint er mit dem „großen Ding“ die Abschaffung oder das Verschwinden der Kirchen – also der Einrichtung, der Organisation Kirche. Wenn immer mehr Menschen über ihren Glauben selbst bestimmen, wird eine klare Organisation überflüssig. Vielleicht fürchtet er das.
Dann sieht er etwas sehr Richtiges, ohne es zu erkennen.
4
Jeder Glaube, auch der christliche Glaube, hat und braucht eine Lehre. Es darf und kann nicht jeder und jede glauben, was er oder sie will. Oder: man darf und kann schon, aber dann ist es nicht mehr christlich, sondern eher etwas künstlich, sozusagen selbst gemacht.
Am Glauben sollte aber nichts Selbstgemachtes sein, sonst löst er sich auf in viele Einzelinteressen. Die Kirchengemeinde in der Nachbarschaft sollte nichts anderes glauben als wir hier, sonst passen wir nicht unter ein Dach. Man kann die Einrichtung, die Organisation Kirche kritisieren und vielleicht auch abschaffen wollen – etwas aber geht nicht: Der Glaube braucht eine Lehre, etwas gemeinsam Verbindliches, sonst verflüchtigt er sich in Einzelinteresse; sonst wird er ein künstlicher Glaube, der viel mit Wünschen und wenig mit Wirklichkeit zu tun hat.
Der christliche Glaube hat und braucht etwas, was für alle gilt.
5
Für das Christentum bedeutet das: Jesus ist Gottes Sohn. In Jesus zeigt sich Gott. Das ist nicht verhandelbar. Jesus ist mehr als ein guter Mensch. Und wer im Sinne Jesu lebt, bringt ein wenig Licht vom Reich Gottes in die Welt. Christen sind die Menschen, die Gott über alle Dinge vertrauen – vertrauen wollen. Und die das in ihren gottesdienstlichen Feiern zum Ausdruck bringen. Das ist der Boden, auf dem wir gemeinsam glauben. Und zu leben versuchen. Wir bringen den Glauben zum Ausdruck, damit er nichts künstlich Ausgedachtes bleibt. Wir leben und handeln, was wir glauben. Wir können nicht anders. Der Glaube ist keine Kopfsache, sondern Lebenssache.
Leider sind wir dabei als eine Kirche Jesu in den letzten zweitausend Jahren oft verschiedene Wege gegangen. Dennoch bleiben wir aber alle Kinder des einen Geistes: Unser Glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist, bringen wir in der Liebe zum Ausdruck. Am Tun der Liebe ist nichts Künstliches. Darum sagt uns der Apostel so schön wie nüchtern (Eph 5,8b.9): Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wer diesen Weg geht, geht den Weg des Glaubens.
Der Weg des Glaubens ist: die Liebe zum Ausdruck bringen.
Die Hoffnung auf Seligkeit
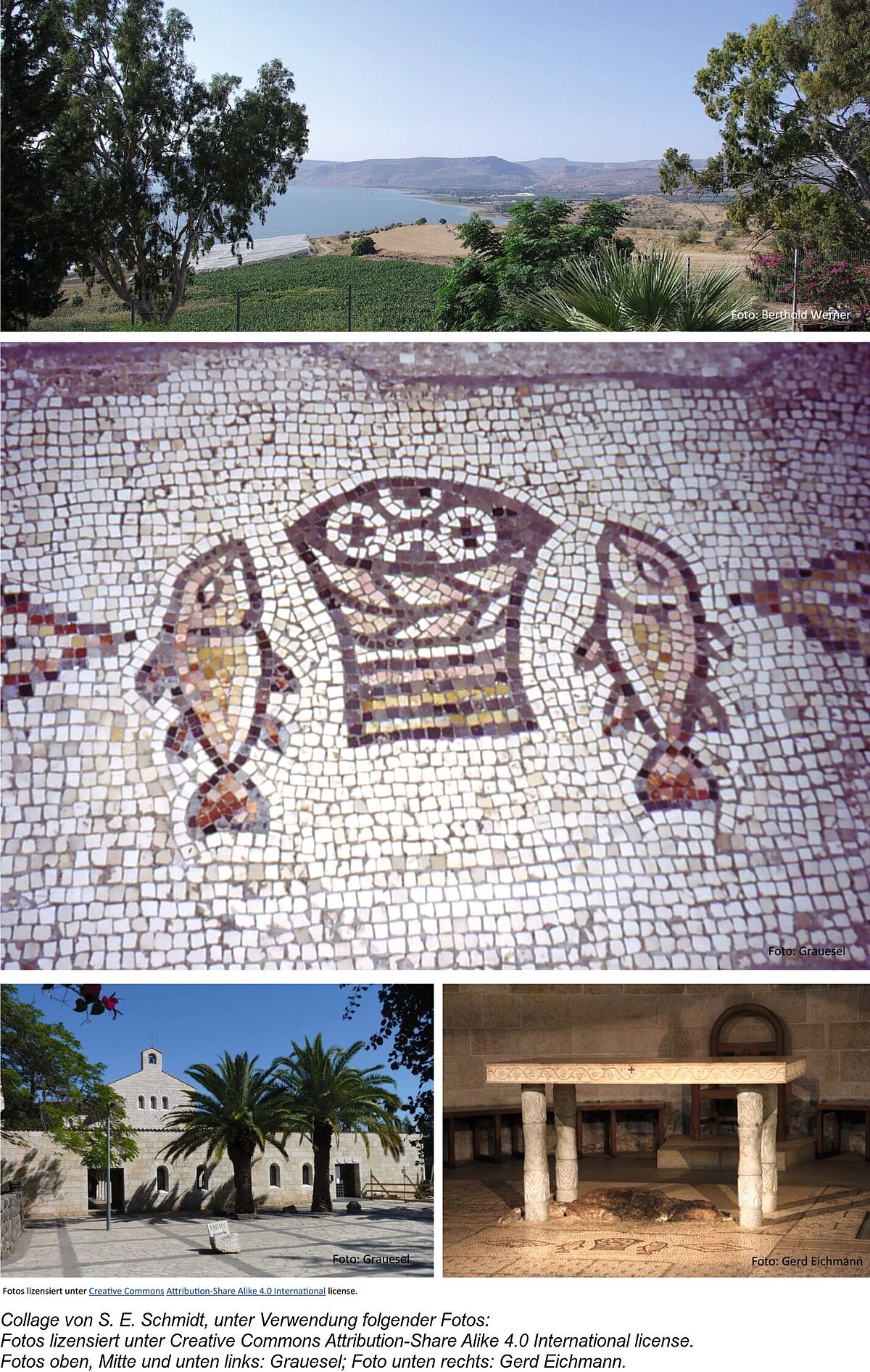
Gedanken zum Brotwunder
1
„Tausende von Menschen aller Nationen besteigen Jahr für Jahr den Berg der Seligpreisungen im Norden Israels, in Galiläa, der Heimat Jesu. Manche reisen mit dem Bus an, andere pilgern den Weg vom Tal hinauf auf den Berg, der eigentlich nur ein Hügel ist. Viele spüren den Zauber des Ortes, sind bewegt von der besonderen Atmosphäre und hören die Worte Jesu in ihren Herzen: „Selig, wer hungert und dürstet nach Gerechtigkeit … Selig, wer Frieden stiftet …“ (Matthäus 5).
Vom Berg der Seligpreisungen geht der Blick weit über den See Genezareth. Viele pilgern den Berg hinab, vorbei an Bananenplantagen, dornigem Gestrüpp und blühenden Wildblumen in Richtung Tabgha. Dort steht ein Kloster. Seit vielen Jahrhunderten liegt es am Rande des Sees, am Ufer des „galiläischen Meeres“.
2
Dieses Kloster wurde im Laufe der Jahrhunderte zum Wallfahrtsort. Es wurde zerstört zur Zeit der Kreuzzüge und wieder aufgebaut. Es wurde vergessen und wiederbelebt. Wurde bedroht und beschützt. Und es ist immer noch da – aller Veränderungen und Bedrohungen zum Trotz!
Bereits im 3. Jahrhundert wurde dieser Ort als Ort der Brotvermehrung erwähnt. Der Reisebericht der Pilgerin Egeria kann noch heute im Kloster nachgelesen werden. Sie war eine mutige und vermögende Frau, die im 4. Jahrhundert das Heilige Land bereiste und auch nach Tabgha kam. „Dort liegt am Meer eine Wiese“, schrieb sie, „mit viel Gras und vielen Palmen und nahe dabei sieben Quellen, von denen jede einzelne ununterbrochen fließt. Auf dieser Wiese sättigte der Herr das Volk mit fünf Broten und zwei Fischen. Und in der Tat: Der Stein, auf den der Herr das Brot legte, ist nun zum Altar gemacht worden.“
3
Ob es dieser Altar ist, den man noch heute im Kloster in Tabgha besichtigen kann? Schlicht und unauffällig ist er; und doch glaube ich nicht, dass er schon Jesus zur Verfügung stand. Sein „Altar“ war wohl eher die Wiese am Meer… Und was heute den Ort so anziehend macht, kannte die Pilgerin Egeria noch nicht: Die prächtigen Mosaike aus dem 5. Jahrhundert: So fein aus kleinen Steinen gefertigt, so wunderschön!
Besonders berührend ist das schlichte Mosaik unterhalb des Altars: Es zeigt zwei Fische und einen Korb voller Brot. Betrachtet man es genau, ist man verwundert: Erzählten die Evangelisten nicht von fünf Broten und zwei Fischen?
4
Schaut man sich das Mosaik genau an, springen einem zunächst zwei Fische ins Auge. Sie ähneln den Petersfischen, jenen Fischen, die im See Genezareth leben und nach dem Jünger Jesu benannt sind. Sie waren schon zu Zeiten Jesu das Grundnahrungsmittel der Menschen am See. Zu sehen sind dann in einem Korb auch Brote – aber nur vier! Wo ist das fünfte Brot?
Es ist das Brot, das wir essen! Das erzählen die Nonnen, die im Kloster leben. Still und verhalten erzählen sie den Pilgern von ihrer Hoffnung: Dass Jesus da ist und den Seinen im Abendmahl nahekommt – auch heute noch! Dass es gut ist, auf ihn zu warten und seine Wiederkehr herbeizusehnen. „Maranatha!“ singen sie mit dem alten aramäischen Wort: „Jesus – komm doch bald!“
5
In Tabgha haben sie nicht aufgegeben zu hoffen und zu warten – im Wandel der Zeiten warten sie auf den einen, der die Seinen stärkt mit Brot und Wein. Und bis er zurückkommt, werden Menschen da sein, die von ihm erzählen und von der großen Hoffnung, die mit ihm in die Welt kam: „Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen!“
Inschrift auf Beton

1
Hier hat sich einer oder eine Luft gemacht. In der Nacht wird gerne gesprüht oder gesprayt. Manche Hauswände könnten ein Lied davon singen. Diese Schrift auf Beton scheint eher aus Unmut zu kommen. Da steht: „gott ist tot SATAN lebt …“ Für ein Komma hat es nicht gereicht; das Wort „gott“ scheint kleingeschrieben – dafür steht SATAN in Großbuchstaben.
Hinter dem Satz könnte folgende Geschichte stehen: Jemand erlebt wenig oder nichts Gutes – und glaubt nicht mehr an Gott, ja, hält Gott für tot. Zugleich scheint diesem Jemand aber das Böse sehr lebendig. Also denkt er oder sie, der SATAN lebe. Und wenn wir noch vermuten, dass der Sprayer oder die Sprayerin eher jünger ist, ist der Glaube hier auf den Punkt gebracht: Gott, Satan und mein Glaube entscheiden sich an der Frage von Gut und Böse. Gott ist das Gute, der Satan das Böse.
2
Mit dem Wort und dem Begriff Satan betreten wir eine Welt, die unüberschaubar geworden ist. Alle Religionen und auch das Alte wie das Neue Testament der Bibel nutzen das Wort – ebenso wie das Wort Teufel. Was aber jeweils genau damit gemeint ist, füllt viele Bücher und kluge Artikel.
Eine Kurzfassung könnte lauten: Wenn Gott gut ist, woher kommt dann das Böse? Das Böse ist ein Widersacher Gottes; etwas von Gott Abgefallenes – womöglich ein gefallener Engel. Der bekommt einen Namen: Satan, Teufel, Beelzebub … Namen sind wichtig, um etwas zu benennen. Der Inhalt des Benannten ist etwas Böses. Also jemand, der gegen Gott handelt, handelt gegen das Gute.
Nebenbei bemerkt: Nicht einleuchtend an der Inschrift auf Beton: „gott ist tot SATAN lebt …“ ist, dass es den Satan, den Teufel doch nur geben kann, solange Gott lebt. Sollte Gott tot sein, ist die Frage nach Gut und Böse hinfällig. Der Satan lebt nur, weil Gott lebt. Er ist ja von ihm, vom Guten abgefallen.
3
Hier ist also das Böse auf Beton verewigt. Das Gute ist tot, meint ein Sprayer, das Böse lebt. Das mag er oder sie so empfinden. Empfindungen müssen nicht richtig sein – dennoch haben sie ihr Recht. Wenn man jahrelang viel Böses erlebt, kann man so empfinden.
Andere erleben womöglich viel Gutes, auch jahrelang. Sie würden dann einen solchen Satz niemals auf Beton schreiben. Aber vielleicht einen anderen. Einen Satz über das Gute. Ihre Inschrift auf Beton könnte dann heißt: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Oder kürzer: Einer trage des anderen Last. Damit ist alles gesagt.
Gut ist, wenn wir einander beistehen.
4
Der Satz wäre es wert, auf Beton geschrieben zu sein: Einer trage des anderen Last. Er ist einfach nur wahr. Der Teufel versucht, Jesus und uns auf einen anderen Weg zu locken (Matth 4): Er verspricht, uns alle Reiche der Welt zu schenken, wenn wir ihn anbeten und uns um uns selber kümmern. Jesus wehrt das ab und sagt: Ich will nicht mir, sondern Gott dienen. Da verließ ihn der Teufel, und die Engel dienten Jesus. Aber die Frage stellt sich ja jeden Tag wieder: Tue ich nur mir Gutes? Oder achte ich darauf, dass auch andere Gutes erleben? Oder ich ihnen wenigstens nicht schade?
Wir wissen nicht, was der Sprayer oder die Sprayerin erlebt haben. Vermutlich nicht viel Gutes. Dann muss man sich auch mal Luft machen und behaupten: Das Gute ist tot, das Böse lebt. Es wird vermutlich viele Menschen geben, die so empfinden.
5
Dagegen hilft nur das Gute, also eine andere Empfindung. Wer will, dass Menschen mehr Gutes empfinden, sollte ihnen Gutes antun: Einer trage des anderen Last. Das klingt einfach – ist es aber leider nicht immer. Weil am Anfang etwas steht, was oft vergessen wird: Ich soll den oder die andere wirklich wahrnehmen und darauf achten, welche Lasten er oder sie wirklich zu tragen hat. Ich sage absichtlich: „wirklich“. Denn manche Lasten verstecken sich ja hinter einer Fröhlichkeit, die nicht immer zu durchschauen ist. Darum die Überlegung: Wie belastet ist der andere Mensch wirklich?
Das Gute beginnt mit einem wohlwollenden Hinsehen und Hinhören. Manche wollen gar nicht, dass man ihnen eine Last abnimmt. Sie empfinden es schon als heilsam, wenn sie auf Verständnis treffen. Dazu können wir beitragen. Durch genaues Hinhören und Hinsehen. Auch Ohren können mittragen.
Seien wir sehr achtsam aufeinander. Schon dann beginnt das Gute.
Verantwortung macht menschlich

1
Die Menschen auf dem Bild wirken verstört. Jeder und jede hat mindestens einen Koffer zur Hand. Mache halten ihn so, dass Koffer oder Tasche nicht nass werden; andere nutzen den Koffer wie einen Schwimmreifen. Sie halten sich an dem Teil fest, um nicht unterzugehen oder nicht schwimmen zu müssen. Das Außergewöhnliche ihres Tuns begründen sie so: WIE SCHÖN WAR’S DAMALS, ALS MAN NOCH SEIN GEPÄCK UNBEAUFSICHTIGT IM HOTEL LASSEN KONNTE.
Das geht offensichtlich nicht mehr. Die Gäste haben Sorge, dass man ihnen das Gepäck stiehlt. Sie nehmen ihr Gepäck mit zum Pool und beseufzen das „Damals“, als man ihr Gepäck noch in Ruhe ließ, wie sie meinen.
2
Das ist beliebt: zu denken und zu sagen, dass es früher besser war, angeblich. Wer sich heute über etwas ärgert, seufzt bald und sagt: Das hat es früher nicht gegeben. Angeblich waren die Kinder früher braver, die Straßen freier und die Lebensmittel gesünder. Mag sein, dass sich das eine oder andere zum Schlechteren gewandelt hat. Dabei wird aber vergessen, wie viel besser geworden ist – denken wir nur mal an die medizinische Versorgung oder die Versorgung mit Lebensmitteln. „Früher“ ist nie ein guter Vergleich; man kann Zeiten und Verhalten nicht miteinander vergleichen. „Früher“ war früher, „Heute“ ist heute. Jede Zeit war bemüht, auf der Höhe ihrer Zeit zu sein.
Unsere Erinnerung spielt uns einen Streich, wenn sie meint, früher sei so vieles besser gewesen. Manches vielleicht, und manches andere nicht.
3
Das Volk Israel hatte sogar ein Sprichwort über dieses „Früher“ und „Heute“; ein nicht ungefährliches Sprichwort. Es lautete, wie der Prophet Hesekiel erzählt, folgendermaßen: „Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden“. Das soll heißen: Wir baden die Sünden der Eltern aus. Was die Generation vor uns falsch gemacht hat, müssen wir erleiden.
Manches an diesem Gedanken ist richtig. Wir heute leben mit den Folgen dessen, was unsere Eltern und Großeltern zu Werke gebracht haben – im Guten wie im Schlechten. Aber das Sprichwort ist auch gefährlich. Für vieles sind wir selber verantwortlich und dürfen es nicht auf die Generationen vor uns schieben. Wir bleiben verantwortlich für unser Tun.
4
Darauf legt der Prophet Hesekiel großen Wert. Das Sprichwort, sagt er im Namen Gottes, „soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel.“ Weil es zu bequem ist, die Schuld auf „früher“ zu schieben. Indem wir das tun, leugnen wir unsere Verantwortung für heute. Wir zucken sozusagen die Achseln und sagen: Da können wir doch nichts für – das haben doch unsere Eltern angerichtet; wir baden nur aus.
Bei ausbaden sehen wir wieder auf das Bild und erkennen, dass auch die Hotelgäste – wie sie meinen – ausbaden müssen, was andere ihnen eingebrockt haben. Ihr Schwimmvergnügen ist erheblich getrübt, weil sie meinen, ihr Hab und Gut sei im Hotel nicht mehr sicher. Ob das überhaupt stimmt? Das können wir nicht wissen.
5
Wir können aber etwas anderes wissen: wir haben die Verantwortung für unser Leben in dieser Zeit. Das ist groß und wichtig. Dem Propheten Hesekiel geht es bei seinen Worten im Namen Gottes nicht ums Bestrafen. Gott hat keine Freude am Strafen. Es geht darum, dass wir uns jeden Tag bemühen können, das Gute zu tun – das Gute für das Leben möglichst vieler auf Gottes Erde. Wer wirklich und wahrhaftig besten Wissens und Gewissens lebt und handelt, wird leben. Und muss sich nicht darum sorgen, ob Gott ihn straft.
Unser Leben ist ein Leben im Angesicht Gottes, wie die Bibel das sehr schön nennt. Das glaubt nicht jeder Mensch. Es wäre aber hilfreicher, Menschen lebten wenigstens so, auch wenn sie es nicht glauben. Dann ist die Überraschung nicht so groß, wenn wir uns doch vor Gott werden verantworten müssen – eines schönen Tages.
Suchen wir füreinander das mögliche Gute; tun wir einander das Gute; Und bitten wir einander um Vergebung, wenn wir das Gute versäumen sollten.
Verantwortung füreinander und vor Gott macht uns menschlich
Johannes der Täufer

Gedanken zum Johannistag 24. Juni
1
In einem Fluss, der nur durch wenige Wellen angedeutet ist, steht ein Mensch. Leicht gebeugt steht der da und wenig bekleidet sieht er aus. Vor ihm steht am Ufer ein Mann in einem knielangen Gewand. Der Mann wendet sich der Person im Fluss zu. Auch er beugt sich leicht nach vorne, vielleicht weil das Ufer etwas höher liegt. Eine Hand des Mannes ruht auf der Schulter der Person, die im Wasser steht. Mit der anderen Hand hält er ein Gefäß. Vermutlich schüttet er Wasser über die Person im Fluss. Die Szene beobachten Frauen und Männer, die in der Nähe sind. Sie wenden sich den beiden zu und scheinen näher zu kommen. Eine Person verschränkt die Hände vor der Brust. Sie wirken neugierig und interessiert.
2
Das Bild gestaltet eine Szene aus den Evangelien:
Johannes der Täufer tauft Menschen im Jordan. Der Jordan ist ein Fluss in Israel, der den See Genezareth mit dem Toten Meer verbindet. Weil der Jordan in einer Senke quer durch die Wüste fließt, ist kaum eine größere Stadt in seiner Nähe. Dorthin, in die Wüste, in die Jordansenke, hatte sich Johannes zurückgezogen. Er trug, so berichtet es die Bibel, ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel. Er aß Heuschrecken und wilden Honig. Er lebte das Leben eines Eremiten, eines Einsiedlers. Und: Er predigte.
3
Johannes predigte die Taufe zur Vergebung der Sünden. Die Taufe des Johannes hatte damals also eine andere Bedeutung als die Taufen, die wir in unserer Kirchengemeinde praktizieren. Johannes taufte die Menschen nicht, um damit deutlich zu machen, dass sie nun zu ihm gehören, ihm etwa folgen sollten. Er taufte sie auch nicht in eine schon bestehende Glaubensgemeinschaft hinein. Die Menschen ließen sich auch nicht von ihm taufen, weil das für sie dazugehörte.
Die Taufe, die Johannes praktizierte, hatte eine andere Bedeutung: Er taufte die Menschen, um sie zu Buße und Umkehr zu bewegen. Der Johannes-Taufe ging ein Bekenntnis der Menschen zu ihren Sünden voraus. Die Taufe bedeutete Umkehr, Neuanfang, das Abwaschen von Schuld und Fehlern. Diese Taufe war für die Menschen so verheißungsvoll, dass sie weite Wege auf sich nahmen. Sie kamen aus dem ganzen jüdischen Land und aus Jerusalem zum Jordan. Sie wollten hören, was Johannes predigte. Und sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm taufen. Im Markusevangelium (1.4f) ist das mit kargen Worten so beschrieben: „Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden.“
4
Warum aber war das so attraktiv? Warum kamen die Menschen von weither, um sich von Johannes taufen zu lassen?
Ich stelle mir vor, dass sich die Leute danach sehnten, aussprechen zu können und aussprechen zu dürfen, was ihnen auf der Seele lag. Ich stelle mir vor, dass Johannes ihnen zuhörte, wenn sie erzählten, was in ihrem Leben schieflief; wo sie schuldig geworden waren. Und ich stelle mir vor, dass die getauften Männer und Frauen sich wie neue Menschen fühlten, wenn sie nach der Taufe aus dem Wasser stiegen. Vermutlich haben sie sich dann vorgenommen: Ich werde mein Leben ändern.
Das ist Umkehr. Das ist Buße. Sich einzugestehen, was im eigenen Leben schiefläuft. Und dann etwas zu ändern. Johannes brachte die Menschen auf einen neuen Weg und besiegelte diesen mit seiner Taufe.
Vertraut neuen Wegen
Der Himmel im Herzen

1
Der Zeichner auf dem Bild fühlt einen Auftrag. Entschlossen sitzt er vor Staffelei und Leinwand. Er will zum Denken ermuntern. Dazu malt er ein Bild, auf dem nur steht: „Think“ – das meint: Denkt! oder allgemein: Denken. Mit großem Ernst geht er zu Werke. Die Buchstaben haben Form und Größe. Alles scheint zu passen.
Und dann passt es doch nicht. Der Mann, der zum Denken auffordert, sieht am Ende des Bildes, dass er nicht genug nachgedacht hat. Der letzte Buchstabe passt nicht mehr aufs Bild, jedenfalls nicht in der Form der anderen Buchstaben. Am Ende muss er das „K“ noch seltsam hinquetschen. Sein schönes Bild geht schief.
Komik ist, wenn etwas in großem Ernst durchgeführt wird und dann schiefgeht. Der Komiker Loriot (1923–2011) konnte das perfekt darstellen. Ein Mann beginnt ein Liebesgeständnis in bester Kleidung und mit großem Ernst. Dabei hängt ihm eine kleine Nudel im Gesicht. Ein anderer Mann folgt seinem inneren Zwang und will nur ein kleines Bild gerade rücken – dabei zerstört er ein ganzes Wohnzimmer, weil er Vasen umstößt oder Regale zum Einsturz bringt. Wir müssen lachen. Der große Ernst eines Menschen wird lächerlich, weil ihm nichts gelingt.
2
Jetzt könnte man mitlachen – über sich selbst. Das wäre vermutlich der beste Weg. Viele können es nicht und werden schwermütig oder ärgerlich, geben wer weiß wem oder was die Schuld. Dabei sind sie es ganz alleine. Auf dem Bild ist der Maler schuld. Der letzte Buchstabe passt nicht aufs Bild. Die Männer bei Loriot sind selber schuld, wenn man über sie lachen muss. Sie stellen sich ungeschickt an – und versuchen dennoch, ernst zu wirken und zu bleiben. Das ist komisch.
Und wir? Vertragen wir es, Fehler zu machen? Schaffen wir es, darüber zu lachen – alleine oder gemeinsam mit anderen? Am Ende des Films „Alexis Sorbas“ (1964) stürzt etwas mühsam Erbautes ein. Nach dem ersten Schreck lacht Alexis Sorbas und sagt sinngemäß zu seinem Freund: Hast du etwas schon mal so schön zusammenstürzen sehen? Dann lachen beide. Und tanzen.
3
Hat Jesus gelacht? Ging ihm auch etwas schief, worüber er und die, die mit ihm lebten, herzhaft lachen mussten?
Ich denke Ja. Es wird nur nicht erzählt. Die Verfasser der Evangelien erzählen die großen Linien, nicht die kleinen Begebenheiten. An Alltagen kam es vermutlich auch zu kleinen Lächerlichkeiten, die dann auch des Lachens wert waren. Jesus war ein Mensch wie du und ich. Und Menschen machen Fehler. Wohl denen, die dann lachen können – über sich selber. Und weil Jesus den Himmel im Herzen hatte, wird er auch gelacht haben. Lachen befreit. Wer über sich lachen kann, ist ein etwas freierer Mensch. Wer nach einem Fehler verbissen daran arbeitet, den Fehler zu verteidigen, wirkt eher komisch wie bei Loriot.
Ernst genommen werden Menschen, die zu sich stehen. Und eben auch herzhaft lachen können über sich.
4
Der Maler auf dem Bild ist wohl noch nicht so weit, dass er lachen kann. Genau genommen endet seine Arbeit ja in einer kleinen Katastrophe. Alles stimmte, alles sah so gut aus – bis der letzte Buchstabe kam. Der vermasselt das ganze Werk. Sein Gesicht bleibt verschlossen. Und wir schmunzeln – und wissen zugleich, dass uns so etwas natürlich auch passieren kann (EG 497,3): „Es fängt so mancher weise Mann / ein gutes Werk zwar fröhlich an / und bringt’s doch nicht zum Stande“. Wir erkennen uns darin wieder. Es gehört zum Menschsein: Der große Plan und das Scheitern; der hohe oder höchste Anspruch und das Versagen; der Ernst des Tuns und das Lachen über die Fehler.
5
Wenn wir uns etwas Gutes tun wollen, dann dies: Wir nehmen uns ernst, wir nehmen unser Tun und Lassen ernst, wir nehmen unser Menschsein ernst und das der anderen auch. Zugleich nehmen wir das alles auch nicht zu ernst, sondern bedenken: es können Fehler geschehen. Ich meine jetzt nicht die tragischen Fehler und Schuld; die gibt es, sie müssen besonders bedacht werden. Nein, ich meine Alltagsfehler, bei denen keiner zu Schaden kommt und die eher lustig sind. Auch die gehören zu uns. Darüber müssen andere heimlich oder laut lachen. Lachen wir mit. Wer lacht, befreit sich ein wenig vom Ernst, von Bitterkeit. Wer lacht, macht sich leichter.
Wer über sich lachen kann, hat etwas vom Himmel im Herzen.
Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind

Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind
1
Ein Mann steht in einem leeren Raum. Der Raum ist dunkel. Der Mann dreht dem Betrachter den Rücken zu. Sein Blick ist auf eine Tür gerichtet, die offen steht. Helles, gleißendes Licht dringt von außen durch den Türspalt.
2
Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir am Rand eines Vulkans stehen, der jederzeit ausbrechen kann, und dann fliegt uns alles um die Ohren. Oder wir gehen noch einen Schritt weiter und fallen in den Schlund des Vulkans. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir am Abgrund stehen.
An jeder Ecke Krieg in der Welt und jetzt so nahe in der Ukraine. Überall Diktatur und Militär. Radikale, die sich bekämpfen, die nicht aufhören zu schießen, auch wenn schon alles zerstört ist. Die Ausbeutung unserer Erde geht weiter: Das Klima – am Ende. Die Meere – überfischt. Tiere, die wider ihre Geschöpflichkeit gehalten und geschlachtet werden. Artensterben überall. Rohstoffe – ohne Rücksicht auf Natur und Menschen ausgebeutet. Böden – überdüngt, Grundwasser belastet.
3
Zu jeder Tages- und Nachtzeit 10.000 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft, darin so viele Menschen wie Hamburg Einwohner hat. Überall Dreck und Müll und Verkehrskollaps in fast allen Städten. Geld und Bildung ungleich verteilt – global wie national. Radikale, die einfache Antworten skandieren, hier und anderswo. Menschen, die zu Hunderttausenden fliehen vor Krieg und Gewalt. Rüstungsindustrie – stetig auf Erfolgskurs.
Nur noch einen Schritt weiter, dann fallen wir. Nur noch eine kurze Zeit, dann bricht uns der Boden unter den Füßen weg. Ich werde dieses Gefühl nicht los.
Der Prophet Jesaja (5,20) mahnt: „Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen.“
4
Ich habe es einfach nicht mehr gekonnt, erzählt eine Frau. Ich konnte nicht mehr so weiterleben. Mein Mann sprach kaum noch mit mir. Jeden Tag dasselbe Einerlei. Dieselben Floskeln. Dieselbe Art zu funktionieren. Ich musste mich ablenken, mich trösten. Erst war es nur ein Gläschen am Abend. Dann waren es zwei, dann drei. Angenehme Bettschwere. Irgendwann merkte ich, dass die Leere leichter zu ertragen war, wenn ich auch zwischendurch mal ein Gläschen trank. Ab mittags zunächst. Dann auch schon nach dem Frühstück. Schließlich ordnete ich meinen Tag danach, wann ich wieder ein Gläschen trinken konnte. Mir schien das Leben leichter. Zwei, fast drei Jahre ging das so. Dann stürzte ich völlig ab. Mein Mann verließ eines Tages das Haus und kam nicht mehr zurück. Nun trank ich auch nachts, wenn ich aufwachte. Die Wohnung verwahrloste und ich mit ihr. An einer U-Bahn-Station bin ich dann zusammengebrochen, die Treppe hinuntergefallen. Passanten holten einen Rettungswagen, wie mir später erzählt wurde. Ich kam ins Krankenhaus, dann zur Kur. Einmal, zweimal. Ein langer Weg. Jetzt bin ich wieder trocken und kann sogar arbeiten. Ich habe Kolleginnen, mit denen ich ausgehe und alte Freundinnen sind zurückgekehrt. Nie hätte ich gedacht, dass mir das alles mal passieren könnte.
„Aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen“, verkündet der Prophet Jesaja. (26,19)
5
Ein Mann steht in einem dunklen Raum. Sein Blick ist auf eine Tür gerichtet, die offen steht. Helles Licht dringt von außen durch den Türspalt. Nur wenige Schritte, und der Mann könnte vom Dunkel ins Licht treten.
„Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind“, verheißt der Prophet Jesaja. (8,23a)
Petrus und der Geburtstag der Kirche

1
Seit Pfingsten ist ein besonderer Glanz in der Welt. Ein wenig davon sehen wir auf diesem Bild. Goldener Glanz in einem Fenster – Gold als Farbe Gottes. In der lichten Mitte des Goldes eine Taube, Zeichen des Heiligen Geistes. Das Fenster und die Skulpturen sind im Petersdom in Rom zu sehen. Das ganze Barockkunstwerk ist eine Art bronzene Hülle für den Stuhl Petri, also dem Stuhl, auf dem der erste Leiter der Kirche Jesu Christi auf Erden gesessen haben soll. Der goldene Glanz und der Heilige Geist kommen also zuerst auf Petrus nieder.
Dass er auf dem „Stuhl Petri“ sitzen konnte, verdankte Petrus seinem Bekenntnis zu Jesus und der besonderen Auszeichnung, die er dann von Jesus bekam, Hier der Text aus dem Matthäus – Evangelium:
Da kam Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist
Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? 16Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn! Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn;
denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. 18Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein.
2
Der britische katholische Schriftsteller Gilbert K. Chesterton (1874–1936), der Erfinder des Pater Brown, hat zu der Ernennung des Petrus Folgendes geschrieben:
Als Christus in einem bedeutungsvollen Augenblick Seine große Gemeinschaft stiftete, erwählte er zum Grundstein nicht den brillanten Paulus und nicht den tief innigen Johannes, sondern einen Drückeberger, einen Snob, einen Feigling – kurz, einen Menschen. Und auf diesen Fels baute ER Seine Kirche, gegen die der Hölle Macht* nichts hat ausrichten können. (*im Buch: Ketzer).
Das ist eine große und zugleich schlichte Wahrheit. Petrus war kein Held, als er ernannt wurde. Er wurde ein Held, weil Jesus es ihm zutraute. Die Kirche ist auf einem Felsen gegründet, der erst noch einer werden sollte. Bis zum Augenblick seiner Ernennung war Petrus ein Hallodri, der sich verdrückte, als es nicht mehr nach einem Vorteil für ihn aussah.
Was bedeutet das?
3
Das bedeutet, dass die Kirche niemals das war und niemals das sein sollte, was viele in ihr sehen: eine Gemeinschaft der Helden oder der „Ehrenwerten“. Das ist sie, auf keinen Fall. Im Gegenteil: Eigentlich sollten alle wissen: Hier, in der Kirche sind die Menschen, die wissen, dass sie Versager sind; die wie der Zöllner im Tempel im Angesicht Gottes nur noch zu sagen: Gott, sei mir Sünder gnädig!
Oft ist es ja leider anders. Oft rümpfen gerade die in der Kirche ihre Nase über die, die außen stehen, die nicht hineinzukommen wagen oder sich einfach zu schlecht fühlen, um sich angenommen zu wissen. Das ist, genau genommen, ein Skandal. Wir sind nicht die „Ehrenwerten“, auch wenn wir uns so fühlen. Die Kirche, die am ersten Pfingstfest mit dem Heiligen Geist beschenkt wurde, ist wie Petrus. In ihr haben alle die Platz, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Natürlich haben auch die anderen Platz; aber nicht einen Platz, von dem aus sie auf Menschen herabsehen könnten.
4
Der neue Glanz, der mit der Kirche in die Welt gekommen ist, scheint in die Dunkleheit der Welt. Kirche ist die, die sich um alle Entrechteten kümmert, um alle Ausgesonderten, um Hungernde und Dürstende und um alle, denen das Leben zu entgleiten droht. Dorthin scheint der Geist, in diesen „finsteren Seelen“ wird es golden, denn dort sucht und erfleht man Gott. Und wo nach Gott gesucht und nach ihm gefleht wird, nur da gehört die Kirche hin. Wir kümmern uns nicht um uns, wir kümmern uns um andere. Um uns kümmert sich Gott.
Die Jünger, Frauen und Männer, die am ersten Pfingstfest die Taufe und den Heiligen Geist empfingen, waren kleine und kleinste Leute – wenig beachtet von denen, die das Geld hatten und den Einfluss. Paulus schrieb an christliche Gemeinden, in denen sich die versammelten, die in den Dörfern und Städten unter die Räder kamen. Viele der ersten Christen starben als Verfolgte, mit dem Treuebekenntnis zu Gott auf den Lippen. Niemals war die Kirche eine Gemeinschaft von „Ehrenwerten“. Immer wieder waren es Verantwortliche in der Kirche, Menschen die scheinbar für „Kirche“ standen, Kirchenfürsten, die in Wirklichkeit aber hinter den Kulissen ihre schuldigen Verstrickungen lebten, während sie nach vorne hin so taten, als sei alles in Ordnung.
5
Der Glanz der Kirche des Heiligen Geistes scheint zu den Armen, den sich überflüssig Fühlenden, den Trauernden und den von der Welt im Stich Gelassenen. Das, und nur das, ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Die Kirche hat nicht mit der Macht zu dealen, sondern die Mächtigen darauf hinzuweisen, wo Hilfe notwendig ist.
Das ist die Kirche, die um ihre Zukunft nicht fürchten braucht. Sie mag äußerlich schrumpfen und an Einfluss und Mitglieder verlieren, aber das hält den Heiligen Geist nicht auf. Der kommt wächst und gedeiht.
Eine begeisterte Woche wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Gedanken für die Woche
Andachten zum Pflücken
Das Türmchen unseres Lebens

1
Wir sehen höchste Konzentration. Das Mädchen im schönen Kleid ist wie versunken in ihr Tun. Auf einem Wägelchen liegen viele Bücher. Sie liegen, aus unserer Sicht, etwas ungeschickt – und zwar so, dass das kleine Türmchen aus Büchern bald umkippen könnte. Das möchte das Mädchen verhindern. Deswegen schaut sie ernst, beinahe streng, als wolle sie den Bücherturm ermahnen, bloß ruhig liegen zu bleiben. Dabei können wir nicht genau erkennen, ob das Mädchen ihr Wägelchen schieben oder ziehen will.
Ein Mädchen und Bücher, das ist eine schöne Überraschung. Es geht mal nicht um einen großen oder kleinen Bildschirm, es geht einfach nur um Bücher. Das Bild ist ja auch schon etwas älter. Ob die Fantasie ausreicht, uns vorzustellen, was das Mädchen damit vorhat? Möchte sie die Bücher zu einem Freund oder einer Freundin bringen? Oder zu sich nach Hause? Ist sie auf dem Weg zur Stadtbibliothek, um die Bücher dort abzugeben und sich neue zu auszuleihen?
Bücher lesen oder Bücher vorgelesen zu bekommen, ist nicht mehr so selbstverständlich wie früher. Etwas aber ist geblieben. Wer Bücher liest oder vorgelesen bekommt, wird sprachfähiger. Wer viel mit Wörtern zu tun hat, weiß sie besser zu nutzen.
2
Es gibt auch eine Sprachfähigkeit im Glauben! Beten ist Sprachfähigkeit. Wer betet, drückt sich aus, kann sich und seine Lage in Worte fassen. Wer betet, will das: „sich ausdrücken, etwas aus sich herausbringen.“ Man fürchtet ein wenig zu ersticken, wenn man etwas nicht in Worte und in ein Gebet fasst. Beten bedarf der Sprachfähigkeit. Das ist der erste Teil der Hilfe. Manche beten, weil sie sonst nicht wüssten, wem sie ihr tiefstes Leid anvertrauen könnten. Gott petzt nicht. Er verrät uns nicht an andere, erzählt nichts weiter. Bei ihm sind meine Worte gut aufgehoben.
Und natürlich hofft man beim Beten auf irgendeine Form von Antwort. Das ist der zweite Teil der Hilfe. Wer sich gegenüber Gott ausdrückt, hat Wünsche, möchte danken oder bitten oder loben. Vermutlich, so ehrlich sollten wir sein, geht es meistens – vielleicht auch zu oft – nur ums Bitten. Der Dank gerät dann ein wenig zu kurz, wenn wir beten.
3
Wir hoffen, im weitesten Sinne, auf Gottes Hilfe. Wir hoffen, bildlich gesprochen, dass unser Türmchen auf dem Wägelchen des Lebens nicht einstürzt, dass wir bewahrt werden und bleiben – dass wir behütet sind in allem, was wir tun und lassen. Auf diese leisen und deutlichen Hoffnungen antwortet uns der Wochenspruch (Psalm 66,20), der mit einem Lob beginnt: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet.“ Zweierlei verspricht der biblische Satz: Gott verwirft mein Gebet nicht, er nimmt es ernst. Und: Gott wendet seine Güte nicht von mir. Wie ich mich an ihn gewandt habe, so bleibt er mir zugewandt.
Der Wochenspruch verspricht nicht, dass Gott meine Gebete erfüllt. Er verspricht die Aufmerksamkeit und die Güte Gottes. Das soll mir, zunächst, genügen. Es kann aber sein, dass mir in Wochen, Monaten oder Jahren etwas widerfährt, was ich als Antwort Gottes auf meine Gebete erkenne.
4
Gott antwortet mir nicht zu Gefallen. Gott antwortet nach seiner Güte. Das kann ein großer Unterschied sein. Sollte das Mädchen auf dem Bild eine Art Stoßgebet senden, kann ihr Türmchen aus Büchern immer noch umfallen. Das lehrt dann auch etwas, nämlich: ordentlicher und vielleicht weniger zu stapeln.
Gottes Güte entspricht oft nicht dem, was mir gefallen würde. Und wenn es mir nicht gefällt, lehrt es mich etwas. Dafür könnte ich dann dankbar sein, wenn möglich.
5
Vielleicht können wir auf dem Bild die Türmchen unseres Lebens sehen. Manche schichten ordentlich, andere eher wild – manche hastig, andere planvoll. Eine Garantie, dass nie etwas fällt oder einstürzt, gibt es nicht. Auch die Planvollsten werden manchmal von etwas, wie man so sagt, „kalt erwischt“.
Wie immer wir gerade unser Leben und die verschiedenen Türmchen in ihnen sehen – machen wir es doch wie das Mädchen im schönen Kleid: Achten wir sorgsam auf alles; bringen wir etwas Ordnung in das Schiefe; schichten wir anders oder um; nehmen wir uns am besten etwas weniger vor. Und wenden wir uns mit unserer Sprachfähigkeit an den, der uns und unser Leben gewollt hat. Sprechen und beten wir zu ihm, der seine Güte nicht von uns wendet:
Gott, der du Vater und Mutter bist,
führe mich an deiner Hand,
dass ich nicht falle;
und lass mich auch im Schmerz fühlen,
dass deine Güte um mich ist. Amen.
Dem Leben ins Gesicht lachen

1
Schauen, staunen und lachen – auf schönste Weise sind die Kinder abgelenkt. Sie sehen den Clowns direkt ins Gesicht, zeigen auf die rote Nase, sind vielleicht etwas angespannt und wissen noch nicht so genau, was vor sich geht. Auf jeden Fall aber vergessen sie, wo sie sind und was sie möglicherweise bedrückt.
Auf der anderen Seite, vor dem Bett, sind zwei Erwachsene, die sich ein wenig verkleidet und geschminkt haben, um Abwechslung ins Zimmer zu bringen. Ein paar Scherze, vielleicht kleine Zauberkunststücke, bestimmt aber ein Lachen. Lachen mit Herz. Dazu eine dicke, rote Nase, auf die ein Kind gerade zeigt.
Die Krankenhausclowns bringen Freude, Vergessen, Abwechslung – und Lachen mit Herz. Sie erfüllen auf denkbar einfach Weise, was sich der Apostel im Brief an die Gemeinde der Stadt Kolossä so sehnlichst wünscht: Zieht nun an … herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld.
Vielleicht kann man das manvchmal so formulieren: „Krankenhausclowns sind so etwas wie Heilige mit dicker, roter Nase.“
2
Das brauchen wir manchmal: Vergessen, Ablenkung und Lachen. Das Leben ist im Allgemeinen eine ernste Sache. Die letzten Monate haben uns gelehrt, dass die ganze Welt aus den Fugen geraten kann: Unsere Welt ist krank und müsste gleichsam ins Krankenbett gelegt werden. In 2020 und 2021 haben wir monatelang kaum über etwas anderes nachdenken können als über Zahlen von Erkrankten und Sterbenden sowie die Überlastung von Personal in Krankenhäusern. Wir waren (oder sind noch?) direkte Zeuginnen und Zeugen einer schwer erkrankten Welt. Viele fühlten sich wie eingesperrt. Was hilft dann?
Uns wie noch einmal ganz anders krank ist das, was sich gerade in der Ukraine abspielt.
Was tut uns gut? Auch mal Ablenkung und Lachen, zum Beispiel. Oder Musik, Singen. Vielleicht dürfen die Clowns im Krankenhaus, die Heiligen mit dicker, roter Nase, auch mal ein Lied singen mit den Kindern. „Mit Musik geht alles besser“, sang ab 1943 der deutsche Sänger Rudi Schuricke (1813–1973). Und wenn es auch nicht gleich besser geht und schon gar nicht besser wird, dann geht es wenigstens etwas leichter (für den der singt)
3
Mit Musik, mit Singen, wird alles etwas leichter. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Musik und Gesang auch nicht selten missbraucht wurde, auch von Despoten und Diktatoren benutzt wird, um von ihren bösen Taten abzulenken. Das ist schlimm. Für unsere Alltage gilt aber trotzdem: Musik und Singen machen vieles leichter. Weil wir leichter werden. Darum erbittet der Apostel im Brief an die Gemeinde in Kolossä: Singt Gott dankbar in euren Herzen.
Das war ja auch immer so: Die Geknechteten, Verwundeten und Verängstigten hatten ihre Lieder, ihre Musik. Wer sich zu schwer wird – wem das Leben und wer sich selbst zu schwer wird – kann etwas leichter werden: durch Musik. Sie erhebt ein wenig vom schweren Boden. Vielleicht, wer weiß, macht sie uns sogar dankbarer dafür, dass wir leben dürfen.
4
Wir leben gerade wieder im österlichen Licht. Die hoffnungsvolle Botschaft, dass immer mehr Leben ist als Tod, wurde uns zugesagt vor vier Wochen. Da ringen wir immer mit dem Verstehen: Wie ist das möglich, dass ein Toter von den Toten aufersteht? Wie soll das gehen?
Das können und müssen wir nicht verstehen. Viel wichtiger ist, was diese Botschaft aus uns und mit uns machen kann: Sie kann uns leichter machen. Wir müssen das Leben und das Schwere im Leben nicht mit Bitterkeit betrachten und müssen nicht alles nur schwer seufzend erleiden. Wir können dem allem etwas entgegensetzen: das Band der Liebe; das Band der Vollkommenheit. Auch davon liegt etwas in der Musik, im Gesang.
5
Könnten wir doch ein wenig lieben, wie Clowns lieben. Sie lachen dem Leben ins Gesicht. Aber sie machen sich niemals lustig, höchstens über sich selbst. Leben, als lachten wir dem Leben ins Gesicht, als könnten wir der Schwere ein wenig Leichtigkeit entgegensetzen. Das geht, manchmal. Selbst Menschen mit vielen Tränen haben schon gesungen und dabei zum Lächeln gefunden, jedenfalls für ein paar Augenblicke.
Leichte Augenblicke im schweren Leben bleiben nicht ohne Folgen. Im Wohlklang liegt die Hoffnung, dass Gott größer ist als mein Schmerz. Wer sich in eine Melodie hineinlegt, fühlt sich geborgen. Und dankt Gott für den Klang und das Geschenk der Musik.
Musik ist Gottes Geschenk an uns Lebende. Musik lacht dem Leben ins Gesicht.
Eine Woche voller Musik wünschen Ihnen, Ihre
Arno Wittekind, Domini Kettling und Johannes Ditthardt
Bleiben sie gesund
Die Himmel rühmen
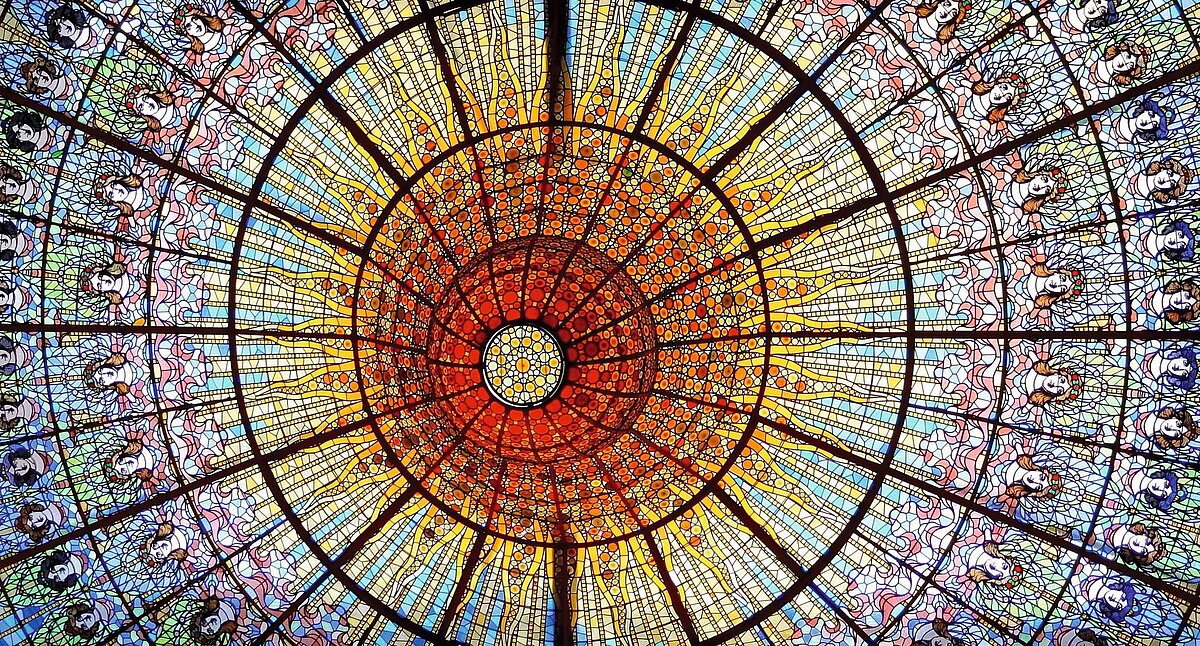
1
Um den Himmel zu sehen, muss man manchmal den Kopf in den Nacken legen. Den Himmel ganz oben, wo er am höchsten ist – sonst sieht man nur den Horizont. Und wenn man Glück hat und an einem Ort wie diesem ist, sieht man dem ersten Schöpfungswerk direkt ins Gesicht, dem Licht, glutvoll und gleißend.
Ein Zelt wie aus Glas, zart und doch kraftvoll, durchlässig und doch erhaben. Die Sonnenstrahlen aus der Mitte umfassen lichtes Blau. Aus der Sonnenmitte fällt das Licht wie ein Tropfen heraus. Das gläserne Zelt spannt sich als kostbares Funkeln über den Köpfen aus.
2
An einem Ort wie diesem kann es gar nicht anders sein. Niemand sitzt hier mit gesenktem Haupt. Hierher kommt man, um erhoben zu werden, um von einem Tropfen Licht getroffen zu werden und dann selber zu leuchten. Nein, eine Kirche ist dieser Ort nicht. Er ist ein Konzertsaal. Er steht in Barcelona und wurde vor allem für die Nutzung durch Chöre gebaut, vor über 100 Jahren im Jugendstil gestaltet. Und die Decke ist geziert durch dieses riesige Glasmosaik. Die Sonnenstrahlen hier oben, das kostbare Funkeln geht mit dem Blau über in viele, sehr viele Gesichter, die wie in einem himmlischen Chor um die Mitte herum angeordnet sind, engelsgleich.
Und vielleicht stimmt es ja, dass der Gesang wie die Musik der Engel ist und damit dem Himmel am Nächsten kommt.
3
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und seiner Hände Werk zeigt an das Firmament. Dem kommenden Tage sagt es der Tag, die Nacht, die verschwand, der folgenden Nacht. In alle Welt ergeht das Wort, jedem Ohre klingend, keiner Zunge fremd.
Ein Psalm, in dieser Fassung vertont vor 220 Jahren von Joseph Haydn (1732–1809) in „Die Schöpfung“. Von Musikern und Musikerinnen oft in diesem Konzertsaal in Barcelona aufgeführt. Aber wer im Parkett würde während der Musik schon den Kopf in den Nacken legen und zur Decke – pardon – zum Himmel schauen?
Dabei scheint doch der biblische Text dieses Oratoriums dem gläsernen Mosaik hier Pate gestanden zu haben. Denn in Haydns „Schöpfung“ besingen die drei Erzengel Gottes Werk. Wer auch sonst? Und tatsächlich sind im Mosaik drei unterschiedliche Gesichter als Engelschor eingearbeitet. Engel, die Menschen dazu inspirieren, die Schöpfung zu loben. Haydn fand sein Thema übrigens mehr als inspirativ. Er hat mal gesagt, die Komposition war für ihn eine grundlegende religiöse Erfahrung. „Erst als ich zur Hälfte in meiner Komposition vorgerückt war, merkte ich, dass sie geraten wäre; ich war auch nie so fromm, als während der Zeit, da ich an der Schöpfung arbeitete; täglich fiel ich auf meine Knie nieder, und bat Gott, dass er mir Kraft zur glücklichen Ausführung dieses Werkes verleihen möchte.“
4
Kann ja wirklich sein, dass der Mensch nicht nur in Kirchen fromm wird, sondern auch an solchen Orten. Um Gott zu loben, auch dazu gehen wir in die Natur oder in den Konzertsaal. Um Gott für die Schöpfung zu danken – dann doch gerne wieder in die Kirche.
Herzliche Einladung
Der Ladenhüterhirte

Gedanken zum Wochenspruch aus Johannes 10
1
Schon seit vielen Wochen steht es in der hinteren Ecke einer Flohmarkthalle und wartet auf einen Käufer. Eine großformatige Darstellung von Jesus als dem guten Hirten, wie sie früher in manchem Wohnzimmer zu finden war. Das Bild wirkt wie aus der Zeit gefallen mit seinem weichgezeichneten und etwas kitschigen Stil. Sowohl die Art der Darstellung als auch die Bildersprache vom Schaf und den Hirten haben kaum noch eine Verbindung zu unserem modernen Alltag. Und so habe ich meine Zweifel, ob sich überhaupt noch eine Käuferin oder ein Käufer für diesen Ladenhüter findet.
2
Und doch gibt es offenbar etwas an diesem alten Motiv vom guten Hirten, das auch in unserer Zeit immer noch Menschen anspricht und berührt. Wenn in Gottesdiensten oder Trauerfeiern Psalm 23 gebetet wird, bin ich immer erstaunt, welche Kraft in diesem Bild vom guten Hirten steckt. Wenn wir gemeinsam beten: „ Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln …“ lässt sich manchmal spüren, wie sehr diese alten Worte Trost, Geborgenheit und Vertrauen vermitteln.
Auch Jesus beschreibt mit diesem Bild seine Beziehung zu den Menschen, die mit ihm verbunden sind: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.
Ihm geht es vor allem um das Hören: Kaum ein Tier hat solche Probleme mit der Orientierung wie ein Schaf. Anders als z.B. eine Ziege ist ein Schaf auf Hilfe angewiesen, um seinen Weg nach Hause zu finden. Es ist angewiesen auf die Stimme des Hirten, von dem es Orientierung und Richtung erhält.
3
Vielleicht ist diese Suche nach Orientierung und das Hören auf die richtigen Stimmen heute aktueller denn je.
In der Menschheitsgeschichte hat es noch keine Generation geben, die so vielen Stimmen und Meinungen ausgesetzt war wie die heutige. Den Menschen in unserer Gesellschaft erreichen nach wissenschaftlichen Erhebungen jeden Tag durchschnittlich 90–120 Werbebotschaften mit hirnphysiologisch nachweisbarer Wirkung. Derzeit wird jeder Deutsche pro Tag mit rund 6.000 Informationen konfrontiert. Dazu kommt das Phänomen der Fake-News, die es uns immer schwerer machen, in dem lauten Durcheinander der Stimmen und Meinungen die Orientierung zu behalten.
So stellt sich die Frage: Welcher Stimme folge ich? In den sozialen Medien wie Facebook, Twitter oder Instagram kommt es entscheidend darauf an, wem ich folge, wo bin ich „Follower“, auf wessen Nachrichten und Bilder lasse ich mich ein. Diese Quellen beeinflussen die Art, wie ich denke, und den Weg, den ich gehe.
4
Von daher kommt es für die Menschen, die sich an Jesus orientieren wollen, darauf an, seine Stimme aus den unzähligen Stimmen und dem Lärm der Zeit herauszuhören. „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir“, sagt Jesus. Diese Art von „Schaf-Sein“ hat nichts mit einem gedankenlosen Mitlaufen im Schutz der Herde zu tun, das auf eigenes Denken und Fühlen verzichtet. Es beschreibt vielmehr das Leben aus einem inneren Zentrum heraus, in dem ich mich mitten in allen Unsicherheiten und Kämpfen des Alltags geborgen und gehalten weiß. Es beschreibt das Wissen um eine Stimme, die es gut mit mir meint und die mir hilft, meinen Weg zu finden.
Ich vermute, dass der Maler des Hirtenbildes, das immer noch in der Flohmarkthalle steht, genau das vor Augen hatte. Sein Bild mag in der heutigen Zeit ein Ladenhüter sein. Das Motiv vom guten Hirten ist es mit Sicherheit nicht.
Das Erblühen der Seele

Gedanken zum Gebet des Jona im Bauch des Wals (Jona 2,1-11)
1
Der Widerspenstige ist gezähmt. Ein sehr kleiner Mensch in einem sehr großen Wal ringt seine Hände. Er ringt sie in Richtung des bisschen Licht, das noch zu ihm dringt im Bauch des Wals. Der Wal ist Jonas Strafe, wir wissen das.
Jona war auf der Flucht vor Gott. Gott hatte einen Auftrag für ihn, vor dem sich Jona fürchtete. Er versuchte, vor Gott zu fliehen. Seltsam ist, dass Jona meint, vor Gott davonlaufen zu können, sozusagen in die Gegenrichtung. Er findet ein Schiff, von dem er meint, es entferne ihn von Gott. Da irrt er natürlich. Das Schiff ist Gottes Werkzeug. Und Jona bleibt Gottes Diener, auch wenn er das Gegenteil will. Als das Schiff, das Jona von Gott wegbringen soll, in schwere See gerät, wirft die Besatzung Jona ins Meer, um Gott gnädig zu stimmen. Das gelingt gleich doppelt. Das Meer wird still – und Jona wird gerettet von einem Wal.
Was für eine herrliche Geschichte. Du, Mensch, kannst doch vor Gott nicht davonlaufen; und vor seinem Willen und Auftrag auch nicht.
2
Im Bauch des Wals kommt Jona zur Besinnung. Drei Tage und Nächte verbringt er da, wie Jesus in seinem Grab. Im Bauch des Wals tut Jona das, was er dort noch kann: er betet. Und wie er betet. Voller Angst, voller Zutrauen. Er betet sich, könnte man sagen, die Seele aus dem Leib. Erst vor Angst (Vers 3):
Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst,
und er antwortete mir.
Ich schrie aus dem Rachen des Todes,
und du hörtest meine Stimme.
Jona scheint froh, dass Gott überhaupt noch hört, wo er doch gerade vor Gott davonlaufen wollte. Und als er seinen ganzen Schmerz herausgebetet hat, beginnt wieder das Erblühen seiner Seele (Vers 8):
Als meine Seele in mir verzagte,
gedachte ich an den HERRN,
und mein Gebet kam zu dir
in deinen heiligen Tempel.
Aus der Finsternis, aus dem Bauch des Wals bewegen sich die Worte direkt in den heiligen Tempel. Es gibt keinen Ort in der Welt, von dem aus man Gott nicht erreichen könnte.
3
Das kleine Buch des Propheten Jona ist tiefe jüdische Weisheit. Das Leben ist Angst; zugleich ist es Hoffnung – und es wird gelebt unter den Augen Gottes. Gott hat einen Willen; er erwartet unseren Dienst und verlangt auch etwas. Manchmal greift er ein.
Menschen, wenden sich an Gott in ihrer Angst; sie bitten Gott, er möge ihr Geschick verändern. Manchmal geschieht das und Menschen werden froh. Manchmal ändert sich nichts und Menschen werden auch froh, weil sie sich mit ihrem Geschick versöhnen. Und es gibt Menschen, die bleiben ratlos zurück. Das Büchlein des Propheten Jona sagt: Gott ist wie der Himmel über dir. Du entkommst ihm nicht, falls du das möchtest. Und wenn uns das Buch Jona und das Geschick des Propheten einen Rat geben will, dann ist es dieser: Setze dich lieber mit Gott auseinander. Du kannst vielleicht ohne Gott dein Leben leben; aber du kannst ohne Gott dein Leben nicht verstehen.
4
Das lernt Jona, schmerzhaft. Er kann laufen, wohin er will – Gottes Wille geschieht. Und in der tiefsten Dunkelheit, im Bauch des Wals, erkennt er das auch:
Als meine Seele in mir verzagte,
gedachte ich an den HERRN.
Manche finden über ihre Verzagtheit zu Gott. Es muss doch mehr sein, denken sie dann, es muss doch mehr in meinem Leben sein als Verzagtheit. Und verstehen und erfahren wie Jona (Vers 10):
Hilfe ist bei dem HERRN.
Das ist Lebenserfahrung.
5
Es sollte auch unsere österliche Erfahrung werden, möglichst. Es zwingt uns niemand, mit Gott zu leben. Es hilft uns aber, mit ihm zu leben und manches in unserem Leben besser zu verstehen. Und wenn wir, wie Jona, manches andere auch nicht verstehen, können wir doch wie er unsere Hände ringen und sagen:
Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst …
Der HERR wird uns antworten, glaube ich. Er wird uns in keiner Dunkelheit lassen, wie er Christus nicht im Grab ließ. Achten wir mit allen unseren Sinnen darauf, wie Gott sich uns zeigt. Vertrauen wir denen, die wie Jona gebet haben:
Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst,
und er antwortete mir.
Und unsere Seele kann wieder erblühen.
Vollendung
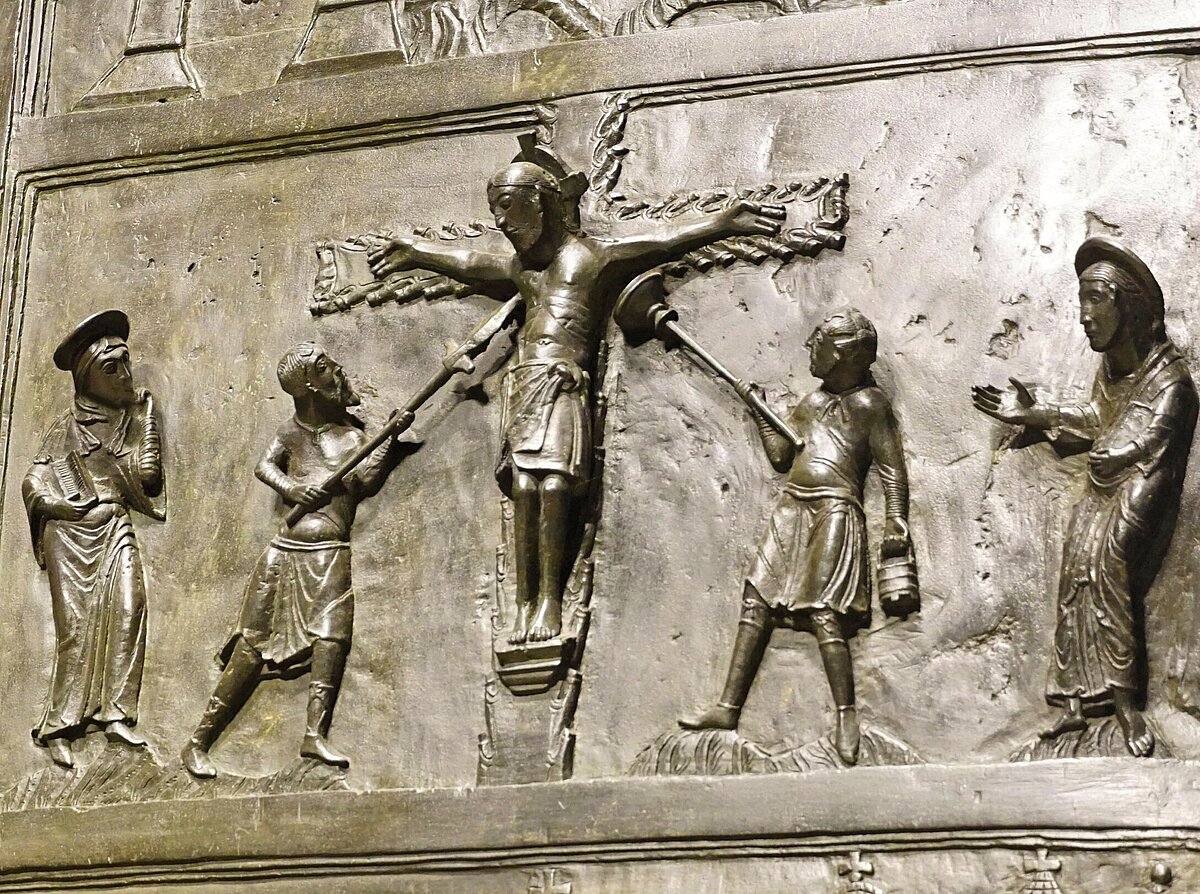
1
Christlicher Glaube, in Bronze gegossen: so kann man die Szenen der Bronzetür im Hildesheimer Dom bezeichnen. Vor etwas mehr als tausend Jahren – um das Jahr 1015 – ließ Bischof Bernward von Hildesheim diese Türen anfertigen. Auf 16 Feldern werden die ersten Geschichten aus dem Alten Testament von der Erschaffung des Menschen bis zum Brudermord Kains in Bildern erzählt; und auf der anderen Seite die Geschichte Jesu von der Verkündigung an Maria bis zu seiner Auferstehung gegenübergestellt.
Auf mich wirkt die Darstellung der Kreuzigung besonders ausdrucksstark, weil die Figuren aus dem Bild herausragen.
Alles konzentriert sich in dem Bild auf die Figuren. Als Hintergrund wird nur der Erdboden angedeutet, alles andere ist unwichtig. Alles ist auf die Mitte – Jesus am Kreuz – ausgerichtet. Darunter der Soldat, der Jesus mit der Lanze in die Seite sticht, und der andere, der ihm Essig zu trinken gibt. Außen noch Maria, die Mutter Jesu, und der Jünger Johannes.
2
Eine Kreuzigungsdarstellung wie viele andere? Wenn man genauer hinschaut, kann man entdecken, wie außergewöhnlich dieses Relief ist. Nicht nur kunsthistorisch gesehen, sondern vor allem in der Botschaft des Glaubens, die hier zum Ausdruck kommt. Je länger ich auf Christus in der Mitte schaue, desto ungewöhnlicher erscheint mir seine Darstellung. Auf den meisten Bildern der Kreuzigung wird das Leiden Christi mehr oder weniger drastisch dargestellt – mit schmerzverzerrtem Gesicht und einem Körper, der auch von Schmerzen gezeichnet ist. Wie anders ist es hier: Jesus erscheint ruhig und gesammelt; er schreit nicht, sondern sieht freundlich zu den Menschen. Er wirkt weniger leidend als fast verklärt.
Erst in späterer Zeit ist das Leiden in den Mittelpunkt der Kreuzigungsbilder gerückt. In gotischen Kathedralen kann man Jesus als den Schmerzensmann sehen. In früherer Zeit dagegen wird Jesus ganz anders dargestellt: Er ist es, der die Welt mit Leid und Tod besiegt hat, er schenkt das ewige Leben. Dahinter steckt kein künstlerisches Unvermögen, sondern eine klare Vorstellung, wie wir im Glauben das Kreuz verstehen können.
3
Auf diesem Bild ist in Szene gesetzt, wie das Leiden und Sterben Jesu im Evangelium des Johannes erzählt und gedeutet wird. Da wird der Kreuzestod mehrmals als Erhöhung bezeichnet. So wie das Kreuz aufgerichtet wird, so wird der Christus zu Gott erhöht. Nach dem Johannesevangelium betet Jesus, bevor er gefangen genommen, gefoltert und hingerichtet wird; in dem Gebet sagt er: „Ich habe auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht. Denn ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Lass nun an mir deine Herrlichkeit wieder sichtbar werden.“ (Joh. 17,4-5a)
Wenn man genau hinsieht, erkennt man noch eine weitere Besonderheit. Auffällig ist die Haltung seiner Finger: An beiden Händen hält Jesus den Daumen zu Zeige- und Mittelfinger, der vierte und fünfte Finger sind zusammen etwas abgespreizt. Sieht aus, wie der Vulkaniergruß aus der Enterprise – Saga (Lebe lang und in Frieden) ist aber eine alte Segensgeste; Jesus breitet die Arme aus und segnet die Menschen, insbesondere Maria und Johannes. Noch am Kreuz sagt Jesus nach Johannes zu Maria (19,26-27): „Frau, siehe, das ist dein Sohn“; und zu Johannes sagt er: „Siehe, das ist deine Mutter.“ Unter dem Kreuz, unter dem Segen entsteht neue Gemeinschaft. So schenkt Jesus Leben und vollendet sein Werk der Liebe.
4
Wenn man sich vor der Tür befindet, dann stehen auch wir als Betrachter des Bildes unter dem Kreuz. Das Bild befindet sich nämlich auf der Bronzetür etwa einen Meter über unserer Augenhöhe. Wir können hinaufblicken zu dem am Kreuz hängenden Jesus. Voll Liebe schaut er auch uns an. Und er schenkt uns das Leben, das wahre Leben. Das Leben ist vorsichtig angedeutet. Aus den Kreuzesbalken wächst es wie kleine Knospen. Das ist unsere Hoffnung – oder mit den Worten eines neuen Liedes aus dem Gesangbuch (EG 97,1):
„Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht,
ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht.“
Und sie flochten eine Krone aus Dornen

Und sie flochten eine Krone aus Dornen …
1
Ob im Tower von London, in der Hofburg in Wien, im Louvre in Paris oder auch im Schloss Charlottenburg in Berlin – Kronjuwelen gehören zu den am meisten bestaunten Insignien dieser Welt. Kein Wunder. Meist aus purem Gold gefertigt und mit seltenen Edelsteinen besetzt stellen sie rein materiell einen unermesslichen Wert dar. Dazu sind sie von den besten Goldschmieden ihrer Zeit überaus kunstvoll verziert. Vor allem aber sind sie jahrhundertelang Zeichen der Würde und Macht von Kaisern und Königen gewesen. Die Krone als Symbol für Herrschaft, Reichtum und Macht, die bis heute zahlreiche Besucher anlockt.
2
Eine ganz andere Krone befindet sich heute in der Kathedrale Notre-Dame de Paris in Frankreich. Es handelt sich um die Reliquie der Dornenkrone, die Jesus getragen haben soll. Die Bibel erzählt in den Passionsberichten, dass Jesus von römischen Soldaten gegeißelt und anschließend verspottet wurde. Mit einem roten Mantel und eben jener Dornenkrone auf dem Kopf trieben sie ihren Spott und machten sich lustig über den „König der Juden“. Die Dornenkrone ist seitdem Symbol von Leid und Ohnmacht, Hohn und Spott. Das genaue Gegenteil der goldenen Kronen in den Schatzkammern dieser Welt. Dornenkronen wollen wir nicht sehen, Kronjuwelen beeindrucken.
3
Die Krone für Jesus hatten die Soldaten aus Dornengestrüpp geflochten, das am Prätorium, dem Sitz des römischen Befehlshabers, wild gewachsen war. Heute hätte man sich wohl keine Mühe gemacht, Dornensträucher zu flechten. Heute hätte man einfachen Stacheldraht genommen und daraus eine Stacheldrahtkrone geflochten. Daran erinnert das moderne Kruzifix eines polnischen Künstlers.
Er hat Anfang der 60er-Jahre des letzten Jahrhunderts aus Stacheldraht eine Kreuzesdarstellung geformt, die eine ganz besondere Ausstrahlung hat. Ohne Kreuz ist nur der reine Corpus aus mittlerweile angerostetem Metall modelliert. Abgemagert, nur noch aus Haut und Knochen bestehend, wird Jesus dargestellt. Selbst die Rippen sind nur angedeutet. Die dürren Arme und Beine sind übersät mit Beulen und Geschwüren. Dünn wie Streichhölzer sind die Finger der Hände teilweise verkürzt, während die Zehen an den Füßen überlang wirken. Um die Hüften mit einem angedeuteten Tuch dürftig bedeckt, ist Jesus den Blicken derer ausgesetzt, die seine Hände und Füße mit Nägeln ans Kreuz geschlagen haben. Sein Kopf ist leicht geneigt. Die Augen nur noch leere Höhlen.
4
Auf dem Kopf eine Krone aus Stacheldraht. Kein Zeichen für Reichtum und Macht wie bei den Königen der Jahrhunderte, sondern ein Symbol der Solidarität für alle Leidenden, die hinter Stacheldraht eingesperrt sind, für alle Gefolterten und Ermordeten, für die Vergessenen
und die in Massengräbern verscharrten Seelen.
Ich bin einer von euch, sagt dieser Jesus.
Der Künstler hat ihn aus dem Stacheldraht geformt, der einst das Konzentrationslager von Auschwitz umzäunte. Aus dem Symbol für Gewalt, Unterdrückung und Unfreiheit ist mit dem „Auschwitzer Christus“ ein Symbol für Gewaltlosigkeit und Frieden, Freiheit und Versöhnung geworden. Gerade darin entfaltet er eine unglaubliche Strahlkraft, die kein Gold und keine Edelsteine braucht. Im Gegenteil. Es ist eine Kraft, die sich „in der Schwachheit vollendet“ (2. Korinther 12,9) und auf diese Weise all denen Kraft schenkt, die an ihn glauben und ihm vertrauen.
Eine friedvolle und gesegnete Wochen wünschen Ihnen Ihre Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Durch ein finsteres Tal

1
Ein nordischer Himmel zwischen schweren Wolken. Die Sonne ist schon untergegangen; noch färbt sie den Horizont, doch bald wird sich Nacht über das Land senken. Zwei Frauen, links und rechts kniend vor einem Grabkreuz. Die eine jung und nackt, die andere betagt und in der Tracht der Alten. Letztere trägt die Züge der Mutter der Künstlerin, der dänischen Malerin Anna Ancher. Die junge Frau dagegen bleibt anonym. Auf dem Kreuz ist keine Inschrift zu erkennen, es findet sich auch keine Namenstafel. Dass das Grab auf dem Friedhof von Skagen, der Heimat der Malerin, platziert ist, gilt allerdings als sehr wahrscheinlich.
Irritierend ist die Nacktheit der jungen Frau. Was hat es damit auf sich? Schutzlos kniet sie da, den Kopf gesenkt, ihr Gesicht hinter den Haaren verborgen. Weint sie? Es ist nicht zu erkennen. Eher tapfer und ergeben als verzweifelt wirkt auf mich die Frau zur Rechten. Kniend, gesammelt, die Augen geschlossen, die Hände gefaltet. Traurig und trauernd, ja, doch nicht gebeugt. Das schwarze Gewand, die Kopfbedeckung sind wie ein Schutz. Ein bisschen wirkt sie auch, als sei sie in einer anderen Welt. Etwas Unwirkliches hat dieses Bild.
2
„Sorg“ – dänisch für „Trauer“ – hat Anna Ancher ihr Werk genannt. Sie wurde durch einen Traum zu dieser Szene inspiriert. In einem Interview aus dem Jahr 1929 beschreibt sie ihr Traumbild so: „Ich sah, wie sich auf einem Friedhof unter einem Kreuz Mutter und Tochter trafen. Die Mutter kniete und die Tochter beugte sich über sie. Eine von ihnen war gestorben. Dieses Treffen auf dem Friedhof erzeugte einen so lebendigen Eindruck in mir, dass ich am nächsten Tag zu malen begann.“ Wer diese beiden sind, wissen wir nicht.
3
„Wer trauert hier um wen? Beklagt die Mutter den Tod der Tochter? Fragt sie sich, was nun werden wird? Vielleicht ist sie schon verwitwet. Wer wird nun für sie sorgen im zunehmenden Alter? Wird das, was sie hat, zum Leben reichen? Oder sorgt sie sich um die Verstorbene? Um ihre Seele? Darum, dass sie gut aufgehoben ist im Jenseits, im anderen, ewigen Leben? Oder ist es die junge Frau, die den Tod der Mutter betrauert?
Ihre Nacktheit wirkt wie ein Zeichen der Hilflosigkeit und großer Verletzlichkeit. Welche Beziehung hatte sie zu ihr? Was macht sie so schutzbedürftig? Macht ihr die Vorstellung Angst, nun allein zu sein?
Ganz ins Gebet vertieft sind die beiden. Da, wo sie jetzt sind, bleibt ihnen nicht mehr, als die Hände zu falten. Kein Funke von Aufbegehren ist da, und es scheint, als könne jeglicher Trost und alle Hilfe nur von außen kommen. Zugleich entsteht neben dem Eindruck ihrer innigen inneren Verbindung der Eindruck einer Dreiecks-beziehung. Da sind die beiden, und in ihrer Trauer begegnet ihnen noch ein Drittes oder ein Dritter. Einer, etwas, das sie tröstet?
4
Es liegt wohl nicht nur äußerlich die Nacht vor ihnen, auch in den beiden mag es dunkel sein. Wer weiß, welche Geschichte sie verbindet. Ein finsteres Tal, das sie – die Lebende und die Verstorbene – gemeinsam durchschreiten müssen. Ein Tal, das sich nur betend durchschreiten lässt ...
Sprich du das Wort, das tröstet und befreit
und das mich führt in deinen großen Frieden.
Diese Worte von Lothar Zenetti lege ich den beiden in Herz und Seele und bete sie für sie, auch wenn ich eigentlich gar nichts weiß über die beiden. Möge die Nacht über ihnen nicht zu lange währen.
Egal, in welcher Situation sie, die Leser*innen sich befinden, wir wünschen Ihnen eine friedvolle Woche und dass sie sie getröstet begehen können.
Loslassen um Neues zu wagen

Gedanken zu 1 Könige 19,1-13a
1
Eine Frau lehnt halb liegend, halb sitzend an einem Baum, die Augen geschlossen, den Kopf leicht geneigt. Sie ist eingehüllt in ein fließendes Gewand, das an ein großes Tuch erinnert. So lehnt sie an diesem Baum, ins Ich gekehrt. Der Baum, an den sie sich lehnt, ist nur ein Stumpf. Irgendwie sich in diesem Stumpf ebenfalls einen Körper
„Die Resignation“ hat der spanische Maler Francisco de Goya seine Tuschezeichnung genannt. Es ist in der Zeit zwiscjhen 1803 und 1812 entstanden.
2
Goya war zu dieser Zeit Ende fünfzig bis Mitte sechzig, Maler am Hof des spanischen Königs. Mit Mitte vierzig bereits hatte er einen schweren Schlaganfall erlitten, der zum Verlust seines Gehörs führte. In der Zeit, in der diese Bilder entstehen, führt Napoleon Krieg gegen verschiedene Länder Europas, so auch gegen Spanien. In dieser Zeit entsteht der vielleicht bekannteste Bilderzyklus von de Goya, mit dem Namen, „Schrecken des Krieges“. In erschreckender Direktheit stellt er genau dies dar, die Schrecken.
Und hier also „Resignation“. Die Frau hat sich in ihr Schicksal ergeben. Wartet sie wie der Prophet Elia unter dem Wacholder auf den Tod? Oder ruht sie sich nur aus, um neue Kraft zu schöpfen und in ihr Leben, ihren Alltag zurückkehren zu können? Wie Goya sie darstellt, hat sie fast etwas Ruhiges, Schlafendes. Wer resigniert ist, ist nicht selten entmutigt, enttäuscht, vielleicht auch verbittert.
3
Resignation. Wörtlich übersetzt heißt das „entsiegeln“ deswegen kann es auch bedeuten, auf etwas zu verzichten oder etwas zurückgeben. So hatte es in früheren Zeiten mit Blick auf Amtsinhaber auch die Bedeutung der Abdankung, bzw. des Amtsverzichts.
Resignation hat anscheinend auch damit zu tun, etwas loszulassen, nicht mehr daran festzuhalten oder nicht mehr festhalten zu können. Etwas hat sich als falsch oder nicht tragfähig erwiesen – oder ist einfach zu einem Ende gekommen: eine Überzeugung, eine Meinung, eine Freundschaft, eine Partnerschaft.
4
Elia muss einen Teil seiner Überzeugungen loslassen, hinter sich lassen. In einer Situation der tatsächlichen oder vermeintlichen Konkurrenz zu anderen religiösen Traditionen scheint er an einem Bild Gottes festzuhalten, das mit Macht und Gewalt einhergeht. Der Weg in die Wüste und durch sie hindurch bedeutet, vieles, vielleicht alles an inneren Überzeugungen hinter sich zu lassen. Erst dann ist Elia frei eine neue, Erfahrung Gottes. Elia ist unsicher, verängstigt, enttäuscht und mutlos. Er resigniert.
5
Resignation – vielleicht ist sie manchmal im Leben auch notwendig, Standpunkte, die man immer für unumstößlich wahr und richtig erachtet hinter sich zu lassen lassen.
Insofern kann Resignation etwas Gutes haben, auch wenn sie mit unangenehmen Empfindungen und Erfahrungen verbunden sein mag. In den Worten des Evangeliums für den Sonntag Okuli (Lukas 9,57-62) spiegelt sich für mich etwas von der Erfahrung der Resignation. Lukas lässt Jesus sagen: „Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes!“ Und: „Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ Diese Sätze erinnern daran, Vergangenes, Vertrautes hinter sich zu lassen. Nur so kann ich offen sein für etwas Neues für das Reich Gottes. Ich kann nicht an Altem festhalten, wenn ich die Ohnmacht überwinden will.
6
Wenn ich noch einmal auf das Bild Goyas schaue, wirkt die Frau auf mich fast entspannt. Kann sie vielleicht schon erkennen, was es loszulassen gilt, um das Neue zu erfahren, eine neue, veränderte Wirklichkeit? Eine Wirklichkeit, in der „der Tod nicht mehr sein wird, noch Leid, noch Geschrei noch Schmerz“ (Offenbarung 21,4).
Das wäre eine Welt, die getragen wird von der Liebe Gottes. .
Eine gesegnete friedvolle Woche wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Geborgen in Gottes Gedenken

Geborgen in Gottes Gedenken
1
Reminiszere – Gedenke!
Der Name dieses Sonntags Reminiszere leitet sich aus dem 25. Psalm ab. Dort heißt es „Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen ist. Nach dir, Herr, verlangt mich. Ich hoffe auf dich. Zeige mir deine Wege. Leite mich in deiner Wahrheit. Gedenke deiner Barmherzigkeit … und nicht meiner Übertretungen. Ich harre auf dich.“ – So inständig bittet der Beter um Gottes Beistand und Nähe.
2
Vor elf Monaten fand die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Leben gerufene bundesweite Gedenkfeier für die Opfer der Corona-Pandemie statt, die vielerorts begangen wurde. Der Osnabrücker Künstler Volker-Johannes Trieb hatte eine Kunstinstallation auf dem historischen Marktplatz der Stadt des Westfälischen Friedens angefertigt mit Hunderten von Baumscheiben und Lichtern zum Gedenken an die Opfer der Pandemie und als Aufforderung zur Solidarität.
In seiner Aktion „friedvolleherzen.de“ schreibt er: „Die Kultur kann keinen Virus bekämpfen. Nicht Corona, nicht unmittelbar. Aber es gibt Viren, die heißen: Angst, Hysterie, Panik, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Und: Rücksichtslosigkeit, Egoismus, Inhumanität. … Und gegen Viren wie diese kann die Kultur eine Hilfe sein. … Solidarität ist Zärtlichkeit unter den Menschen.“
3
Auf jeder Baumscheibe, die schon deutliche Risse zeigte, stand in Anlehnung an ein japanisches Sprichwort eine in eine Tonscherbe geschriebene Aufschrift:
ES GIBT IM GEHEN EIN BLEIBEN,
IM GEWINNEN EIN VERLIEREN,
IM ENDE EINEN ANFANG.
Jede Baumscheibe wurde nach der Gedenkfeier an Opfer und Betroffene der Corona-Pandemie verschenkt als leuchtendes Zeichen der Mitmenschlichkeit und des Trostes. Ein solidarisches Gedenken. Einige stellten die Baumscheiben auf das Grab ihrer Angehörigen, andere zu Hause im Flur auf die Kommode.
4
Wer hätte gedacht, dass wir nach der Pandemie, oder besser noch vor Ende der Pandemie in eine weitere Katastrophe schlittern, deren Ende und Folgen noch nicht absehbar sind und wo wir uns fragen, wieviel Baumscheiben mit Rissen werden hier auf ukrainischen Friedenhöfen oder Marktplätzen einmal angezündet werden müssen. Werden die vielen ukrainischen Kriegsbetroffenen überhaupt die Gelegenheit haben, Baumscheiben bei sich zu Hause im Flur oder auf den Gräbern ihrer Angehörigen aufzustellen.
5
Der Psalmbeter entzündet noch ein weiteres Licht, das über uns leuchten soll. Die Aufforderung zum Gedenken richtet er nicht an Menschen, sondern an Gott selbst: Gedenke, Gott, deiner Barmherzigkeit und Güte, wenn mein Leben wie bei einer Baumscheibe Risse bekommt und die Haut dünner wird, wie die poröse Rinde.
Gedenke deiner Barmherzigkeit und Güte, Gott! Sie sind das Licht, das uns zur Mitmenschlichkeit erwärmt und den Weg zu mehr Gemeinschaft leuchtet. Zu glauben, von Gott in den Blick genommen und ummantelt zu werden, gibt meiner Seele Trost und Halt, gerade dort, wo menschliche Worte und Hände nicht mehr hinreichen. Geborgen im Blick des anderen, der meiner gedenkt.
Unter seiner Güte und Barmherzigkeit lässt sich auch ergänzend das japanische Sprichwort umkehren und vertiefend sagen: Es gibt auch im Bleiben ein Gehen, im Verlieren ein Gewinnen und im Anfang ein Ende. Bei allem, Gott, gedenke deiner Barmherzigkeit und Güte!
Eine friedvolle gesegnete Wochen wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Mehr als Welt

1
Aus der Ukraine haben wir noch nicht diese Bilder, aber sie werden kommen. Bilder wie diese gibt es aber schon lange, nur nicht so nahe an uns „dran“ Wir schauen in das Gesicht des kleinen Jungen Omran Daqneesh, im Jahre 2016 fünf Jahre alt. Da lebte er in der syrischen Stadt Aleppo, die im Bürgerkrieg ausgebombt wurde. Der kleine Omran hat gerade einen Bombenangriff in den Trümmern eines Hauses überlebt und sitzt nun im Rettungswagen von Sanitätern. Sein Körper ist geschunden, sein Gesicht voller Blut. Am schlimmsten aber ist sein Blick: ein ratloser, leerer, nichts mehr hoffender Blick. Omran schaut nach irgendwo und sieht dort, wenn er überhaupt etwas sieht, auch nur Trümmer, Schmerz und Sterben. Es könnte aber auch sein, dass er zwar die Augen offen hat, aber nichts mehr sieht, nichts mehr sehen will.
Es gibt Augenblicke, da kann man einfach nicht mehr. Das geht Erwachsenen so. Einem Fünfjährigen wohl erst recht. Alles ist leer. Alles tut weh.
2
Dem russischen Dichter Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821–1881) wurde einmal die Frage gestellt: Ist die Welt, ist unser Glück oder gar die ewige Harmonie auf unserer Erde zu rechtfertigen, wenn in ihrem Namen auch nur eine Träne eines unschuldigen Kindes vergossen wird? Darauf antwortete der Dichter, der selber viele Jahre in sibirischen Gefängnissen verbracht hatte: Nein, kein Fortschritt, keine Revolution, kann diese Träne rechtfertigen. Kein Krieg … Eine Träne eines einzigen Kindes wiegt immer schwerer.
Den tiefen Sinn dieser Antwort können wir auf dem Bild erkennen. Wer noch einen Rest Mitgefühl in sich spürt, kann den leeren Blick des Omran und seine Verletzungen an Leib und Seele durch nichts rechtfertigen. Durch nichts. Und das macht es gerade so absurd. Wenn wir seit 11 Tagen immer wieder einen gnadenlosen Putin sehen und hören, der von einer Friedensoperation spricht, die nur zu seinen Bedingungen beendet wird.
3
Während der Lebenszeit des Apostels Paulus, etwa in den Jahren 10 bis 60 nach Jesu Geburt, war militärische Gewalt alltäglich. Die Weltmacht Rom hatte weite Teile in Vorderasien besetzt und kämpfte gegen viele Aufstände. Paulus saß mehrmals in Gefängnissen. Jerusalem hatte einen römischen Statthalter, das Volk Israel lebte unter von Römern eingesetzten Königen. In vielen Schreiben des Apostels klingen Gewalt und ihre Folgen mit. An die Christen in Korinth (2. Korinther 6,4-5) schreibt er: In allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen … Wenn Paulus das schreibt, wird er es auch erlebt haben – entweder am eigenen Leib oder als Zeuge von Gewalt und Bedrängnissen. Oder in beidem.
Die Welt ist Gewalt. Viel zu oft. Die Welt lässt weinen. Jeden Tag.
4
Die gleiche Welt macht aber auch Hoffnung. Immer wieder. Hoffnung durch Worte. Paulus schreibt auch (2. Korinther 6,9-10): In allem erweisen wir uns als Diener Gottes: … als die Sterbenden, und siehe, wir leben; als die Gezüchtigten und doch nicht getötet; als die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich machen.
Kaum jemand in der Geschichte der Welt und unseres Glaubens hat es so treffend ausgedrückt wie Paulus. Wir Menschen, oft untröstliche, gedemütigte und auch gewalttätige Menschen, wir an der Welt verzweifelnden Menschen können auch trösten, heilen und hoffen. Wir armseligen Menschen, vom Geschehen in der Welt bedrängten und bedrückten Menschen, können auch denen aufhelfen, die ratlos und gebeugt sind.
Wir, die wir oft arm sind, können tatsächlich reich machen. Selbst wenn wir alles andere als reich sind.
5
Weil immer mehr ist als Welt. Weil Gott ist. Selbstverständlich gibt es Zeiten, Passionszeiten, in denen wir nichts mehr vermögen. Vielleicht nur noch stumm sein können und in die Welt schauen wie Omran auf dem Bild. Mit offenen Augen, aber nichts mehr sehen; nichts mehr sehen wollen. Oder auf ihn sehen, wie wir als Zeugen, und nur noch Wut verspüren, weil ein Kind leidet. Was durch nichts, durch nichts zu rechtfertigen ist.
Aber auch ein Nicht-aushalten-Können oder ein Wegschauen vor fremdem Schmerz hält man nicht lange aus. Dann sieht man doch wieder hin. Und fühlt: Ich will etwas tun. Ich will dieses Kind jetzt vorsichtig waschen, salben, mit Tee und Brot ein wenig stärken. Ich will diesem ganzen Weltenelend und seiner erschreckenden Gewalt jetzt, auf der Stelle, eine winzige Hoffnung entgegenstellen; die einzige Hoffnung, die ich in diesem Moment noch habe: mich selbst als einen auf Gott hoffenden Menschen.
Ich tue das mir Mögliche. Ich tue das Nächstliegende. Ich trockne die Tränen in meiner Nähe. Und zeige trotzig mir und der Welt, dass immer mehr ist als Welt. Nämlich Gott. Der Herr der Welt.
Eine gesegnete friedvolle Woche wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Gedanken zur Ukraine und Markus 8

Sind Sie auch so sprach- und ratlos, wie ich’s gerade bin? Mit einem wohlkalkulierten Schulterzucken wird Krieg ausgerufen, werden Grenzen überrannt und Menschenleben, Menschwürde und Völkerrecht zu vernachlässigbaren Größen degradiert. Was nun? Wohin soll das gehen?
Wat mutt, dat mutt! – sagen die Nordlichter gerne, wenn sie wissen, dass sie sich dreinschicken müssen. Es gibt halt Dinge, die änderst du nicht, die musst du geschehen lassen, wie’s die Situation will – da hast du keine Wahl. So fühlt es sich gerade an: Unsere Hände sind gebunden, wir haben keinen Plan.
Dabei hätte ich sie gerne, oft genug, die Wahl. Wenn ich mein Schicksal wählen könnte, wenn ich’s mir aussuchen dürfe, dann würde ich nicht krank, dann lernte ich all die Dinge, die das Leben mir zu lernen aufgibt, auch ohne Müh und Not. Wenn ich’s entscheiden dürfte, wären alle längst geimpft, stürben im Jemen keine Kinder den Hungertod, zögen die russischen Soldaten fröhlich nach Haus und genössen den Frieden mit ihren Familien – und kein Mensch in der Ukraine müsste sich fürchten. Das wäre so, weil ich einfach nicht einsehen mag, dass so viel Schmerz und Leid sein müssen. Dat mutt nich‘! – finde ich.
Dass überhaupt irgendwer Todesangst haben muss, im Osten Europas oder anderswo, dass jemand an seinen Umständen verzweifelt, dass Frauen missachtet, Kinder misshandelt werden, dass Machtgier und Chauvinismus und Gleichgültigkeit die Oberhand haben, damit bin ich nicht einverstanden. Und in Petrus habe ich da, wie Markus erzählt, einen guten Fürsprech (Markus 8,31-38). Als Jesus auf sein Leiden anspielt, nimmt Petrus ihn zur Seite „und fing an, ihm zu wehren“: „Komm, Jesus, wer sagt denn, dass das sein muss, das hast du doch nicht verdient; da sei Gott vor!“. Und was ihm noch alles eingefallen sein mag, um Jesus davon zu überzeugen, dass es doch wohl nicht sein müsse, dass er scheitert und stirbt. Nee, dat mutt nich‘! Ich bin Petrus wirklich dankbar, dass er die Leidensankündigung Jesu nicht einfach akzeptiert, dass er sich wehrt und seinem Unverständnis Worte verleiht. Da trifft er genau meinen Punkt – den Jesu aber offensichtlich nicht. Der geht doch recht unwirsch um mit meinem Freund, nennt ihn „Satan“ und wirft ihm vor: „Du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist!“.
Hm – ja eben! Was ist denn daran falsch? Es ist doch menschlich und gut, einem Menschen nicht alles Unglück an den Hals zu wünschen und nicht einfach hinzunehmen, dass es so viel Krankheit, Ungerechtigkeit und Mord gibt, dass eine Nation mit Krieg überzogen wird. Aber wenn Jesus „menschlich“ sagt, meint er – gewiss nicht ohne Verständnis für uns – unsere verkürzte Perspektive. Unser Horizont ist ein menschlicher – der göttliche ist weiter, viel, viel weiter. Und: menschlich ist es wohl, sich alles Leid, allen Schmerz, den großen Tod und die vielen, fiesen Unannehmlichkeiten einfach wegzuwünschen. Helfen tut es freilich nichts: das Wünschen. Stattdessen muss etwas getan sein.
Das ist eben der göttliche Horizont, das ist die göttliche Entscheidung: das, was uns bedrängt, zu Boden drückt, den Atem raubt, selbst zu tragen, anzunehmen, aus- und durchzuleben. Nichts anderes macht Jesus in seiner Passion, am Kreuz. Er geht jeden menschlichen Weg mit, bis zum bitteren, zum tödlichen Ende – um uns schließlich mitzunehmen auf seinem göttlichen Weg, ins Licht, ins Leben, in den neuen (Oster-)Morgen.
Muss das so sein? Ja, wat mutt, dat mutt. „dei“ (das griechische Wort für „es muss, es ist notwendig, da gibt es keine Wahl“), heißt es bei Markus: „Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden“. Muss das sein? Ja, es ist die Notwendigkeit der Liebe, die nicht von oben herab begleitet, sondern mittendrin ist, die nicht im Überflug, nicht aus der Distanz das Gute wünscht und tut, die dabei ist. Dieser Tage in Kiew und im Donbass. Der Gott, der liebt, will seinen Menschen unmittelbar nah sein. Das muss so sein, dat mutt!
Mag sein, Jesus war von Petrus „menschlich enttäuscht“, weil der nicht verstand, wie weit, hoch, tief und voraus die göttliche Liebe geht. Wie auch immer: Am Ende umarmt sie den Petrus auch, und jede und jeden, dich und mich. So wird aus Gottes „dat mutt“ unser menschliches: „Dann ist ganz viel möglich“: Zukunft, Hoffnung, Frieden. Auch gegen den (momentanen) Augenschein, glaube ich.
Deutschland und die Welt bringt gerade viele Dinge „auf den Weg“, um dem Schrecken ein Ende zu machen. Wir als Gemeinde bitten Sie und Euch zu Beten für den Frieden, für die Menschen in der Ukraine in Russland und in Europa:
Wenn Sie keine eigenen Worte finden, nehmen Sie doch diese aus Taize:
Du liebender Gott,
fassungslos stehen wir vor der Gewalt auf unserer Welt;
besonders in diesen Tagen – angesichts des Kriegs in der Ukraine.
Gib uns die Kraft, solidarisch denen nahe zu sein,
die betroffen sind und in Angst leben.
Steh all denen bei, die in diesem Teil der Welt
besonders auf Gerechtigkeit und Frieden hoffen.
Sende uns den Heiligen Geist, den Geist des Friedens,
damit die Politiker ihre Entscheidungen
in großer Verantwortlichkeit treffen.
Eine gesegnete friedvolle Woche wünschen Ihnen
Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Verschwenderisch gesät

Gedanken zum Gleichnis vom Sämann und dem „vierfachen Ackerfeld“ Lukas 8, 4-8
1
Eine Statue auf einem Brunnen mitten in der Stadt. Im Hintergrund Autos, hohe Häuser, eine Kirche. Der Mann auf dem Brunnen trägt eine Art Obergewand. Mit der linken Hand zieht er den unteren Saum nach oben. Der Inhalt dieser provisorischen Tasche ist schwer. Der Stoff sackt nach unten. Die rechte Hand des Mannes ist ausgestreckt. Gleich wird er ausholen und werfen.
Es ist ein Sämann, der da auf dem Brunnen steht. Er sät wie in vergangenen Zeiten. Ohne Traktor oder Saatmaschine. Sein Tun ist harte Arbeit. Das Saatgut in dem Tuch vor dem Bauch ist schwer. Jesus hat von so einem Landwirt erzählt. Der geht über sein Feld und teilt mit vollen Händen aus. Mal wirft er rechts eine Handvoll Samen, dann wieder links. Die Saatkörner landen nicht ordentlich in einer Reihe. Der Sämann sät verschwenderisch. Das ist unlogisch, geradezu unwirtschaftlich. Kein Mensch besät so heute noch ein Feld.
2
Aber Jesus will mit der Geschichte auch nichts über die heutige Landwirtschaft sagen, sondern über den Glauben. Die Samen des Glaubens fallen auf unterschiedlichen Boden: Einiges fällt auf den Weg. Der Boden ist hart. Die Samen werden zertreten oder plattgefahren. Vögel kommen und picken sie auf. Andere Samenkörner bleiben auf hartem Gestein liegen. Keine Chance auf fruchtbare Erde. Die Sonne verbrennt sie. Wieder andere Samen gehen zwar erst auf, aber dann werden sie überwuchert von Dornen.
Nur ein Teil der Samenkörner fällt auf fruchtbaren Boden. Die Wurzeln finden Halt und können sich ausdehnen. Sie transportieren Wasser und Nährstoffe. Die Pflanze beginnt zu wachsen. Jesus sagt mit diesem Gleichnis: Gottes Wort ist auch wie ein Samenkorn. Manchmal fällt es auf fruchtbaren Boden, manchmal entsteht nichts.
3
Diese unterschiedlichen Böden sind auch in mir. Wie in einer Beziehung zu einem anderen Menschen gibt es auch fruchtbare Zeiten zwischen mir und Gott. Ich verstehe den Bibeltext. Die Arbeit geht leicht von der Hand. Ich weiß, ich bin geliebt. Ich spüre Gottes Nähe. Zu anderen Zeiten gibt es Dürreperioden. Der Gottesdienst sagt mir nichts. Ich bete um etwas – und es wird mir nicht erfüllt. Ich fühle mich fern von Gott.
Dann gibt es Zeiten der Begeisterung. Aber die flaut schnell wieder ab. Ein Strohfeuer von kurzer Dauer. Für einen Moment gelingt mir alles. Ich spüre: Gott ist ganz nah bei mir. Aber dann ist dieser Augenblick vorbei. An anderen Tagen meint es jemand gut mit mir. Aber bei mir kommt nichts an. Mein Herz ist hart und meine Gedanken woanders. Dann spüre ich auch nicht, dass Gott es gut mit mir meint.
Es ist nicht immer einfach, darauf zu vertrauen, dass Gott bei mir ist. An guten und an schlechten Tagen. Jesus nimmt das ernst. Glauben heißt nicht, ihn ein für alle Mal zu haben. Es gibt Dürrezeiten. Der Kinderglaube zerbricht. Ein Mensch wird nicht wieder gesund. In dunklen Zeiten schwindet mein Vertrauen. Meine Zuversicht wird zertreten oder überfahren.
4
Der Sämann sät verschwenderisch. Auch mitten in der Stadt, im Alltag, zwischen Beton und Stahl. Weil Gottes Gnade kein Ende hat. Weil er um die Dürrezeiten weiß. Er hält an uns fest, auch wenn nichts zurückkommt. Anders als der Landwirt. Der würde sein Feld längst wieder umpflügen. Aber Gott gibt immer und immer wieder. Er hegt und pflegt mein Glaubens-Pflänzchen. Er lässt Neues wachsen. Durch einen Menschen, der mir gut zuspricht. Durch ein Lied, das mein Herz rührt. Durch einen Sonnenuntergang, der den Horizont in verschwenderisches Licht taucht. Durch ein Bibelwort. Oder durch einen Mann auf einem Brunnen, der mich daran erinnert, wie gut es Gott mit mir meint.
Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Wahre Stärke kommt von .... innen?

1
Beim Boxen gibt es Gewichtsklassen. Es geht los mit den Minifliegengewichten mit maximal 47,6 kg bis zu den Schwergewichten ab 90,7 kg. Dazwischen liegen 15 weitere Abstufungen. Das hat den Vorteil, dass man haufenweise Titel vergeben und Weltmeister küren kann. Deutschland freut sich über sechs Weltmeisterinnen seit 1999 im Superbantamgewicht, und die Zuschauenden über möglichst ausgeglichene, faire Kämpfe. Gewichtsklassen, wenn auch nicht so exzessiv, gibt es auch in anderen Kampfsportarten, Gewichtheben oder Rudern. Das Ziel ist immer Fairness und Vergleichbarkeit.
2
Die freie Natur funktioniert da anders. Da sortiert niemand vor, sorgt keiner für faire Matche. Wer stärker ist, hat Recht. Survival oft he fittest. Tiere haben manche Tricks drauf, um größer und stärker zu erscheinen, als sie tatsächlich sind. Wenn Katzen sich erschrecken oder bedroht fühlen, stehen ihnen alle Haare zu Berge, was sie deutlich massiger erscheinen lässt. Auch einige Vögel verstehen sich auf diese Art des Bluffens und haben solche Drohgebärden im Repertoire. Andere täuschen von Geburt an, indem sie Farben tragen, die ansonsten im Tierreich für „Achtung! Gefahr!“ stehen, z.B. das Schwarz-gelb. Eine Legende hat es sogar in die Menschenwelt geschafft: 3 Hornissenstiche töten einen Menschen, 7 ein Pferd. Das ist Quatsch. Es wären tatsächlich mehr als 1.000 Stiche notwendig, um einen normalen 70 kg-Erwachsenen in Lebensgefahr zu bringen. Aber es wirkt. Menschen fürchten Hornissen. Dabei stimmt die Legende nur andersherum: Ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein.
3
Wenn Sie das Bild genau betrachten, sehen Sie (Achtung Ironie) einen gefährlichen, blutrünstigen Wolf mit weißer Zottelmähne und ein ihm hilflos ausgeliefertes Galloway-Kälbchen. So jedenfalls das Selbstverständnis von Malteser-Shi Tzu Emil (8 kg). Das Kalb (ausgewachsen dann 900 kg) mit der dunklen Zottelmähne käme nicht auf die Idee, das infrage zu stellen. Weiß setzt Schwarz mal eben Schachmatt, nur durch natürliche Autorität.
„Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums“, heißt es beim Propheten Jesaja. Das geht ganz schön gegen unsere Natur. Und nicht nur gegen unsere. Im Tierreich läuft nicht alles über natürliche Autorität wie auf dem Foto. Angeberei ist wichtig. Je bunter die Nase bei Mandrill-Affen, desto größer der Führungsanspruch. Pfau-Männchen stolzieren stunden- bis tagelang nebeneinander her im Wettbewerb um die Hennen – im Normalfall erkennt einer den anderen als schöner an. Wenn keine Einigung zustande kommt, wird gekämpft. Blaufußtölpel tanzen, um ihre Füße in Szene zu setzen. Kapitale Hirsche stellen ihr Geweih zur Schau. Bescheidenheit? Fehlanzeige! Warum dann also nicht zeigen, wenn man weise, stark, reich ist?
4
Zwei Gründe: der eine findet sich beim Propheten Jeremia, der andere nicht. Nummer eins: Angeber nerven. Leute, die auf Angeber reinfallen, irgendwie auch. Niemand würde Angeberei vermissen und oft wäre die Welt weniger peinlich, wenn es schiefläuft. Nummer zwei: Vergiss nicht, woher diese Dinge kommen, derer du dich rühmst. Die Weisheit haben dir andere weitergegeben, die Stärke andere mit dir trainiert und der Reichtum ist ererbt oder ruht auf vielen Schultern, die daran mitgearbeitet haben. Bevor du dich also damit rühmst, vergiss nicht, wo es herkommt.
Bei Jeremia eindeutig von ganz oben: „Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden.“ Vielleicht schließen wir einen Kompromiss: Wer Ruhm für sich beansprucht, schickt direkt hinterher, wem er ihn zu verdanken hat. Dann gibt es keine Missverständnisse.
Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Warum Angst in Worte gehört

Warum Angst in Worte gehört
1
So könnte Angst aussehen, meint die Fotografin mit ihrem Bild. Das Gehirn überdreht, überschlägt sich vielleicht vor banger Erwartung. Angst ist selten steuerbar. Sie ist in uns als Schutz und führt dennoch ein gewisses Eigenleben. Sie ist da, wenn man sie braucht als Meldung oder Abwehr von Gefahr; sie ist aber auch da und wächst, wenn Gefahr eher „gefühlt“ ist und in Wirklichkeit nicht besteht. Angst, so hilfreich sie oft ist, bedroht einen gelegentlich selbst. Dann wird man vor Angst handlungsunfähig. Sie übersteigt die Wirklichkeit in einer Weise, dass sie eher lähmt als tätig macht. Wir scheinen wie besessen von Angst.
Das Bild drückt aus, wie wir uns manchmal fühlen: voller Entsetzen über etwas – über andere Menschen oder uns selbst. Angst ist schillernd. Sie hilft und schadet uns. Manchmal ist sie zu groß und manchmal zu klein. Wir sind Teil unserer Ängste. Manchmal steuern wir sie, manchmal steuern sie uns.
2
Kaum ist Jesus auf der Welt, ist er auch schon erwachsen. Das geht immer schnell im Kirchenjahr. Und kaum ist Jesus getauft und hat Jünger um sich gesammelt, haben sie dramatische Erlebnisse. Jesus selbst schickt die Jünger auf den See, auf dem sich dann der Sturm erhebt. Er peitscht Wellen ins Boot. Jesus scheint davon nichts zu bemerken, er schläft. Das ärgert die Jünger, weswegen sie ihn wecken und ihn zur Rede stellen. Jesus vermag es, den Sturm zum Aufgeben zu zwingen. Er stellt dann seinerseits die Jünger zur Rede und fragt: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Man beachte das Wörtchen „noch“. Jetzt fürchten sich die Jünger erst Recht. Nicht mehr vor Wind und Wellen, sondern vor der Macht ihres neuen Freundes, den sie noch nicht gut genug zu kennen scheinen. Ihre Furcht sagt: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind?
3
Es geht um die Beherrschung der Angst durch Glauben. Das erwartet Jesus, der vor lauter Gottvertrauen sogar bei Wind und Wellen schlafen kann. Dass die Wellen schon ins Boot schlagen, macht ihn vielleicht nass, aber nicht so ängstlich, dass er aus seinem Schlaf erwacht oder der Sturm ihn weckt. Mit Gott ist gut ruhen, erzählen uns die Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas. Das hätten sie gerne. Wir wissen aber, dass es ein frommer Wunsch ist, der sich oft nicht erfüllt. Es gibt Stürme, die machen, dass das Gehirn sich überschlägt wie auf dem Bild und die Ängste uns unruhig und unsicher machen; oder die Sinne hoffnungslos durcheinander bringen.
So edel die Absichten in dieser Erzählung sind: wir haben die Angst oft nicht im Griff und können sie durch Gottvertrauen nicht zum Schweigen bringen. Und dann?
4
Dann ist Gott trotzdem da. Jesus auch. Wir wissen ja, dass es so einfach nicht ist, wie es manchmal klingt: wir beherrschen unsere Angst durch Glauben. Das sollten wir können, können es aber oft nicht. Die Ängste sind dann zu groß, die Ansprüche ans Leben zu gewaltig und der Glaube zu schmal. Das Leben macht Angst: vor Krankheit, vor Trennung, vor Verlust der Sinne im Alter, vor dem Ausbleiben der Freunde und vor vielem anderen auch. Die Ängste im Leben verändern sich. Was dem Erwachsenen Angst machte, lässt einen älteren Menschen nur schmunzeln. Und was Ältere ängstigt, versteht ein Jüngerer nicht und möchte es Älteren ausreden.
Überhaupt das Ausreden. Das tut man gerne, weil man sich ja selber ängstigt und dagegen anredet. Angst kann man nicht ausreden, nur ernst nehmen.
5
Wer Angst ernst nimmt, beginnt, sie etwas in den Griff zu bekommen. Angst wabert, das Ernstnehmen und sie in Worte fassen kann sie bändigen. Angst gehört in Worte - zu Freunden, die nicht abwiegeln oder beschwichtigen; und zu Gott, der mich und meine Angst hört. Angst gehört zum Leben, sie erweist mir einen Dienst und macht mich aufmerksam. Wenn ich allerdings merke, dass sie mich zu beherrschen beginnt, versuche ich, sie ein wenig in den Griff zu bekommen. Das geht am besten, wenn ich sie in Worte fasse. Angst gehört in Worte; sie gehört ausgesprochen - gegenüber sich selbst, Freunden und Gott.
In der Welt haben wir Angst. Wer sich damit an Gott wendet, erfährt Hilfe. Zuerst die Hilfe der Beruhigung, als legten sich Sturm und Wellen in meiner Seele. Aber auch die Hilfe der Macht Gottes. Was auch geschehen mag – wir arbeiten mit Gottes Hilfe und mit Hilfe von Freunden tapfer dagegen und werden nicht versinken. Wir sind und bleiben in Gottes Armen. Das drückt ein wunderbares Lied aus. Dies beten und davon singen wir: „Du kannst nicht tiefer fallen, als nur in Gottes Hand.“ (EG 533)
Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
O der weinenden Kinder Nacht

„O der weinenden Kinder Nacht“ (Nelly Sachs)
Betrachtung zum Gedenktag der Befreiung
des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar (1945)
1
Ein vergessener Ort. Ein kleines Dreieck zwischen zwei verkehrsreichen Straßen. In der Mitte die Bronzeskulptur, die einen „Dreidel“ darstellt. Einen Kreisel mit vier Seiten, der um Süßigkeiten gedreht wird. Er ist das traditionelle jüdische Kinderspielzeug zum ausgelassenen Lichterfest Chanukka. Kinder mit hochroten Köpfen beim Spiel, ihr Lachen oder ihre Enttäuschung beim Verlieren, ihre Freude beim Feiern – all das war auch hier zu Hause. Nur machen die modernen Gebäude im Bildhintergrund vergessen, dass an ihrer Stelle das Kinderhaus der Weiblichen Fürsorge stand. Bedürftige „israelitische“ Mädchen und Jungen fanden dort Obhut und Betreuung. Bis die Gestapo am 15. September 1942 das Heim räumte und die Bewohner deportierte. Einige Kinder blieben zunächst noch zurück. Eine Betreuerin schrieb einem Angehörigen: „Leider traf Ihre liebe Karte am 16ten ein, während Ihre Lieben am 15ten mit 43 Kindern und zwei Angestellten hier abreisten. Sie waren gesund und tapfer ... Ich bin nun noch mit 15 Kindern allein. Es ist mir furchtbar.“
2
Die ahnungslosen Schützlinge mussten – gesund und tapfer, wie sie waren – einen sogenannten Zu-Fuß-Transport quer durch Frankfurt hinter sich bringen, bevor sie auf Güterwaggons verladen wurden. Die Ziele hießen zumeist Treblinka oder Auschwitz. Was sie dort erwartete – beschreibt, beklagt die selbst in Schweden im Exil lebende, deutsche Dichterin Nelly Sachs (1891–1970, Literatur-nobelpreis 1966) in einem Gedicht:
„O der weinenden Kinder Nacht!
Der zum Tode gezeichneten Kinder Nacht!
Schreckliche Wärterinnen
Sind an die Stelle der Mütter getreten ...
Überall brütet es in den Nestern des Grauens.“
3
Nach Auschwitz, sagte der Philosoph Theodor W. Adorno (1903–1969), sei es nicht mehr möglich, ein Gedicht zu schreiben. Nelly Sachs hat es getan. In ihrer Lyrik gibt sie den toten Kindern einen bleibenden Ort. Da ist beides aufbewahrt: der Leidensweg der Schwächsten der Schwachen, aber über den Tod hinaus auch ihre Menschenwürde.
An uns Nachgeborene ergeht der Appell, die Opfer nicht durch Vergessen oder Gleichgültigkeit ein weiteres Mal zu töten. Das Erinnern an die Gräuel damals ist heute bitter nötig, wo Geschichtsbewusstsein kein Thema mehr ist und die Devise lautet: „Es muss auch mal Schluss sein!“
Nein, denn Schweigen war der Nährboden, auf dem das Verbrechen gedeihen konnte. Reden ist Gold. „Nie wieder!“, lautet die Parole. Und „nirgendwo Platz für antisemitische Hassreden und Gewalttaten“.
4
Stellvertretend für alle Kinder, die dem Nazi-Terror zum Opfer fielen, sei der Zwillinge Gerd und Rolf Reutlinger gedacht. Ihr Leidensweg begann schon Ende 1940 und lässt sich an wenigen kargen Daten ablesen:
Geburt: 15. Oktober 1937, Frankfurt am Main –
Wohnort: ab 1939 Frankfurt,
Kinderhaus der Weiblichen Fürsorge –
Deportation: 22. November 1941 nach Kowno in Litauen –
Sterbedatum: 25. November 1941 in Kowno,
Hinrichtungsstätte.
Die beiden 4-jährigen Jungen wurden zusammen mit ihrer Mutter erschossen.
Von den 43 Frankfurter Heimkindern haben nur sechs überlebt.
5
Jüngst wurde der vergessene Ort zur Erinnerungsstätte und trägt einen Namen: Platz der vergessenen Kinder. Und der Dreidel steht für das Recht der Kinder auf Glück und Spiel und blühendes Leben, weltweit.
Nelly Sachs schrieb, sie wisse nicht, wo das Lächeln des Kindes bewahrt sei, das wie zum Spiel in die spielenden Flammen geworfen wurde. Aber sie hatte eine Vision: „Ich weiß, dass dieses die Nahrung ist, aus der die Erde ihre Sternmusik herzklopfend entzündet.“ Man darf gespannt sein auf diese Musik, die den Dreidel samt den Kindern selig tanzen lässt. Und wehe, einer stört ihr Spiel!
#weremenber
Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Tränen und Heilung

Gedanken zu Psalm 42,4 und Matthäus 8,5-13
1
Möchte man so weinen? Mit goldenen Tränen? Das Bild geht auf eine Sage zurück, wonach die germanische Göttin Freya von ihrem Geliebten verlassen wird. Das schmerzt sie. Und sie weint – goldene Tränen.
Kein Mensch wird gerne zurückgewiesen oder verlassen. Ablehnung schmerzt. Da sind Tränen kein Wunder. Goldene Tränen schon.
2
Der österreichische Maler Gustav Klimt (1862–1918) hatte so etwas wie eine „goldene Phase“. Er war schon berühmt, als er Frauenportraits malte, die heute von weltweiter Bedeutung sind. Auch ein Bild mit dem Titel „Der Kuss“ gehört in diese goldene Zeit etwa um die Jahre 1900 bis 1910. Und dieses Bild mit den goldenen Tränen.
Ganz fern lag ihm das Gold nicht. Sein Vater war Goldgraveur. Graveure versehen Gegenstände des täglichen Lebens mit Schrift. Man fühlt sich besonders gewürdigt, wenn auf einem Pokal oder auf Silberbesteck der eigene Name eingraviert ist. Gustav sollte den Beruf des Vaters erlernen. Als er aber ein Stipendium erhielt, ließ er sich schon als Vierzehnjähriger an der Wiener Kunstgewerbeschule ausbilden.
Klimt starb mit 56 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.
3
„Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht“, spricht einer im Psalm 42 (Vers 4). Den Grund seiner Tränen nennt der Beter des Psalms auch: „Weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott?“ Dieser Mensch weint, weil er Gott nicht fühlt, nicht erfährt. Er hatte auch schon gesagt: „Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott“.
Es müssen schreckliche Stunden und Tage sein, wenn man nach Gott ruft und ihn nicht erlebt oder erfährt. Wenn man sich, um diese Worte noch einmal zu bedenken, sozusagen von seinen Tränen ernährt: Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Vermutlich können wir uns vorstellen, wie furchtbar solche Tage sein müssen. Wenn Eltern ihr Kind begraben müssen und keine Antwort auf die Frage finden, warum Gott das zulässt.
4
Einen nichtjüdischen Hauptmann treibt es sogar zu Jesus, als sein Knecht krank zu Hause liegt und womöglich den Tod vor Augen hat. Der Hauptmann weiß sich keinen anderen Rat mehr, als zu dem zu gehen, von dem er sich Heilung für seinen Knecht verspricht. Er wird irgendetwas gehört haben von einem jüdischen Prediger, der auch Kranke heilt. In seiner Not und als letzte Möglichkeit geht er dorthin. Und sagt den unfassbaren Glaubenssatz: Herr, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund.
Da staunt selbst Jesus. Solchen Glauben hatte er bisher in seiner jüdischen Umgebung nicht erlebt. Jesus heilt den Knecht von ferne. Und stellt auch noch fest: Es werden viele, und nicht nur Juden, im Reich Gottes neben unseren Vätern Abraham, Isaak und Jakob Platz nehmen. Der Himmel ist für alle da.
5
Der Himmel – Ort aller Sehnsucht. Was auf Erden nicht heilbar ist, heilt der Himmel. Er vergoldet unsere Tränen auf Erden. Kann man, darf man das so sagen?
Ja, man darf. Jesus selber denkt und sagt (Matth. 5,4): Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. Jesus ist sich dieses Trostes sicher. Er sagt nicht, wann das sein wird, ob schon auf Erden oder im Himmel, im Reich Gottes. Jesus denkt aber weiter als nur an das Leben auf Erden. Für ihn ist Himmel der Ort der letzten, großen Gerechtigkeit. Das gefällt nicht allen, ich weiß. Manche wollen ihre Gerechtigkeit sofort. Das ist zu verstehen. Aber nicht alle erleben diesen Trost hier auf Erden, Gott allein weiß warum. Ihr letzter Trost gilt dem Himmel, wo Gott abwischen wird alle Tränen (Offb. Joh. 21,4).
6
Viele Tränen auf Erden sind nicht golden, das wissen wir. Sie sind bitter und traurig. Sie wirken wie das Ende von allem. Und so fühlen sich Weinende dann auch: Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, fühlen sie. Sie können nur warten, traurig warten. Auf Momente der Erlösung warten sie. Auf Worte, die sie aufbauen.
Sagen wir einander solche Worte. Seien wir einander solche Worte. Wir können Tränen wohl nicht vergolden. Aber lindern oder trocknen können wir sie manchmal. Durch unser Dasein, unsere Nähe. Sprechen wir einander Worte zu, die eine Seele heilen kann.
Wo Menschen einander nah sind, ist Trost nicht fern.
Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt

Die Suche nach Gott
Gedanken zu 1. Korinther 2,1-10
1
Ein Labyrinth! Ein Labyrinth, bei dem es gilt, die Mitte zu finden. Hecken so gepflanzt, dass Wege entstehen, die man laufen kann. Wege, über die man sich der Mitte langsam nähert. Wege, auf denen man sich aber auch kurzfristig verirren kann. Sackgassen, an deren Ende man umkehren muss.
Jede und jeder, der oder die schon einmal in einem solchen Labyrinth unterwegs war, weiß, dass schnell der Ehrgeiz geweckt wird, die Mitte zu finden, dass es aber auch frustrierend sein kann, wenn man von Sackgasse zu Sackgasse läuft oder dem ersehnten Zentrum einfach nicht näher kommt. Es braucht auf jeden Fall etwas Ausdauer, denn es ist nicht der kürzeste Weg, der zum Ziel führt. Es braucht Ausdauer und sicher auch ein wenig Glück; und es kann hilfreich sein, wenn andere Personen, die im Labyrinth unterwegs sind, Tipps geben. Weil sie vielleicht schon auf dem Rückweg von der Mitte sind oder einem einen Irrweg ersparen, weil sie gerade aus einer Sackgasse zurückkommen und dies kundtun.
2
Auf der Suche nach der Mitte, auf der Suche nach dem Zentrum, ist im biblischen Text auch Paulus (1. Korinther 2, 1-10). Die Suche war für ihn eine Lebensaufgabe. Er ist auf der Suche nach Gott, von dem er glaubte, schon alles zu wissen, als ihm der auferstandene Christus vor Damaskus erscheint. „Saul, Saul, was verfolgst du mich?“, war die Frage Jesu, die bei Paulus alles auf den Kopf stellte und auch sein Gottesbild nach und nach in ein neues Licht rückte. Fortan hatte er es mit einem Gott zu tun, der sich in der Niedrigkeit von Weihnachten der Welt offenbart und dessen Weisheit nicht die Weisheit der Welt, sondern die Weisheit des Kreuzes ist. Christus selbst führt Paulus aus der Sackgasse seines Denkens und offenbarte einen Gott, der im Zentrum steht, der aber anders ist, als schon immer erwartet. Krippe und Kreuz sprechen eine neue, eine eigene Sprache.
3
Auf der Suche nach Gott sind auch wir Menschen – aber nicht immer auf dem richtigen Weg. Es ist nicht leicht, Gott zu finden, geschweige denn ihn festzuhalten. Wir tappen von mancher Sackgasse in eine weitere, besonders dann, wenn wir ganz sicher sind, auf dem richtigen Weg zu sein oder Gott gefunden zu haben. Wer auf der Suche nach Gott ist, wird feststellen, dass wir Menschen ihn mehr umkreisen, als dass wir ihn finden und in die Tasche stecken könnten.
Es ist eine Lebensaufgabe, sich im Labyrinth zu bewegen, dessen Zentrum Gott ist. Und es ist eine echte Zumutung, denn unser Leben ist nicht nur leicht. Es ist selbst voller Irrwege und Sackgassen, aber immerhin mit der Zusage verknüpft, dass Gott das Zentrum ist. Dass da eine Mitte ist, die alles zusammenhält.
4
Gott bleibt zu unseren Lebzeiten ein Geheimnis, das wir nicht ganz lüften können. Paulus schreibt: „Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.“ (1. Kor. 13,12b) Will sagen: Es steht noch etwas aus. Die Mitte, die wir im Leben mehr umkreisen, wird (erst) am Ende erreicht.
Der Gott, der sich vor wenigen Wochen als Kind in der Krippe in dieser Welt offenbart hat, in Niedrigkeit, die in Wahrheit Stärke ist, dieser Gott wird sich (erst) am Ende ganz finden lassen.
Wenn dein Ehrgeiz geweckt ist, fang an zu suchen. Wenn du merkst, es geht nicht weiter, kehre um und suche einen anderen Weg. Wenn dir jemand entgegenkommt, frag ihn, was er dir für deine Suche raten kann. Wenn du glaubst am Ziel zu sein, sei nicht verwundert, wenn es noch nicht das Ziel ist. Aber sei gewiss, dass es die Mitte des Lebens gibt und Gott von dort alles zusammenhält.
Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Das Kreuz drängt sich nicht auf

Das Kreuz drängt sich nicht auf
Gedanken zu Licht und Schatten im Leben
1
Im Vordergrund die Kerze. Ein Stück ist sie schon heruntergebrannt. Die Flamme ist nicht zu sehen. Rauch steigt schräg vom Docht auf; er kräuselt sich. Vielleicht versucht gerade jemand, die Kerze auszublasen: mit aller Kraft – so wie ein Kind, das alle Geburtstagskerzen auf einmal auspusten will.
Aber es gelingt nicht: Die Kerze ist noch nicht erloschen. Sie leuchtet – fast wie von innen heraus. Ihr warmes Gelb steht ganz vorn und zieht meinen Blick auf sich. Und: die Kerze rußt. Eine ganze Menge Rauch steigt von ihrem Docht auf. Da muss noch Glut vorhanden sein. Vielleicht wird sich die Flamme gleich wieder aufrichten – wenn der Windhauch nachlässt – oder das Pusten. Bestimmt knistert sie ein wenig dabei. Und dann ist sie wieder da. Zumindest hoffe ich das. Denn ohne das Licht der Kerze wäre das ganze Bild leer.
2
Im Hintergrund der Himmel. Ganz dunkel ist er. Ein Hauch von Orange lässt noch ahnen, wo die Sonne gerade untergegangen ist. Ihr Lichtschimmer verliert sich, taucht den Himmel in ein immer dunkler werdendes Violett. Die dünnen Wolken sehen schon schwarz aus; ganz still hängen sie da. Ruhig und majestätisch wölbt sich dieser Himmel, wie er es seit dem ersten Tag getan hat. Was auch immer auf der Erde geschieht – er ist und bleibt derselbe. Auf mich wirkt es, als würde die Schöpfung für einen Moment den Atem anhalten.
Und dann, ganz an der Seite: das Kreuz. Zuerst habe ich es gar nicht gesehen. Es sah für mich eher wie ein Schlot eines Industriegebäudes aus. Es hat auf jeden Fall keinen prominenten Platz. Es drängt sich nicht auf. Wenn kein Körper daran hinge, wäre es nicht einmal als Kreuz erkennbar. Und doch ist es da: Ganz an den Rand gedrängt erinnert es an das, was an Karfreitag geschieht. Das Kreuz ist wie ein Kontrapunkt in diesem Bild: Es ist komplett schwarz; überall sonst wechseln Dunkelheit und Licht miteinander. Es zeigt klare Kante – alle anderen Linien wirken weich und unscharf. Es steht unumstößlich da – mitten im flüchtigen, vergänglichen Rauch. So unscheinbar es auf den ersten Blick ist: Am Kreuz komme ich nicht vorbei.
Auch die Kerze steht zum Kreuz in Beziehung: Der Rauch, der vom glimmenden Docht aufsteigt, spannt sich wie eine Brücke zum Kreuz. Es ist eine bewegte, lebendige Verbindung, die viele Verwirbelungen bildet. Über dem Kreuz angekommen scheint der Rauch regelrecht zu tanzen. Ein paar Schwaden ziehen sogar daran hinab und hüllen es geradezu ein.
3
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Vor diesem Horizont leuchtet die Kerze. Irgendwann ist sie angezündet worden, irgendwann wird sie verlöschen. Aber noch ist es nicht so weit: Ihr Licht ist warm und lebendig.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Innerhalb dieses Horizontes kommt von irgendwoher ein Windstoß. Er bringt die Kerze zum Flackern; er drückt ihre Flamme nieder. Sie muss kämpfen – aber sie ist stärker.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der Horizont, in dem wir alle leben. Mal brennen unsere Lebensflammen groß und schön – mal flackern sie und fangen an zu rußen. Manchmal weiß ich nicht, woher ein Windstoß gekommen ist. Aber wenn ich dem Rauch hinterhersehe, lande ich beim Kreuz. Vielleicht sind es gerade die Stürme des Lebens, die eine Brücke schlagen zwischen mir und dem, der da hängt. Gerade die Rauchschwaden, die von meinem Leben aufsteigen, zieht er in sein Kraftfeld hinein.
Ganz an den Rand lässt er sich schieben; und an Karfreitag sogar noch darüber hinaus. Er drängt sich nicht auf. Aber er ist da. Ohne ihn würde der Rauch ins Leere wehen.
Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
„Trage stets mich auf den Händen“
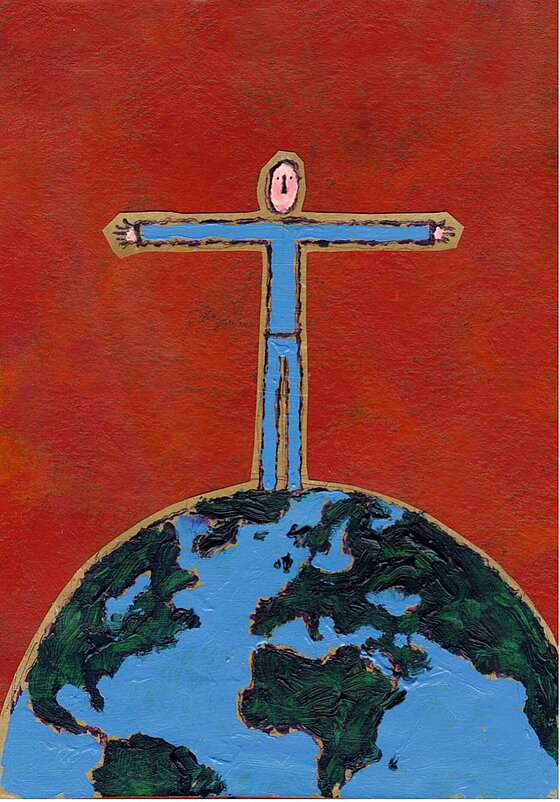
„Trage stets mich auf den Händen“
Kleine Anrede an den Herrn Jesus
Gedanken zur Jahreslosung Joh. 6,37 – mit EG 61
(EG 61,1) Hilf, Herr Jesu, lass gelingen,hilf, das neue Jahr geht an; lass es neue Kräfte bringen,dass aufs Neu ich wandeln kann. Neues Glück und neues Leben wollest du aus Gnaden geben
Lieber Herr Jesus,
ich mag dieses Bild von Dir. Dein Kreuz steht auf der Welt. Deine Arme sind weit offen, als könnten wir direkt zu Dir laufen. Du versprichst: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und kaum hören wir das, kommen wir auch schon. Stellen uns unter das Kreuz. Oder laufen Dir in die Arme. Einfach nur, um aufgehoben zu sein. Um einen Ort zu haben, einen Ort des Friedens. Nur Du weißt, wie viel Unfrieden in uns ist und in der Welt. Nur Du weißt, wie dunkel oder bedrückt unsere Gedanken oft sind. Aber bei Dir ist es hell. Die Farben machen uns froh: ein helles Blau, ein warmes Rot. Da möchte ich sein. Da, wo es hell und warm ist.
(EG 61,4+5)
Herr, du wollest Gnade geben, dass dies Jahr mir heilig sei und ich christlich könne leben ohne Trug und Heuchelei, dass ich noch allhier auf Erden fromm und selig möge werden.
Jesus richte mein Beginnen, Jesus bleibe stets bei mir, Jesus zäume mir die Sinnen, Jesus sei nur mein Begier, Jesus sei mir in Gedanken, Jesus lasse nie mich wanken!
Das ist es ja, lieber Herr Jesus, was uns das Leben oft so schwierig macht: dass wir wanken. Ein seltsames Wort. Das benutzen wir kaum noch. Es trifft aber zu. Wir wanken. In Gedanken und im Leben. Wir wissen dann einfach nicht: Was ist richtig und was ist falsch? Was ist hilfreich oder nicht? Was hilft uns? Und schadet zugleich vielleicht anderen? Dann ist alles in uns wie ein Wanken. Die Füße haben keinen festen Tritt, die Gedanken schlingern – am Tag so und in der Nacht anders. Sollen wir so weitermachen wie immer? Oder müssen wir die Richtung ändern? Dann klopft das Herz etwas schneller. Oder wir werden bald müde vom Denken. Was ist gut fürs Leben? Für unser Leben und für unser aller Leben?
Du weißt ja: Wir wissen dann nicht. Wir möchten dann einfach nur hören, wie Du in der Jahreslosung sagst: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Allein das zu hören ist schon beruhigend. Es gibt jemanden, der uns aufnimmt. Es gibt einen Ort, wo wir hinkönnen. Ob wir nun gerade stehen oder wanken; ob wir sicher sind oder nicht. Ob wir klug sind oder ahnungslos. Wir können kommen. Du trägst uns.
(EG 61,6) Jesu, lass mich fröhlich enden dieses angefangne Jahr. Trage stets mich auf den Händen, stehe bei mir in Gefahr. Freudig will ich dich umfassen, wenn ich soll die Welt verlassen.
Trage stets mich auf den Händen, lieber Herr Jesus. Das wünsche ich mir für das neue Jahr. Oft tun wir ja so, als wüssten wir Bescheid. Dabei wissen wir so wenig.
Vor allem von dem, was kommt. In den letzten beiden Jahren haben wir lernen müssen, wie wenig wir voraussehen können. Wir überlegen und planen und gestalten – auf einmal aber ist alles vergeblich. Beinahe jede Woche mussten wir die Pläne zur Seite legen und neue machen. Ausgeliefert fühlt man sich da. Als wanke man hin und her und werde dabei auch noch geschubst bis beinahe zum Umfallen.
Nein, wir haben die Welt nicht im Griff; wir haben uns selber ja oft auch nicht im Griff. Da hören wir gerne, dass wir zu Dir kommen können. Einfach zu Dir kommen können. In Deine Arme. Wie damals, als wir zu Mama oder Papa liefen, wenn uns etwas weh tat. Du bleibst. Du bist für uns da. Trage stets mich auf den Händen. Darum bitte ich Dich, Herr Jesus.
(EG 61,2) Was ich sinne, was ich mache, das gescheh in dir allein; wenn ich schlafe, wenn ich wache, wollest du, Herr, bei mir sein; geh ich aus, wollst du mich leiten; komm ich heim, steh mir zur Seiten.
Du weist keinen Menschen ab. Das ist gut zu wissen. Und ich bitte immer: Bleibe bei uns, Herr; bleibe bei mir. Du weißt auch nicht jeden Weg. Aber Du weißt, wie wir Wege gehen sollen. In Liebe sollen wir gehen. In möglichst viel Liebe. Das ist gut zu wissen. Wenn wir bei Dir sind, neben Deinem Kreuz oder in Deinen Armen, dann hören wir von Dir, was uns hilft: „Liebe deinen Nächsten wie Dich selbst.“ Manchmal ist das leicht; und manchmal schwierig. Es hilft uns aber, es hilft mir. Ich weiß dann auch nicht immer, welche Richtung die richtige ist. Ich weiß aber, wie ich gehen soll. Mit Rücksicht, achtsam, ohne Ellbogen. Jeden Tag wieder. Ich kann das üben. Ich muss nicht aufbrausen und auch nicht gedankenlos drauflosgehen. Ich kann mich an Dir festhalten, an Deinen Worten. Sie sind wie Licht und Geländer: „Liebe deinen Nächsten wie Dich selbst.“ Ich will mir Mühe geben. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei mir. Was ich denke und tue, will ich in Liebe tun. In größtmöglicher Liebe. Zu mir und anderen. Trage stets mich auf den Händen. Steh mir bei, Herr. Ich weiß, Du tust es. Das beruhigt mich. Ich kann leichter lieben, wenn ich ruhiger werde. Sei meine Ruhe, Herr Jesus. Das bitte ich Dich. Für andere und für mich.
(EG 61,1.6) Jesu, lass mich fröhlich enden dieses angefangne Jahr. Trage stets mich auf den Händen, stehe bei mir in Gefahr. Freudig will ich dich umfassen, wenn ich soll die Welt verlassen.
Ein gesegnetes neues Jahr wünschen Ihnen Ihre
Paulus – Kirchengemeinde Castrop
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Weihnachten im Dreiklang

Gedanken zu Jesaja 9,5
1
Josef kommt kaum vor. Das Bild erinnert mich an eines in der Vinzentiuskirche in Bochum-Harpen, wo Josef im Stall am Kochtopf steht. Und hier auch. Endlich ist mal Josef zu sehen! Das war mein erster Gedanke, als ich das Bild von Guido Reni sah. Auf so vielen weihnachtlichen Darstellungen ist Josef nur Beiwerk. Er steht meistens ein bisschen hilflos neben Maria herum, verschwindet etwas hinter Ochs und Esel oder sitzt gar draußen vor dem Stall, weil er drinnen keinen Platz zu haben scheint. Aber nicht auf diesem Bild.
Guido Reni schenkt uns eine Szene, die anrührender nicht sein könnte. Josef trägt seinen Sohn auf dem Arm und scheint sein Glück über das Kind kaum fassen zu können. Es ist eine stille Szene – von Engeln, Hirten und Königen keine Spur. Nur Josef mit Kind in wohltuend warmen Farben; beschienen von einem Licht, das von oben her auf die beiden fällt.
2
Das Besondere an dieser Szene ist der Blick zwischen den beiden. Josefs Augen scheinen sich nicht von seinem Sohn lösen zu können. Als könne er nicht begreifen, dass dieses kleine Wesen auf seinem Arm nun wirklich auf der Welt ist und zu ihm gehört. Ganz genau möchte er ihn erkennen. Auch der kleine Jesus sieht seinen Vater an. Zwischen den beiden, dort, wo ihre Blicke sich treffen, entsteht etwas. Das sehen wir, wenn wir auf das Bild schauen. Wir fühlen es, können es aber nur schwer in Worte fassen. Es ist der Moment, in dem Beziehung entsteht. Für diesen Augenblick gibt es nur den anderen, der sich seinen Weg durch die Augen in das Herz bahnt.
3
Auch wir als Betrachter und Betrachterinnen sind wie gefesselt von diesem Augenblick; von dem, was dort geschieht zwischen Vater und Sohn. Es braucht fast ein bisschen Überwindung, sich von den Blicken abzuwenden und noch den Rest des Bildes wahrzunehmen.
Erst dann fallen die Hände auf. Wie zärtlich Josef den Säugling trägt! Fast als hätte er Angst, ihn zu stark zu drücken. Er trägt ihn wie das Kostbarste, was er je in den Armen gehalten hat, und nimmt ihn mit hinein in den Schutz seines Mantels. Auch das Kind hält etwas in seinen Händen. Seine Finger umschließen einen Apfel.
4
Auch wenn es so aussieht, als halte das Kind den Apfel eher beiläufig, ist die Wahl der Frucht von Reni wohl nicht zufällig geschehen. Apfel heißt in lateinischer Sprache Malus – dasselbe Wort bedeutet aber auch böse, schlecht. Dieses Wortspiel hat in der kirchlichen Tradition dazu geführt, dass die Frucht, die Eva im Paradiesgarten vom Baum der Erkenntnis pflückte, mit einem Apfel identifiziert wurde. Der Apfel steht sinnbildlich für die Schuld des Menschen.
Es gibt aber noch eine andere Interpretation des Apfels in der Kunst: Er steht wegen seiner Kugelgestalt auch für Vollkommenheit, Schönheit, für Macht und Herrschaft. Hinter dem Kind mit dem Apfel in der Hand verbirgt sich das Bild, das so schwer zu begreifen ist: Gott legt die Herrschaft über die Welt, mit all dem Guten und Bösen, in die Hände seines Sohnes, der als neugeborenes Menschenkind in die Welt der Menschen kommt.
5
„Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst“ (Jes. 9,5). Liebevoller als in dem Bild von Guido Reni kann man kaum ausdrücken, wie diese Herrschaft ausgeübt wird. Sie vollzieht sich im Sehen, im Halten und im Lieben. Mit diesem Dreiklang wird das noch kleine Jesuskind groß werden und auf die Menschen zugehen. Er wird sie so ansehen, dass sie sich selbst in seinem Blick neu begegnen können. Er wird sie halten, als wären sie das Kostbarste auf der ganzen Welt, und sie so lieben, dass er sich selbst hingeben und in ihnen verlieren wird. Sehen, Halten, Lieben – das ist der Klang von Weihnachten.
Wir wünschen Ihnen, dass sie in dieser Woche zwischen den Jahren, gesehen, gehalten und geliebt sind.
Eine gesegnete Woche
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Ein unvergesslicher Blick

Gedanken zu Lukas 1,26-38
1
Eine junge Frau im dunkelblauen Tuch. Helles Gesicht, Blick leicht abgewandt. Eine Hand abwehrend erhoben, während die andere Hand das Tuch vor der Brust verschließt. Die junge Frau erinnert mich irgendwie an eine Schauspielerin, aber dies ist kein Glamour-Bild vom roten Teppich irgendeines Filmfestivals. Kein Bild von heute oder vorgestern, sondern ein halbes Jahrtausend alt – gemalt von Antonello da Messina 1475. Und die Geschichte dazu ist 2.000 Jahre alt.
2
Die Geschichte ist weltberühmt und unzählbar oft gemalt. Hier aber nicht aufwendig erzählt mit großer Bühne, allerhand Requisiten, Architekturkulisse und allen Protagonisten. Kein Raum, keine Kulisse – nur eine Frau, ihre Hände, ihr Blick.
Die rechte Hand erschrickt, wehrt einen unerwarteten Gast ab. Der dynamische Luftzug seiner Ankunft scheint die Blätter des Schriftstücks, in das sie vertieft war, noch aufzuwirbeln. Die Rechte hält ihn erschrocken und irritiert auf Abstand, lässt ihn aber doch seine Botschaft sprechen. Die linke Hand fasst das um den Kopf gelegte Tuch vor der Brust zusammen. Die junge Frau verschließt sich nicht. Sie versucht, bei sich zu bleiben. Sie ist nicht in einer anderen Welt. Die Botschaft trifft auf Fragen, auf Zweifel und berührt doch das Herz unter ihrer Linken.
Ihr Blick wendet sich nach innen – als fühlte sie bereits, was eben angekündigt ist: das besondere Kind in ihrem Leib. Die Gesichtszüge entspannt. Die Lippen umspielt ein leises Lächeln. In allem birgt sie sich im blauen Tuch der Treue Gottes. Keine teuren Stoffe oder glänzende Seide. Ein schmuckloses Kopftuch, wie man es es früher getragen hat als Zeichen des tiefen Gottvertrauens.
3
Sie haben die Geschichte längst erkannt. Ein Engel kommt und verkündigt der jungen Maria, dass sie schwanger werden und ein Kind gebären wird: Jesus. „Sein Reich wird kein Ende haben.“, sagt der Engel „Aber wie soll das zugehen?“, fragt Maria. „Bei Gott ist nichts unmöglich!“ Und Maria willigt ein.
Heilsgeschichte reduziert und konzentriert auf eine Figur, zwei Hände und einen Blick. Wer das Bild schaut, ist kein unbeteiligter Zuschauer, sondern mittendrin im Heilsgeschehen, weil ganz dicht dabei und ganz nah dran an Maria. Kein fernes Bühnenstück, sondern überwältigende Beteiligung mit Nähe und Gefühl.
4
Wie sehr unterscheidet sich doch diese unabgelenkte Nähe und solches Gefühl von dem Geschehen rund um den vierten Sonntag im Advent, so kurz vor dem Weihnachtsfest, wie wir das so kennen Ruhe und tiefe Erkenntnis gegenüber möglicher Hast und Hetze, oft ohne Blick für das Wesentliche. Verinnerlichte Erwartung und leise Vorfreude gegenüber dem lauten und manchmal hektischen Geschenkestress, vielleicht in diesem Jahr auch den immer größer werdenden Sorgen
Ich wünsche mir nicht nur im Advent mehr von Marias nach innen gerichtetem Blick der leisen Vorfreude. Ich wünsche mir größeres Vertrauen in den verheißenen Weltenherrscher, der die bestehende Welt auf den Kopf stellen wird. Wo solche Betroffenheit und das Vertrauen ausbleibt, da ist das eigentliche Weihnachtsfest, das mit Heilsgeschehen verbunden ist ganz weit weg. Und die altbekannte Geschichte ist nur eine Geschichte die kurz in dieser Zeit gehört wird und dann aber auch wieder weg ist.
Ich bin dankbar für dieses Bild, diesen Blick, den der Maler Antonello da Messina vor über 500 Jahren einfing, und auf Leinwand festhielt.
Eine gesegnete Weihnachtswoche wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Das Leuchten der Ewigkeit

1
Hirten, Hebammen und Propheten grüßen das Kind. Wie eine Weihnachtsikone aus der griechisch-orthodoxen Kirche mutet dieses Bild an. Maria bestimmt in ihren leuchtenden Farben die Szene. Sie zieht den Blick auf sich. Um sie herum wirken alle anderen Personen wie Spielzeugfiguren, bis auf die beiden Propheten, die das Bild rahmen: Jesaja (links) und Hesekiel (rechts). Beide halten sie ihre Schriftrollen in der Hand: Schon lange haben sie ihn angekündigt und nun hat sich die Verheißung erfüllt. Jesaja sagt (9,5): Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter ... Und der Prophet Hesekiel (37,24+26a): Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle … Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein.
2
Dieses Bild ist Teil eines großen Kunstwerkes des italienischen Malers Duccio di Buoninsegna. Um 1311 fertigte er mit seinen Schülern eine Maestà, eine thronende Maria mit Kind, für den Altar des Doms zu Siena. Es ist ein Hochaltar, bestehend aus 70 Einzeltafeln, die Szenen aus dem Leben Jesu und Marias darstellen sowie Propheten und Heilige. Leider ist die Maestà nicht mehr vollständig. Dieses kleine Tafelbild aus der Predella befindet sich heute im National Museum of Art in Washington D.C.
Neben der übergroßen Maria wirkt Jesus fast wie eine Puppe. Fest eingewickelt und völlig unbeweglich liegt er auf einem Futtertisch, der eher an einen Altar als an eine Krippe erinnert. Josef sitzt zusammengekauert in der linken Ecke und versinkt fast in seinem roten Mantel. Er ist nur eine Randfigur, was ihm wohl auch bewusst ist. Er hält sich zurück und überlässt Maria die Ehre. Was die Heilige Familie verbindet, sind die Heiligenscheine.
3
Wie Kinder stehen die Hirten am rechten Bildrand und recken ihre Hälse gen Himmel. Sie lauschen den Engeln, die ihnen die frohe Botschaft verkünden.
Sie sind noch fasziniert von den himmlischen Heerscharen und ihrer Verkündigung. Ihre Schafe ruhen geduckt am unteren Bildrand. Auch ein schwarzes ist dabei. Das darf in keiner Herde fehlen. Ochs und Esel schauen bescheiden aus dem Dunkel der Höhle hervor und wagen einen Blick auf das Kind.
Spannend ist auch die Szene vorn im Bild – auch sie in Miniaturgröße. Zwei Hebammen baden ein Kind. Auch dies wird auf Weihnachtsikonen häufig dargestellt. Die Hebammen bestätigen die natürliche Geburt Jesu. Sie pflegen ihn wie jedes Neugeborene. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Die Szene spielt sich in einer Mischung aus Höhle und Stall ab, als ob der Stall schon mit der Grabhöhle in Verbindung gebracht wird. Tod und Auferstehung schwingen von Anfang an mit.
4
Darüber funkelt der Stern, der erst auf den zweiten Blick erkennbar ist. Überstrahlt wird er vom Gold der Engel, die alles mit göttlichem Glanz überziehen. – Das Gold ist typisch für die Ikonenmalerei, aber auch für die Malerschule in Siena, die Duccio mitbegründete und prägte. Das Gold steht für die Herrlichkeit Gottes, die die Heilsgeschichte durchzieht.
Mir geht es oft so, dass es, während ich dieses Bild betrachte, in mir hell wird. Es rührt mich an, weil ich finde, dass Gottes Ewigkeit darin aufleuchtet. Von Anbeginn der Zeit ist es der eine Gott, der die Geschichte mit den Menschen schreibt. Die Propheten weissagten in seinem Namen. In Jesus Christus kam Gott selbst auf die Welt. Und noch immer ist er derselbe, der auch mein Leben, das immer wieder von Dunkelheit geprägt ist, golden durchdringt.
Ich würde mir wünschen, dass es ihnen als Betrachter und Leser auch so geht und es Ihnen Licht in diese Adventszeit bringt.
Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt
Weniger wollen,... weniger erwarten
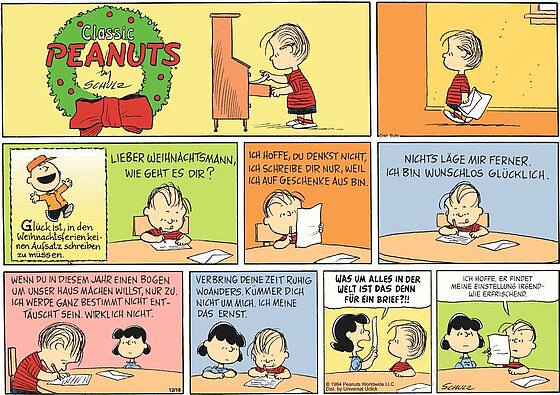
1
Wir sollten hinten anfangen, die beiden Geschwister zu verstehen. Hinten, mit den in fetten Buchstaben gedruckten Worten der fassungslosen Lucy. Die ruft aus: WAS UM ALLES IN DER WELT IST DAS DENN FÜR EIN BRIEF?!! Vermutlich setzt ihr Verstand kurz aus. Ihr Bruder Linus schreibt dem Weihnachtsmann, dass der in diesem Jahr ruhig mal an ihrem Haus vorbeigehen könne; er, Linus, sei „wunschlos glücklich“. Dies hält er für eine „irgendwie erfrischende Einstellung“.
Lucy offenbar nicht. Sie ist außer sich. Freiwillig auf Geschenke verzichten? Das ist Lucys Sache nicht. Wenn sie etwas dazu tun kann, wird dieser Brief den Weihnachtsmann nie erreichen.
2
Weihnachten ohne Wünsche? Das ist schwer vorstellbar. Die Selbstlosigkeit, in der Linus hier auf Geschenke verzichtet, ist selten. Noch seltener ist sein wunschloses Glücklichsein. Oder ist es vielleicht ein Trick, mit dem er auf sich aufmerksam macht, damit der Weihnachtsmann erst recht zu ihm kommt? Zuzutrauen wäre das dem Zeichner der Peanuts, Charles M. Schulz (1922–2000). Der kennt sich gut aus in Kinderseelen, auch in ihren verschlungenen Pfaden. Und manchmal ist in einem „wunschlos glücklich“ ja noch die leise Hoffnung, ein anderer möge sich bitte etwas einfallen lassen.
Weihnachten ohne Wünsche ist schwer vorstellbar. Es muss dabei nicht immer um Geld gehen. Aber auf friedliche Zeiten, auf eine gemütliche Zeit mit der Familie oder auf Fürsorge und Liebe untereinander hofft man wohl doch. Oder vielleicht nur das Ende der Corona – Zeit!
Und Gott wünschen wir uns nicht doch oft, er möge eingreifen uns begegenen?
3
Natürlich stimmt es: Vieles, was heutzutage für Menschen zum Weihnachtsfest gehört, hat mit dem ursprünglichen weihnachtlichen Geschehen wenig zu tun. Das, was wir den „weihnachtlichen Rummel“ nennen und an dem wir uns oft beteiligen, ist aus Sicht des Stalls von Bethlehem eher fremd. Auch die Unruhe, die viele im Advent ergreift, passt nicht recht zur stillen Anbetung der Heiligen Drei Könige oder zum Lobgesang der Engel.
Aber es sind ja schließlich auch zweitausend Jahre vergangen seit der Geburt Jesu. Da kann man schon mal ein wenig ausschmücken – und Glühwein wird in der Adventszeit so wichtig wie kaum etwas anderes. Eins bleibt ja bei allem, was geworden ist aus der Zeit des Advents: Es gibt eine Sehnsucht nach Heilem, nach heilen Momenten im Leben – eine Sehnsucht nach Gott. In einem biblischen Text zum 2. Advent wird Gott direkt angesprochen – man könnte auch sagen: Gott wird frontal angegangen:
4
Im 63ten Kapitel des Jesaja- Buches finden wir diesen Text. Der ganze Text ist ein einziger Aufschrei. Mit doppeltem Inhalt. Im ersten Teil (Verse 15-19a) ist er eine gewaltige Klage, dass auch Gott Verantwortung hat. Im zweiten Teil (63,19b bis 64,3) wird Gott angefleht, zur Erde zu kommen; mitten hinein in das Leben derer, die nach ihm rufen. Die Worte sind ein Schrei nach Gott; er soll heilen, was von uns nicht zu heilen ist.
In dieser Sehnsucht nach Heilem sind schon alle unsere Wünsche und Hoffnungen der Adventszeit umschlossen. Wir schmücken und schenken und beten, weil wir die Nähe Gottes fühlen wollen. Wir suchen einen adventlichen und weihnachtlichen Frieden in und um uns, der höher sein soll als menschliche Vernunft. Das dürfen wir auch hoffen. Wir dürfen von Gott erwarten, dass er „wohltut denen, die auf ihn harren“.
5
Und wir dürfen alles tun, um Gott den Weg zu uns zu bereiten. Ein großer Schritt ist, nicht nachtragend zu sein. Zu möglichst niemandem. Um Gottes willen einen inneren Frieden zu schließen mit sich und dem, was uns im vergangenen Jahr belastet hat. Wir wollen es niemandem nachtragen, möglichst. Wir wollen den Frieden nicht von anderen erwarten, sondern von uns selbst. Wir stehen dann Gott nicht so sehr im Weg, der ja mein friedvolles Herz wünscht.
Noch einen kleinen Schritt zum Heilwerden zeigt mir der kleine Linus auf dem Bild. Ich könnte auf Wünsche auch verzichten, selbst wenn Lucy darüber entsetzt ist. Weniger wollen, weniger erwarten macht mich innerlich freier. Vielleicht bringt es mich auch Gott näher. Ich hoffe es wenigstens und bitte Gott darum. Hilf mir, Gott, könnte ich bitten – hilf mir, einfacher zu werden.
Vielleicht erkenne ich in der Einfachheit besser, wie wohl Gott schon an mir getan hat und noch tut. Vielleicht sehen Wunschlosere klarer, was Gott schon alles erfüllt hat.
Eine gesegnete Woche nach dem 2. Advent wünschen Ihnen Ihre
Arno Wittekind, Dominik Kettling und Johannes Ditthardt



